Nava Ebrahimi: Und Federn überall
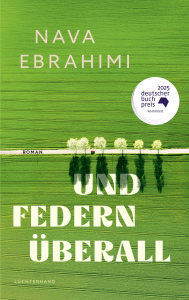 Einige Freunde von mir sind im Emsland aufgewachsen, leben aber heute in Ostwestfalen. Sie erzählten, dass das Emsland eine ausgesprochen dröge Gegend sei und sie gerade als Jugendliche dort beinahe an Langeweile verstorben wären. Somit ist das fiktive Kleinstädtchen Lasseren im Zentrum des Geschehens nicht schlecht gewählt, mit unterentwickelter Infrastruktur gerade im ÖPNV, beherrscht von einer Geflügelfabrik, dem größten und einzigen bedeutenden Arbeitgeber. Nava Ebrahimi erzählt über das Lebens von sechs Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten oder leben. Es geht um Identität, Fremdheit, Migration, ökonomische Zwänge, Gewalt und soziale Kälte. Eine alleinerziehende Mutter mit zickiger Tochter und überangepasstem Sohn, ein afghanischer Flüchtling mit Liebe zur Poesie, eine Automatisierungs-Spezialistin in ihrem Kampf mit Leben und Realität, ein Manager in dieser beinahe surrealen Fleischfabrik, eine Polin mit einem Leben in prekären Verhältnissen. So gesehen packt Ebrahimi alle schwierigen Themen unserer Zeit in einen Roman. Da mag Überfrachtung drohen, doch Ebrahimis klare, schnörkellose Sprache, die direkt und authentisch wirkt, sowie ihr geschickter Aufbau, der die Verbindungen zwischen den Figuren und ihren Leidensgeschichten erst nach und nach enthüllt, verhindern das. Die Metapher der „Wooden Breast“, eine Mastgeflügel-Krankheit, steht symbolisch für den existenziellen Stress und die Zerbrechlichkeit der Menschen im Buch. Darum herum spinnt Ebrahimi eine Abfolge von Kapiteln, in denen sich Menschen begegnen oder eben nicht.
Einige Freunde von mir sind im Emsland aufgewachsen, leben aber heute in Ostwestfalen. Sie erzählten, dass das Emsland eine ausgesprochen dröge Gegend sei und sie gerade als Jugendliche dort beinahe an Langeweile verstorben wären. Somit ist das fiktive Kleinstädtchen Lasseren im Zentrum des Geschehens nicht schlecht gewählt, mit unterentwickelter Infrastruktur gerade im ÖPNV, beherrscht von einer Geflügelfabrik, dem größten und einzigen bedeutenden Arbeitgeber. Nava Ebrahimi erzählt über das Lebens von sechs Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten oder leben. Es geht um Identität, Fremdheit, Migration, ökonomische Zwänge, Gewalt und soziale Kälte. Eine alleinerziehende Mutter mit zickiger Tochter und überangepasstem Sohn, ein afghanischer Flüchtling mit Liebe zur Poesie, eine Automatisierungs-Spezialistin in ihrem Kampf mit Leben und Realität, ein Manager in dieser beinahe surrealen Fleischfabrik, eine Polin mit einem Leben in prekären Verhältnissen. So gesehen packt Ebrahimi alle schwierigen Themen unserer Zeit in einen Roman. Da mag Überfrachtung drohen, doch Ebrahimis klare, schnörkellose Sprache, die direkt und authentisch wirkt, sowie ihr geschickter Aufbau, der die Verbindungen zwischen den Figuren und ihren Leidensgeschichten erst nach und nach enthüllt, verhindern das. Die Metapher der „Wooden Breast“, eine Mastgeflügel-Krankheit, steht symbolisch für den existenziellen Stress und die Zerbrechlichkeit der Menschen im Buch. Darum herum spinnt Ebrahimi eine Abfolge von Kapiteln, in denen sich Menschen begegnen oder eben nicht.
Der Roman „Und Federn überall“ weicht durch eine besondere Erzählstruktur und interessante Perspektivwechsel von gängigen Erzählformen ab. Die Handlung ist auf einen einzigen Tag in dieser niedersächsischen Kleinstadt im Nirgendwo verdichtet und wird aus der Sicht von sechs verschiedenen Figuren erzählt, deren Wege sich kreuzen und gegenseitig beeinflussen. Diese Multiperspektivität ist dabei nicht streng abwechselnd oder chronologisch, sondern folgt dem inneren Rhythmus der Figuren und ihren individuellen Geschichten. Jede Figur bringt eine eigene Stimme und Sichtweise ein, mal eher widersprüchlich, dann wieder ergänzend und im Kontrast zueinander. Ihre Biografien und Lebensrealitäten werden kunstvoll miteinander verknüpft und überlagern sich, wodurch sich die Zusammenhänge und Überschneidungen nach und nach zeigen. Sprache und Erzählstil sind dabei unterschiedlich angelegt. Die Gedankenwelt der Figuren zeigt sich in Satzfragmenten, verhedderten Gedankengängen, brüchigen Dialogen oder gebrochenem, lebensnahen Deutsch. Oft wird das Alltägliche durch sprachliche Bilder aufgeladen, fallen dann im nächsten Moment in die Tristesse oder Überforderung des echten Lebens zurück. So gelingt es Ebrahimi, die innere Zerrissenheit, den existenziellen Stress und die Hoffnungen der Figuren direkt spürbar zu machen.
Durch diese Technik des rhythmischen Perspektivwechsels und der fragmentarischen Vielstimmigkeit entsteht ein eindringliches, authentisches und komplexes Bild einer Gesellschaft im Umbruch. Ohne romantisierende Harmonie, sondern mit all ihren Brüchen und Dissonanzen. Ebrahimi zeigt in diesen Bildern, warum das Leben in der Moderne so anstrengend, wenn nicht sogar überfordernd geworden ist. Der Roman wirft einen schonungslosen Blick auf soziale Ausgrenzung, Kritik am realen Kapitalismus und das Ringen um Zugehörigkeit und Menschlichkeit in einer entmenschlichten Arbeitswelt. So wird „Und Federn überall“ ein intensiver, unbequemer und literarisch eindrucksvoller Roman, der den Leser tief in die Lebensrealitäten der Protagonisten eintauchen lässt und gesellschaftliche Probleme greifbar macht. Man könnte auch sagen, dass Leserinnen und Leser sich jeweils zum Teil in einer Person wiederfinden können. So fiktiv der Roman ist, so deutlich macht er, wie schwierig das Leben heute geworden ist, mit all den Fragen und Unklarheiten zu eben Identität, Wirtschaft und Migration. Nach längerer Leseabstinenz war der Wiedereinstieg mit diesem Roman für mich ein guter Start.


Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!