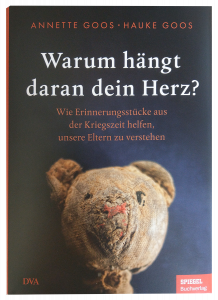Man sollte Wissenschaftlern, bevor sie Bücher schreiben, eine journalistische Grundausbildung verpassen. Sonst passiert nämlich das, was diesem Buch passiert: Zwei bzw. drei der fünf Kapitel des Buches sind für Leserinnen und Leser ohne den entsprechenden Hintergrund schlichtweg unverständlich. Das mag für Bücher auf dem freien Markt noch angehen, für Bücher in der Bundeszentrale für politische Bildung eher unangebracht. Dann zum Inhalt. Den Bedeutungsverlust der Sozialdemokratie kann man auf veränderte Gesellschaftsstrukturen zurückführen. Die klassische Zweiteilung in Arbeit und Kapital hat eben in einer Dienstleistungsgesellschaft kaum noch Berechtigung. Doch auch die konservativen Parteien, CDU/CSU, die Tories in Großbritannien oder die Democrazia Christiana in Italien haben Federn lassen müssen. Wenn sie nicht sogar auf Kleinparteien geschrumpft sind, wie in Frankreich. Wo doch gerade die Christdemokraten nicht nur in der Bundesrepublik viel dazu beigetragen haben, nach dem zweiten Weltkrieg einen liberalen und demokratischen Staat aufzubauen. Konservative Parteien sind auf dem absteigenden Ast, wenn auch in Deutschland nicht ganz so drastisch. Biebricher geht es zwar auch um die Union hier in der BRD, aber insgesamt um die Konservativen in Italien, Frankreich und Großbritannien, warum diese zum Teil in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Was Konservatismus eigentlich ist, beschreibt Biebricher schon in der Einleitung sehr plakativ: „Das Problem besteht darin, dass Konservative typischerweise nicht eigentlich das Bestehende zu verteidigen versuchen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht, sondern das Vergehende.“ Das klingt danach, dass es interessant werden könnte. Wird es aber nur zum Teil.
Man sollte Wissenschaftlern, bevor sie Bücher schreiben, eine journalistische Grundausbildung verpassen. Sonst passiert nämlich das, was diesem Buch passiert: Zwei bzw. drei der fünf Kapitel des Buches sind für Leserinnen und Leser ohne den entsprechenden Hintergrund schlichtweg unverständlich. Das mag für Bücher auf dem freien Markt noch angehen, für Bücher in der Bundeszentrale für politische Bildung eher unangebracht. Dann zum Inhalt. Den Bedeutungsverlust der Sozialdemokratie kann man auf veränderte Gesellschaftsstrukturen zurückführen. Die klassische Zweiteilung in Arbeit und Kapital hat eben in einer Dienstleistungsgesellschaft kaum noch Berechtigung. Doch auch die konservativen Parteien, CDU/CSU, die Tories in Großbritannien oder die Democrazia Christiana in Italien haben Federn lassen müssen. Wenn sie nicht sogar auf Kleinparteien geschrumpft sind, wie in Frankreich. Wo doch gerade die Christdemokraten nicht nur in der Bundesrepublik viel dazu beigetragen haben, nach dem zweiten Weltkrieg einen liberalen und demokratischen Staat aufzubauen. Konservative Parteien sind auf dem absteigenden Ast, wenn auch in Deutschland nicht ganz so drastisch. Biebricher geht es zwar auch um die Union hier in der BRD, aber insgesamt um die Konservativen in Italien, Frankreich und Großbritannien, warum diese zum Teil in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Was Konservatismus eigentlich ist, beschreibt Biebricher schon in der Einleitung sehr plakativ: „Das Problem besteht darin, dass Konservative typischerweise nicht eigentlich das Bestehende zu verteidigen versuchen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht, sondern das Vergehende.“ Das klingt danach, dass es interessant werden könnte. Wird es aber nur zum Teil.![]()
Ganzer Beitrag …
Beiträge
 Der Lebensborn, eine Einrichtung in der Nazi-Zeit, war mir aus verschiedenen Quellen schon geläufig. Aber wie es so ist, man kennt zwar einen Begriff, aber was dahinter steht, bleibt eher unklar. Was ich meinte, aber was der Lebensborn e. V. eben nicht war: So etwas wie eine arische Zuchtanstalt im Sinne des nationalsozialistischen Rassebegriffes. Der Lebensborn war eine Einrichtung von mehreren Häusern unter der Führung der SS, der Schutzstaffel. In deren Heimen brachten Frauen Kinder zur Welt, die entweder geheim gehalten werden sollten, deren Mütter unverheiratet waren oder die Väter nicht verfügbar. Untergetaucht, an der Front, bereits anderweitig verheiratet. Voraussetzung jedoch war, dass sowohl Mütter als auch Väter arisch, die Väter bevorzugt in der SS beteiligt oder anderweitig mit Beziehungen in der Politik. Waren Kinder behindert oder entsprachen nicht dem nationalsozialistischen Menschenbild, war der Heimaufenthalt zu Ende. Akzeptierte Kinder konnten auch an Pflegeeltern oder in die Adoption vermittelt werden. Dorothee Schmitz-Köster geht es jedoch primär nicht um die Lebensborn-Heime an sich, sondern um die Väter der Kinder. Wie bekamen die Väter die meistens unverheirateten Mütter in die Heime? Was waren die Motivationen und welche Typen von Vätern waren beteiligt? Welche Bürden tragen die ehemaligen Lebensborn-Kinder bis heute? So verschieden die Muster-Männer und Seitenspringer, flüchtenden Erzeuger und Ersatz-Väter auch waren, eins haben sie gemeinsam: Aus heutiger Sicht sind fast alle unbrauchbare Väter. Es spiegelt das Selbstbild der involvierten Väter, wie auch die rassistischen wie verlogenen NS-Geschlechterrollen. Dazu das Agieren einer Institution, deren kruder Utilitarismus den Interessen unterschiedlichster Männer entgegenkam.
Der Lebensborn, eine Einrichtung in der Nazi-Zeit, war mir aus verschiedenen Quellen schon geläufig. Aber wie es so ist, man kennt zwar einen Begriff, aber was dahinter steht, bleibt eher unklar. Was ich meinte, aber was der Lebensborn e. V. eben nicht war: So etwas wie eine arische Zuchtanstalt im Sinne des nationalsozialistischen Rassebegriffes. Der Lebensborn war eine Einrichtung von mehreren Häusern unter der Führung der SS, der Schutzstaffel. In deren Heimen brachten Frauen Kinder zur Welt, die entweder geheim gehalten werden sollten, deren Mütter unverheiratet waren oder die Väter nicht verfügbar. Untergetaucht, an der Front, bereits anderweitig verheiratet. Voraussetzung jedoch war, dass sowohl Mütter als auch Väter arisch, die Väter bevorzugt in der SS beteiligt oder anderweitig mit Beziehungen in der Politik. Waren Kinder behindert oder entsprachen nicht dem nationalsozialistischen Menschenbild, war der Heimaufenthalt zu Ende. Akzeptierte Kinder konnten auch an Pflegeeltern oder in die Adoption vermittelt werden. Dorothee Schmitz-Köster geht es jedoch primär nicht um die Lebensborn-Heime an sich, sondern um die Väter der Kinder. Wie bekamen die Väter die meistens unverheirateten Mütter in die Heime? Was waren die Motivationen und welche Typen von Vätern waren beteiligt? Welche Bürden tragen die ehemaligen Lebensborn-Kinder bis heute? So verschieden die Muster-Männer und Seitenspringer, flüchtenden Erzeuger und Ersatz-Väter auch waren, eins haben sie gemeinsam: Aus heutiger Sicht sind fast alle unbrauchbare Väter. Es spiegelt das Selbstbild der involvierten Väter, wie auch die rassistischen wie verlogenen NS-Geschlechterrollen. Dazu das Agieren einer Institution, deren kruder Utilitarismus den Interessen unterschiedlichster Männer entgegenkam.
 Als die Reisewelle die Fresswelle in den Siebzigern in Westdeutschland ablöste, galten die Deutschen als Reiseweltmeister. Das galt nicht nur für die Westdeutschen, sondern für die Ostdeutschen gleichermaßen. In den Achtzigern erreichte die Reiselust einen ersten Höhepunkt. Doch die Ostdeutschen reisten nicht weniger als die Westdeutschen, im Gegenteil, sie reisten eher mehr. Der Witz, der Reiseatlas der DDR sei das dünnste Buch der Welt, stimmt dabei ebenso wenig wie viele andere Stereotype der Wessis über die Ossis. Im Osten wurde nur anders gereist, die bevorzugten Reiseziele im Westen beschränkten sich zum großen Teil ja auch nur auf Österreich, Italien und Spanien. Während in den Achtzigern im Westen die kommerziellen Anbieter mit ihren Pauschalreisen das Reisen dominierten, waren im Osten der FDGB, die Betriebe, die FDJ und das ostdeutsche Reisebüro DER die wichtigsten Organisatoren für Reisen. Ostdeutsche mussten nicht auf Auslandsreisen verzichten. Beliebt waren besonders Ungarn und seine Hauptstadt Budapest, die einzige wirkliche Weltstadt des Ostblocks, mit westlichem Flair, internationalen Zeitungen und Schallplatten. Auch CSSR und Bulgarien standen als Ziele hoch im Kurs. Selbst Kuba, China oder Ägypten waren möglich, wenn man das nötige Budget zur Verfügung hatte. Doch der Individualtourismus blieb in der DDR immer wichtiger als FDGB-Reisen mit „Rotlichtbestrahlung“. Wie man die ständige Indoktrination mit Plakaten und Vorträgen in der DDR nannte. Deshalb war Camping geschätzt, wenn auch nicht so problemlos möglich wie im Westen. Überhaupt stimmte das Bild im Westen vom Urlaub der Ostdeutschen wenig bis gar nicht. Die verbrachten eben nicht ihre paar Urlaubstage in ihren Datschen.
Als die Reisewelle die Fresswelle in den Siebzigern in Westdeutschland ablöste, galten die Deutschen als Reiseweltmeister. Das galt nicht nur für die Westdeutschen, sondern für die Ostdeutschen gleichermaßen. In den Achtzigern erreichte die Reiselust einen ersten Höhepunkt. Doch die Ostdeutschen reisten nicht weniger als die Westdeutschen, im Gegenteil, sie reisten eher mehr. Der Witz, der Reiseatlas der DDR sei das dünnste Buch der Welt, stimmt dabei ebenso wenig wie viele andere Stereotype der Wessis über die Ossis. Im Osten wurde nur anders gereist, die bevorzugten Reiseziele im Westen beschränkten sich zum großen Teil ja auch nur auf Österreich, Italien und Spanien. Während in den Achtzigern im Westen die kommerziellen Anbieter mit ihren Pauschalreisen das Reisen dominierten, waren im Osten der FDGB, die Betriebe, die FDJ und das ostdeutsche Reisebüro DER die wichtigsten Organisatoren für Reisen. Ostdeutsche mussten nicht auf Auslandsreisen verzichten. Beliebt waren besonders Ungarn und seine Hauptstadt Budapest, die einzige wirkliche Weltstadt des Ostblocks, mit westlichem Flair, internationalen Zeitungen und Schallplatten. Auch CSSR und Bulgarien standen als Ziele hoch im Kurs. Selbst Kuba, China oder Ägypten waren möglich, wenn man das nötige Budget zur Verfügung hatte. Doch der Individualtourismus blieb in der DDR immer wichtiger als FDGB-Reisen mit „Rotlichtbestrahlung“. Wie man die ständige Indoktrination mit Plakaten und Vorträgen in der DDR nannte. Deshalb war Camping geschätzt, wenn auch nicht so problemlos möglich wie im Westen. Überhaupt stimmte das Bild im Westen vom Urlaub der Ostdeutschen wenig bis gar nicht. Die verbrachten eben nicht ihre paar Urlaubstage in ihren Datschen.
 Mittlerweile gibt es eine erkleckliche Anzahl von Büchern über den Alltag in der DDR vor und kurz nach 1989. Mal mehr, mal weniger persönlich. Mit meinem ausgeprägten Interesse für die östlichen Bundesländer kam ich deshalb um dieses Buch nicht herum. Zentrum der Geschichte ist die 1986 in Wismar geborene Protagonistin Stine, der Autorin nicht unähnlich, aber nicht mit ihr identisch. Es ist aber keine Geschichte nur über den „Ost-West-Graben“, es ist genau besehen nicht mal eine nur typisch ostdeutsche Angelegenheit. Was Stine erlebt, ist die Kontinuität von Gewalt in ihrer Familie, in der Nazizeit, in der DDR oder während der Baseballschlägerjahre. Diese Gewalt entsteht nicht aus sich selbst, sondern aus Verstrickungen, in einen repressiven Staat, in Ideologien und auch in der eigenen Familie. Diese Verstrickungen ziehen sich über Generationen, mir fiel dabei der Bibelspruch ein, dass die Sünden der Väter an ihren Kindern bis ins dritte oder vierte Glied heimgesucht werden. Angefangen vom Großvater, der mit dem Nationalsozialismus anbandelte, bis zu den Eltern, für die die DDR das bessere, ja das einzig richtige Deutschland war. Da werden Mythen gesponnen, Erzählungen gepflegt, Anekdoten wiederholt, bis sich ihr Wahrheitsgehalt erübrigt. Da wird ge- und verschwiegen, werden Wahrheiten zusammen geschustert. Bis Stine beginnt nachzuforschen, besonders im Fall ihres Großvaters Paul. Erst allmählich wird Stine klar, warum ihr Lebensweg so verlief, wie er verlief. Warum sie nicht darum herum kam, den Kontakt zu ihrer Mutter abzubrechen.
Mittlerweile gibt es eine erkleckliche Anzahl von Büchern über den Alltag in der DDR vor und kurz nach 1989. Mal mehr, mal weniger persönlich. Mit meinem ausgeprägten Interesse für die östlichen Bundesländer kam ich deshalb um dieses Buch nicht herum. Zentrum der Geschichte ist die 1986 in Wismar geborene Protagonistin Stine, der Autorin nicht unähnlich, aber nicht mit ihr identisch. Es ist aber keine Geschichte nur über den „Ost-West-Graben“, es ist genau besehen nicht mal eine nur typisch ostdeutsche Angelegenheit. Was Stine erlebt, ist die Kontinuität von Gewalt in ihrer Familie, in der Nazizeit, in der DDR oder während der Baseballschlägerjahre. Diese Gewalt entsteht nicht aus sich selbst, sondern aus Verstrickungen, in einen repressiven Staat, in Ideologien und auch in der eigenen Familie. Diese Verstrickungen ziehen sich über Generationen, mir fiel dabei der Bibelspruch ein, dass die Sünden der Väter an ihren Kindern bis ins dritte oder vierte Glied heimgesucht werden. Angefangen vom Großvater, der mit dem Nationalsozialismus anbandelte, bis zu den Eltern, für die die DDR das bessere, ja das einzig richtige Deutschland war. Da werden Mythen gesponnen, Erzählungen gepflegt, Anekdoten wiederholt, bis sich ihr Wahrheitsgehalt erübrigt. Da wird ge- und verschwiegen, werden Wahrheiten zusammen geschustert. Bis Stine beginnt nachzuforschen, besonders im Fall ihres Großvaters Paul. Erst allmählich wird Stine klar, warum ihr Lebensweg so verlief, wie er verlief. Warum sie nicht darum herum kam, den Kontakt zu ihrer Mutter abzubrechen.
 Die Geschichte Polens ist mehr als wechselhaft. Ein Spielball zwischen Russland und dem deutschen Reich, mal gar nicht mehr eigener Staat, sondern mit einem baltischen Staat verbunden. Bis 1918 existierte Polen nicht einmal mehr als eigene Nation. Und doch prägten die Deutschen auch nach 1918 die Gebiete im Westen. Als das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg verlor, kam es zur Westverschiebung Polens. Ab 1944 wurden die polnischen Bewohner im sowjetisch besetzten Ostpolen gezwungen, in die so genannten „wiedergewonnenen Gebiete“ umzusiedeln, die vorher unter anderem als Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien und Danzig zum Deutschen Reich gehört hatten. Die ursprünglich dort ansässige deutsche Bevölkerung floh oder wurde vertrieben. Mitnehmen durften sie höchstens einen Koffer oder einen Rucksack, zurück blieben Häuser, Höfe, Möbel und alltägliche Dinge wie Teller und Tassen. Die neuen polnischen Bewohner übernahmen das Zurückgelassene, plünderten und stahlen, oder zogen gleich selbst in die verlassenen Häuser ein. Selbst beinahe mittellos, sind so bis heute die Überreste deutschen Lebens in West- und Nordpolen zu finden. So entstanden gleich zwei Geschichten, die zeigen, wie Biografien und Dinge über Zeiträume, Landesgrenzen und Generationen hinweg bis heute miteinander verwoben sind. Wie das Vergangene und Verlorene bis ins Heute Bedeutung hat. Wenn man das Verhältnis von Polen und Deutschen in der jüngeren Geschichte verstehen will, hilft dieses Buch ungemein. Noch mehr, weckt es Interesse an dieser eher unbekannten Geschichte Europas. Viel Geschichte, viele Geschichten, die nachdenklich machen.
Die Geschichte Polens ist mehr als wechselhaft. Ein Spielball zwischen Russland und dem deutschen Reich, mal gar nicht mehr eigener Staat, sondern mit einem baltischen Staat verbunden. Bis 1918 existierte Polen nicht einmal mehr als eigene Nation. Und doch prägten die Deutschen auch nach 1918 die Gebiete im Westen. Als das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg verlor, kam es zur Westverschiebung Polens. Ab 1944 wurden die polnischen Bewohner im sowjetisch besetzten Ostpolen gezwungen, in die so genannten „wiedergewonnenen Gebiete“ umzusiedeln, die vorher unter anderem als Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien und Danzig zum Deutschen Reich gehört hatten. Die ursprünglich dort ansässige deutsche Bevölkerung floh oder wurde vertrieben. Mitnehmen durften sie höchstens einen Koffer oder einen Rucksack, zurück blieben Häuser, Höfe, Möbel und alltägliche Dinge wie Teller und Tassen. Die neuen polnischen Bewohner übernahmen das Zurückgelassene, plünderten und stahlen, oder zogen gleich selbst in die verlassenen Häuser ein. Selbst beinahe mittellos, sind so bis heute die Überreste deutschen Lebens in West- und Nordpolen zu finden. So entstanden gleich zwei Geschichten, die zeigen, wie Biografien und Dinge über Zeiträume, Landesgrenzen und Generationen hinweg bis heute miteinander verwoben sind. Wie das Vergangene und Verlorene bis ins Heute Bedeutung hat. Wenn man das Verhältnis von Polen und Deutschen in der jüngeren Geschichte verstehen will, hilft dieses Buch ungemein. Noch mehr, weckt es Interesse an dieser eher unbekannten Geschichte Europas. Viel Geschichte, viele Geschichten, die nachdenklich machen.
 Als ich das bestellte Buch über Dinge, an denen das Herz hängt, beim Buchhändler meines Vertrauens abholte, lag tatsächlich das neue Werk von Uwe Wittstock in der Auslage. Als ich daran vorbei ging, wusste ich, dass ich es eh bald holen würde, denn Uwe Wittstock ist ein großer Erzähler über Geschichte. Februar 33 war mein erstes Buch von ihm, und ich habe es sehr zügig gelesen. Weil Wittstock über Historie schreibt wie in einem Roman, spannend, detailliert, mit wechselnden Bezügen und Orten. «Marseille 1940» ist da nicht anders. Das Jahr, in dem die deutsche Reichswehr quasi über Nacht Frankreich überfiel und einnahm, und viele Autoren und Künstler schnellstens das geliebte Paris verlassen mussten. Zuerst mit unklarem Ziel, Hauptsache weg, dann Richtung Süden, in den von den Deutschen nicht beherrschten Teil Frankreichs. Doch das Vichy-Regime, mit den Nazis kooperierend, machte es schwer, in Frankreich zu bleiben. Erzählt werden die Schicksale von mehr und weniger bekannten Menschen, Lion Feuchtwanger, Heinrich und Golo Mann, Hannah Arendt, Marc Chagall und viele mehr. Ausgerechnet ein junger Amerikaner nimmt sich vor, so viele der Verfolgten zu retten wie möglich.
Als ich das bestellte Buch über Dinge, an denen das Herz hängt, beim Buchhändler meines Vertrauens abholte, lag tatsächlich das neue Werk von Uwe Wittstock in der Auslage. Als ich daran vorbei ging, wusste ich, dass ich es eh bald holen würde, denn Uwe Wittstock ist ein großer Erzähler über Geschichte. Februar 33 war mein erstes Buch von ihm, und ich habe es sehr zügig gelesen. Weil Wittstock über Historie schreibt wie in einem Roman, spannend, detailliert, mit wechselnden Bezügen und Orten. «Marseille 1940» ist da nicht anders. Das Jahr, in dem die deutsche Reichswehr quasi über Nacht Frankreich überfiel und einnahm, und viele Autoren und Künstler schnellstens das geliebte Paris verlassen mussten. Zuerst mit unklarem Ziel, Hauptsache weg, dann Richtung Süden, in den von den Deutschen nicht beherrschten Teil Frankreichs. Doch das Vichy-Regime, mit den Nazis kooperierend, machte es schwer, in Frankreich zu bleiben. Erzählt werden die Schicksale von mehr und weniger bekannten Menschen, Lion Feuchtwanger, Heinrich und Golo Mann, Hannah Arendt, Marc Chagall und viele mehr. Ausgerechnet ein junger Amerikaner nimmt sich vor, so viele der Verfolgten zu retten wie möglich.
Der zweite Weltkrieg ist längst vorbei, seine Spuren und die Dinge, die in dieser Zeit eine Rolle spielten, sind noch da. Dinge wie ein Kleiderbügel, den die Mutter auf der Flucht dabei hatte, ein Trinkbecher, der das Sterben im Krieg verhinderte, oder eine Trillerpfeife und eine Trainingshose, die dem Vater gehörten, der aus dem Krieg nicht zurückkam. Aber auch der Ledermantel eines Nationalsozialisten, der heute als Bekleidung einer Vogelscheuche im Garten dient. Mit ihnen verbindet sich die Erinnerung an Zeiten voller Angst und Leid, für die die Menschen, die sie oft noch als Kind miterlebt haben, zuweilen keine Sprache finden. Es ist nicht nur die Sprachlosigkeit der Kriegskinder, sondern oft auch noch die der Kriegsenkel. Annette und Hauke Goos stellen 36 solcher Erinnerungsstücke vor und lassen ihre Besitzerinnen und Besitzer, darunter Prominente wie die Politiker Björn Engholm und Gerhard Baum, die Schauspielerin Marie-Luise Marjan oder den Autor Paul Maar, von den Dingen erzählen. Zurück geht die Idee für das Buch auf einen Artikel im SPIEGEL in 2019. Herausgekommen ist ein berührendes Buch zu einer Zeit, die weit zurück liegt, aber noch nicht vergangen ist.
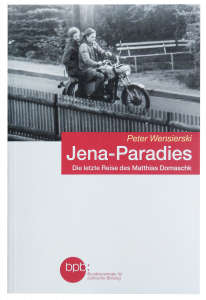 In den letzten Jahren habe ich viele Orte in Sachsen kennengelernt. Von Dresden und Leipzig bis zu Schneeberg, Lichtenstein, Oelsnitz, Augustusburg und viele andere. Nur eines war mir bisher unbekannt: wie das Leben in der DDR in den Achtziger Jahren aussah. Natürlich hatte man etwas über die Stasi gehört, über die Repressalien, über die persönliche Unfreiheit im real existierenden Sozialismus. Das kann sich mit diesem Buch ändern. Es erzählt die Geschichte des Matthias Domaschk, ein Jugendlicher wie aus heutiger Sicht wie tausende andere Youngsters auch. Mit vielen Flausen im Kopf, mit seinen eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, Politik und Leben, die er mit seinen Eltern und deren Zeitgenossen kaum teilt. Schon gar nicht mit einer repressiven Staatsmacht, für die schon das Lesen vieler Bücher über Politik und Philosophie ein Verbrechen darstellt. Wo der Begriff des "Gedankenverbrechens" die Utopien eines George Orwells wahr werden lässt. Doch eine Reise zu Freundinnen und Freunden nach Berlin, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tritt eine Lawine von Ereignissen los, die ihre Gewalt am Ende zur Katastrophe anwachsen lässt. Ein Buch wie ein Roman, das in Wirklichkeit eine Dokumentation ist. Und das uns Wessis begreifbar macht, was es hieß, in diesem Unrechtsstaat zu leben.
In den letzten Jahren habe ich viele Orte in Sachsen kennengelernt. Von Dresden und Leipzig bis zu Schneeberg, Lichtenstein, Oelsnitz, Augustusburg und viele andere. Nur eines war mir bisher unbekannt: wie das Leben in der DDR in den Achtziger Jahren aussah. Natürlich hatte man etwas über die Stasi gehört, über die Repressalien, über die persönliche Unfreiheit im real existierenden Sozialismus. Das kann sich mit diesem Buch ändern. Es erzählt die Geschichte des Matthias Domaschk, ein Jugendlicher wie aus heutiger Sicht wie tausende andere Youngsters auch. Mit vielen Flausen im Kopf, mit seinen eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, Politik und Leben, die er mit seinen Eltern und deren Zeitgenossen kaum teilt. Schon gar nicht mit einer repressiven Staatsmacht, für die schon das Lesen vieler Bücher über Politik und Philosophie ein Verbrechen darstellt. Wo der Begriff des "Gedankenverbrechens" die Utopien eines George Orwells wahr werden lässt. Doch eine Reise zu Freundinnen und Freunden nach Berlin, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tritt eine Lawine von Ereignissen los, die ihre Gewalt am Ende zur Katastrophe anwachsen lässt. Ein Buch wie ein Roman, das in Wirklichkeit eine Dokumentation ist. Und das uns Wessis begreifbar macht, was es hieß, in diesem Unrechtsstaat zu leben.
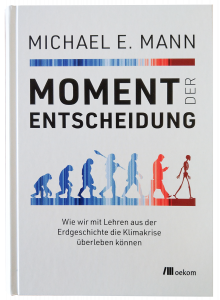 Klimawandel hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Im Extrem sogar in der Hinsicht, dass die Erde nach ihrer Entstehung zwei Milliarden Jahre lang nicht einmal eine Sauerstoff-Atmosphäre hatte. Doch nicht alle Klimaveränderungen waren naturgegeben. Mit dem Auftreten von Leben gab es nun nicht nur eine Wechselwirkung zwischen Erde und Leben, sondern auch umgekehrt. Immer aber über Jahrtausende. Nun gibt es sogar Anhaltspunkte, dass schon vor 6.000 Jahren der Mensch das Klima beeinflusste, als er weiträumig Landschaft gestaltete und Wälder abholzte. Doch so gravierend wie in den letzten zweihundert Jahren hat sich das Klima noch nie verändert. Michael E. Mann führt durch die Erdgeschichte, wie extrem und häufig sich das Klima auf diesem Planeten verändert hat, es gab sogar Phasen, in denen die Erde deutlich wärmer war als heute. Genauso wie Zeiten, in denen die Erde eine Schnee- und Eiskugel war. Fast alle Entwicklungen des Klimas lassen sich heute sehr gut erklären. Leider auch der aktuelle Klimawandel. Es geht also um die heutigen Klimaveränderungen, die der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energiequellen herbei führt. Zugleich hilft das Verstehen bisheriger Klimaveränderungen, wie wir aus der jetzigen Bredouille wieder heraus kommen. Oder wenigstens das Schlimmste verhindern.
Klimawandel hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Im Extrem sogar in der Hinsicht, dass die Erde nach ihrer Entstehung zwei Milliarden Jahre lang nicht einmal eine Sauerstoff-Atmosphäre hatte. Doch nicht alle Klimaveränderungen waren naturgegeben. Mit dem Auftreten von Leben gab es nun nicht nur eine Wechselwirkung zwischen Erde und Leben, sondern auch umgekehrt. Immer aber über Jahrtausende. Nun gibt es sogar Anhaltspunkte, dass schon vor 6.000 Jahren der Mensch das Klima beeinflusste, als er weiträumig Landschaft gestaltete und Wälder abholzte. Doch so gravierend wie in den letzten zweihundert Jahren hat sich das Klima noch nie verändert. Michael E. Mann führt durch die Erdgeschichte, wie extrem und häufig sich das Klima auf diesem Planeten verändert hat, es gab sogar Phasen, in denen die Erde deutlich wärmer war als heute. Genauso wie Zeiten, in denen die Erde eine Schnee- und Eiskugel war. Fast alle Entwicklungen des Klimas lassen sich heute sehr gut erklären. Leider auch der aktuelle Klimawandel. Es geht also um die heutigen Klimaveränderungen, die der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energiequellen herbei führt. Zugleich hilft das Verstehen bisheriger Klimaveränderungen, wie wir aus der jetzigen Bredouille wieder heraus kommen. Oder wenigstens das Schlimmste verhindern.
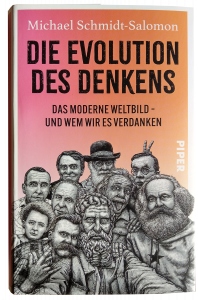 Die Bagger-Attacke auf das Telefonkabel unter dem Asphalt hatte eine längere Offline-Zeit zur Folge. Was ausgiebiges Lesen förderte. Es gibt also Nachholbedarf. Erstes Buch: Das neue Werk von Michael Schmidt-Salomon. Wenn man die pseudowissenschaftliche Esoterik und den baren Unsinn nicht nur in sozialen Medien betrachtet, fragt man sich, was aus den Erkenntnissen eines Einsteins, eines Darwins oder eines Karl Popper geworden ist. Denn diese Leute haben einmal dafür gesorgt, dass das Bild der Welt aus wissenschaftlicher Erkenntnis entstand. Michael Schmidt-Salomon vermutet, dass es einfach daran liegt, dass wir seit der Jahrhundertwende mit solchen Mengen an Informationen überschüttet werden, dass viele Leute den Überblick verlieren. Was eine Art kultureller Demenz bewirkt. In seinem Buch möchte er mit der Erinnerung an zehn Menschen daran erinnern, wie diese einen anderen Blick auf die Wirklichkeit geschaffen haben. Aber auch wie sie die Welt beeinflusst haben und was ihre zentralen Ideen waren. Er bezeichnet diese Leute, wie Albert Einstein, Marie Curie, Karl Marx oder Julian Huxley, als zehn Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild. Schmidt-Salomon geht noch einmal zu den Größen der Wissenschaft und Philosophie zurück. Schildert ihren Werdegang, ihre Persönlichkeit und welche Rolle sie in der heutigen Zeit noch spielen.
Die Bagger-Attacke auf das Telefonkabel unter dem Asphalt hatte eine längere Offline-Zeit zur Folge. Was ausgiebiges Lesen förderte. Es gibt also Nachholbedarf. Erstes Buch: Das neue Werk von Michael Schmidt-Salomon. Wenn man die pseudowissenschaftliche Esoterik und den baren Unsinn nicht nur in sozialen Medien betrachtet, fragt man sich, was aus den Erkenntnissen eines Einsteins, eines Darwins oder eines Karl Popper geworden ist. Denn diese Leute haben einmal dafür gesorgt, dass das Bild der Welt aus wissenschaftlicher Erkenntnis entstand. Michael Schmidt-Salomon vermutet, dass es einfach daran liegt, dass wir seit der Jahrhundertwende mit solchen Mengen an Informationen überschüttet werden, dass viele Leute den Überblick verlieren. Was eine Art kultureller Demenz bewirkt. In seinem Buch möchte er mit der Erinnerung an zehn Menschen daran erinnern, wie diese einen anderen Blick auf die Wirklichkeit geschaffen haben. Aber auch wie sie die Welt beeinflusst haben und was ihre zentralen Ideen waren. Er bezeichnet diese Leute, wie Albert Einstein, Marie Curie, Karl Marx oder Julian Huxley, als zehn Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild. Schmidt-Salomon geht noch einmal zu den Größen der Wissenschaft und Philosophie zurück. Schildert ihren Werdegang, ihre Persönlichkeit und welche Rolle sie in der heutigen Zeit noch spielen.
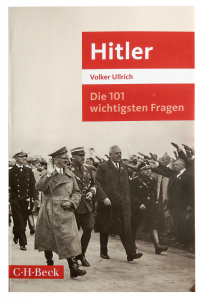 Volker Ullrich mausert sich langsam zu einem meiner liebsten Autoren in Sachen Geschichte. Er schreibt auf den Punkt, sehr lesbar, geradezu unterhaltsam und mit vielen Details. Vorher waren schon «1923» und «Acht Tage im Mai» dran. Im Vergleich zu den früheren Werken ist «Hitler» eher ein schmales Büchlein. Ich habe es trotzdem bestellt, obwohl ich meinte, es brächte jetzt nicht unbedingt die ganz neuen Erkenntnisse. Meinen Irrtum gestehe ich ein. Ullrich widmet sich dieses Mal der persönlichen Vergangenheit des NS-Diktators, wie er sich an die Macht arbeitete, was für ein Mensch Adolf Hitler überhaupt war und dem weiteren Verlauf der Geschichte bis zum bitteren Ende. Für Hitler und Deutschland. Seinen Reiz holt das Buch aber nicht nur aus Daten und Fakten, sondern Ullrich bezieht die Umstände und Bedingungen mit ein, wie und warum Hitler auf deutschem Boden eine solche Diktatur errichten konnte. Zwar heißt es immer wieder, Geschichte würde sich nicht eins zu eins wiederholen. Aber lässt man die damaligen Umgebungsbedingungen des obersten Nationalsozialisten noch einmal an sich vorbei ziehen, kommen erstaunliche Parallelen zur Gegenwart ans Licht. Nicht unbedingt beruhigende.
Volker Ullrich mausert sich langsam zu einem meiner liebsten Autoren in Sachen Geschichte. Er schreibt auf den Punkt, sehr lesbar, geradezu unterhaltsam und mit vielen Details. Vorher waren schon «1923» und «Acht Tage im Mai» dran. Im Vergleich zu den früheren Werken ist «Hitler» eher ein schmales Büchlein. Ich habe es trotzdem bestellt, obwohl ich meinte, es brächte jetzt nicht unbedingt die ganz neuen Erkenntnisse. Meinen Irrtum gestehe ich ein. Ullrich widmet sich dieses Mal der persönlichen Vergangenheit des NS-Diktators, wie er sich an die Macht arbeitete, was für ein Mensch Adolf Hitler überhaupt war und dem weiteren Verlauf der Geschichte bis zum bitteren Ende. Für Hitler und Deutschland. Seinen Reiz holt das Buch aber nicht nur aus Daten und Fakten, sondern Ullrich bezieht die Umstände und Bedingungen mit ein, wie und warum Hitler auf deutschem Boden eine solche Diktatur errichten konnte. Zwar heißt es immer wieder, Geschichte würde sich nicht eins zu eins wiederholen. Aber lässt man die damaligen Umgebungsbedingungen des obersten Nationalsozialisten noch einmal an sich vorbei ziehen, kommen erstaunliche Parallelen zur Gegenwart ans Licht. Nicht unbedingt beruhigende.
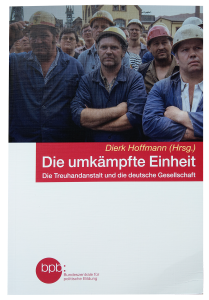 Die Treuhand ist an allem schuld. So jedenfalls eine nicht selten gehörte Aussage, gerade aus den östlichen Bundesländern. Mit dem Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist von 30 Jahren öffnen sich nun die Archive, weshalb Historikern wie Politologen Einzelheiten über die THA, die Treuhandanstalt, zugänglich werden. Das Buch mit Beiträgen verschiedener Autoren fasst viele Themen und Einzelheiten an, mit der Historie beginnend, schließlich ist die THA noch unter der DDR-Regierung Modrow im März 1990 installiert worden. Sollte sie zuerst lediglich als Treuhänder für das Volksvermögen der DDR dienen, erweiterten sich die Aufgaben mit der Wiedervereinigung immens. Nun war die THA für den Übergang der ehemaligen DDR-Wirtschaft in die soziale Marktwirtschaft verantwortlich. Nach ihrem Ende 1993 warfen die Einen der THA vor, die DDR quasi verramscht zu haben. Tatsächlich sind durch Privatisierung oder Liquidation vieler Betriebe fast ein Viertel der Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern verloren gegangen. Andere priesen die THA in höchsten Tönen für ihre Arbeit. Das Buch fasst viele Aspekte der Geschichte zusammen, was die THA zu bewerkstelligen hatte, wie sie das tat, bis hin zu den Vorwürfen, in der THA wären die alten Seilschaften der SED weiter aktiv gewesen. Es werden alternative Wege der Privatisierung betrachtet, wie es die damalige Tschechoslowakei mit dem Kuponmodell machte. Die tatsächlichen und angeblichen Wirtschaftsverbrechen und die Korruption werden thematisiert, ebenso das Versagen einzelner Nebenstellen der THA wie in Halle und Magdeburg. Nicht nur das Themenspektrum ist äußerst breit, auch tauchen die Autoren der Beiträge sehr tief in die Details ab. So ist «Die umkämpfte Einheit« keine leichte Kost und eher für Leserinnen und Leser gedacht, die wirklich in die Tiefe gehen möchten. Trotzdem sind einige Beiträge sicher auch für den interessierten Nichtfachmann interessant und lesenswert.
Die Treuhand ist an allem schuld. So jedenfalls eine nicht selten gehörte Aussage, gerade aus den östlichen Bundesländern. Mit dem Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist von 30 Jahren öffnen sich nun die Archive, weshalb Historikern wie Politologen Einzelheiten über die THA, die Treuhandanstalt, zugänglich werden. Das Buch mit Beiträgen verschiedener Autoren fasst viele Themen und Einzelheiten an, mit der Historie beginnend, schließlich ist die THA noch unter der DDR-Regierung Modrow im März 1990 installiert worden. Sollte sie zuerst lediglich als Treuhänder für das Volksvermögen der DDR dienen, erweiterten sich die Aufgaben mit der Wiedervereinigung immens. Nun war die THA für den Übergang der ehemaligen DDR-Wirtschaft in die soziale Marktwirtschaft verantwortlich. Nach ihrem Ende 1993 warfen die Einen der THA vor, die DDR quasi verramscht zu haben. Tatsächlich sind durch Privatisierung oder Liquidation vieler Betriebe fast ein Viertel der Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern verloren gegangen. Andere priesen die THA in höchsten Tönen für ihre Arbeit. Das Buch fasst viele Aspekte der Geschichte zusammen, was die THA zu bewerkstelligen hatte, wie sie das tat, bis hin zu den Vorwürfen, in der THA wären die alten Seilschaften der SED weiter aktiv gewesen. Es werden alternative Wege der Privatisierung betrachtet, wie es die damalige Tschechoslowakei mit dem Kuponmodell machte. Die tatsächlichen und angeblichen Wirtschaftsverbrechen und die Korruption werden thematisiert, ebenso das Versagen einzelner Nebenstellen der THA wie in Halle und Magdeburg. Nicht nur das Themenspektrum ist äußerst breit, auch tauchen die Autoren der Beiträge sehr tief in die Details ab. So ist «Die umkämpfte Einheit« keine leichte Kost und eher für Leserinnen und Leser gedacht, die wirklich in die Tiefe gehen möchten. Trotzdem sind einige Beiträge sicher auch für den interessierten Nichtfachmann interessant und lesenswert.
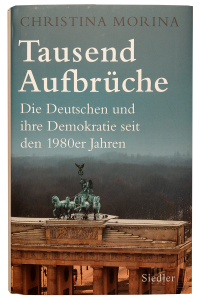 Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Denn man kann dieser Geschichte eine Menge Perspektiven und Aspekte abgewinnen. Wahrscheinlich wird man nie zu einem Ende kommen. Auch Christina Morina stellt noch einmal eine andere Betrachtung an. Es geht nicht grundsätzlich um die Wiedervereinigung an sich, sondern um die unterschiedlichen Arten von Verständnis als Staatbürgerinnen und Staatsbürger, um Demokratie und Demokratieverständnis im Westen wie im Osten. Sowohl lange vor November 1989 als auch nach Oktober 1990. Eine wichtige Grundlage dazu bilden Briefe an den Bundespräsidenten, an Politiker, Minister und sogar die Bundestagspräsidentin. Auf der anderen Seite Zuschriften aus der DDR an die Leitung der SED, sogar an das Ministerium für Staatssicherheit, an Zeitungen und Rundfunk, im Osten wie im Westen. Letztere Schreiben wurden natürlich vor 1990 abgefangen und dienten zum Beweis der staatsfeindlichen Hetze, wie es in der DDR hieß. Briefe einerseits ab November 1989 zum Thema Wiedervereinigung, aber auch zur Frage zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands, die sich in 1991 stellte. Morina traut sich sogar noch an ein Thema, das in diesem Rahmen nicht fehlen darf: Kann man die Beliebtheit der AfD in den neuen Bundesländern auf ein solches unterschiedliches Demokratie- und Staatsverständnis zurückführen? Und hatte das auch etwas mit der Kanzlerschaft der Angela Merkel zu tun, der langjährigen ostdeutsch geprägten Kanzlerin? Und wo sind die tausend Aufbrüche geblieben, die in der DDR ab Sommer 1989 angegangen wurden? Da war doch noch etwas.
Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Denn man kann dieser Geschichte eine Menge Perspektiven und Aspekte abgewinnen. Wahrscheinlich wird man nie zu einem Ende kommen. Auch Christina Morina stellt noch einmal eine andere Betrachtung an. Es geht nicht grundsätzlich um die Wiedervereinigung an sich, sondern um die unterschiedlichen Arten von Verständnis als Staatbürgerinnen und Staatsbürger, um Demokratie und Demokratieverständnis im Westen wie im Osten. Sowohl lange vor November 1989 als auch nach Oktober 1990. Eine wichtige Grundlage dazu bilden Briefe an den Bundespräsidenten, an Politiker, Minister und sogar die Bundestagspräsidentin. Auf der anderen Seite Zuschriften aus der DDR an die Leitung der SED, sogar an das Ministerium für Staatssicherheit, an Zeitungen und Rundfunk, im Osten wie im Westen. Letztere Schreiben wurden natürlich vor 1990 abgefangen und dienten zum Beweis der staatsfeindlichen Hetze, wie es in der DDR hieß. Briefe einerseits ab November 1989 zum Thema Wiedervereinigung, aber auch zur Frage zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands, die sich in 1991 stellte. Morina traut sich sogar noch an ein Thema, das in diesem Rahmen nicht fehlen darf: Kann man die Beliebtheit der AfD in den neuen Bundesländern auf ein solches unterschiedliches Demokratie- und Staatsverständnis zurückführen? Und hatte das auch etwas mit der Kanzlerschaft der Angela Merkel zu tun, der langjährigen ostdeutsch geprägten Kanzlerin? Und wo sind die tausend Aufbrüche geblieben, die in der DDR ab Sommer 1989 angegangen wurden? Da war doch noch etwas.
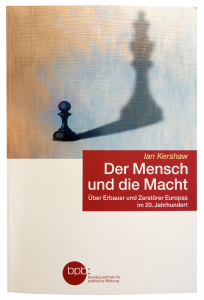 Ian Kershaw ist nicht nur ein bekannter Historiker, speziell für das 20. Jahrhundert in Deutschland, sondern auch ein fleißiger Autor. Dieses Buch stammt aus 2022, schon davor gab es von ihm neun bzw. zehn Bücher speziell über die NS-Herrschaft. Hier widmet er sich nicht allein der deutschen, sondern der europäischen Geschichte. Die Eingangsfrage ist, wie weit das Wirken und die Hinterlassenschaft von Politikern, im weitesten Sinne Führern, ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter oder den jeweiligen Bedingungen ihrer Zeit geschuldet sind. Das Maskulinum trifft es fast ausschließlich, denn von den zwölf dargestellten Personen sind elf Männer. Was den Gegebenheiten im 20. Jahrhundert entspricht. Kershaw betrachtet unter diesen Gesichtspunkten sowohl Demokraten wie Adenauer, Thatcher, Kohl oder Churchill, als auch Diktatoren wie Lenin, Stalin, Franco und Tito. Dass Adolf Hitler da nicht fehlen darf, versteht sich gerade mit Kershaws Spezialgebiet von selbst. Solche Beschäftigungen mit der Vergangenheit mögen etwas wissenschaftlich und hypothetisch daher kommen, doch geht es Kershaw nicht nur um das Verstehen, wie und warum bestimmte Menschen in bestimmten Situationen an die Macht kamen. Denn er stellt an den Anfang eine Reihe von Fragen, was wann warum eine so große Rolle gespielt hat, und in wie weit solche Entwicklungen auch für die Zukunft eine Rolle spielen könnten. Zum Schluss kommen die Antworten als Lehren der Vergangenheit. Bezogen auf die Gegenwart in Deutschland sind die Schlüsse eher beruhigend. Und das liegt an den aktuellen Protagonisten selbst als auch an der Ferne einer ernsthaften deutschen Krise.
Ian Kershaw ist nicht nur ein bekannter Historiker, speziell für das 20. Jahrhundert in Deutschland, sondern auch ein fleißiger Autor. Dieses Buch stammt aus 2022, schon davor gab es von ihm neun bzw. zehn Bücher speziell über die NS-Herrschaft. Hier widmet er sich nicht allein der deutschen, sondern der europäischen Geschichte. Die Eingangsfrage ist, wie weit das Wirken und die Hinterlassenschaft von Politikern, im weitesten Sinne Führern, ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter oder den jeweiligen Bedingungen ihrer Zeit geschuldet sind. Das Maskulinum trifft es fast ausschließlich, denn von den zwölf dargestellten Personen sind elf Männer. Was den Gegebenheiten im 20. Jahrhundert entspricht. Kershaw betrachtet unter diesen Gesichtspunkten sowohl Demokraten wie Adenauer, Thatcher, Kohl oder Churchill, als auch Diktatoren wie Lenin, Stalin, Franco und Tito. Dass Adolf Hitler da nicht fehlen darf, versteht sich gerade mit Kershaws Spezialgebiet von selbst. Solche Beschäftigungen mit der Vergangenheit mögen etwas wissenschaftlich und hypothetisch daher kommen, doch geht es Kershaw nicht nur um das Verstehen, wie und warum bestimmte Menschen in bestimmten Situationen an die Macht kamen. Denn er stellt an den Anfang eine Reihe von Fragen, was wann warum eine so große Rolle gespielt hat, und in wie weit solche Entwicklungen auch für die Zukunft eine Rolle spielen könnten. Zum Schluss kommen die Antworten als Lehren der Vergangenheit. Bezogen auf die Gegenwart in Deutschland sind die Schlüsse eher beruhigend. Und das liegt an den aktuellen Protagonisten selbst als auch an der Ferne einer ernsthaften deutschen Krise.
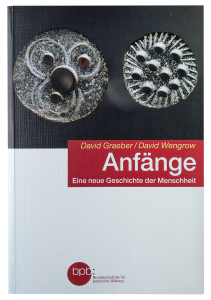 Jean-Jacques Rousseau behauptete, die Ungleichheit der Menschen hätte begonnen, als nach dem Übergang vom Jäger und Sammler zur Landwirtschaft ein Bauer seinen Acker einzäunte und zu seinem Privateigentum erklärte. Man muss dem Genfer Philosophen zugute halten, dass man zu seiner Zeit über die Frühzeit des Homo Sapiens so gut wie nichts wusste. Erst moderne Methoden der Archäologie und der Biogenetik in den letzten Jahrzehnten haben einige zuverlässigere Hinweise ergeben, wie die Geschichte der Menschheit verlief. Während in den Schulen immer noch stereotype Geschichten erzählt werden. Dieses Buch möchte das ändern. Entstanden ist es aus den Diskussionen eines Anthropologen und eines Archäologen über einen Zeitraum von über zehn Jahren. Seit dem 19. Jahrhundert stritt die Wissenschaft darüber, wie eigentlich Menschen ganz früher gelebt haben, wie sie in Gemeinschaften zusammen fanden, ob sie viel oder wenig arbeiteten, wie überhaupt das Leben in der Zeit vor der Neolithischen Revolution, dem Übergang zur sesshaften Landwirtschaft, aussah und verlief. Es geht zum größten Teil um die Jungsteinzeit bis zu den letzten Jahrtausenden vor unsere Zeitrechnung. Wengrow und Graeber zeichnen ein anderes Bild als das gewohnte. Der Ausgangsgedanke im Buch ist überraschend, hat aber mit Rousseau zu tun. Nämlich ob es Ungleichheit unter den Menschen, sozial und wirtschaftlich, schon in den Anfangstagen gab. Oder wann sie so wurde, wie sie heute ist. Auf jeden Fall war alles ganz anders, als Rousseau meinte.
Jean-Jacques Rousseau behauptete, die Ungleichheit der Menschen hätte begonnen, als nach dem Übergang vom Jäger und Sammler zur Landwirtschaft ein Bauer seinen Acker einzäunte und zu seinem Privateigentum erklärte. Man muss dem Genfer Philosophen zugute halten, dass man zu seiner Zeit über die Frühzeit des Homo Sapiens so gut wie nichts wusste. Erst moderne Methoden der Archäologie und der Biogenetik in den letzten Jahrzehnten haben einige zuverlässigere Hinweise ergeben, wie die Geschichte der Menschheit verlief. Während in den Schulen immer noch stereotype Geschichten erzählt werden. Dieses Buch möchte das ändern. Entstanden ist es aus den Diskussionen eines Anthropologen und eines Archäologen über einen Zeitraum von über zehn Jahren. Seit dem 19. Jahrhundert stritt die Wissenschaft darüber, wie eigentlich Menschen ganz früher gelebt haben, wie sie in Gemeinschaften zusammen fanden, ob sie viel oder wenig arbeiteten, wie überhaupt das Leben in der Zeit vor der Neolithischen Revolution, dem Übergang zur sesshaften Landwirtschaft, aussah und verlief. Es geht zum größten Teil um die Jungsteinzeit bis zu den letzten Jahrtausenden vor unsere Zeitrechnung. Wengrow und Graeber zeichnen ein anderes Bild als das gewohnte. Der Ausgangsgedanke im Buch ist überraschend, hat aber mit Rousseau zu tun. Nämlich ob es Ungleichheit unter den Menschen, sozial und wirtschaftlich, schon in den Anfangstagen gab. Oder wann sie so wurde, wie sie heute ist. Auf jeden Fall war alles ganz anders, als Rousseau meinte.
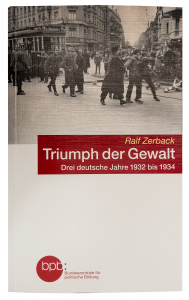 Da wären dann Bücher, die sich auf eine ganze Epoche beziehen, auf ein einzelnes Jahr wie bei Volker Ullrich, oder sogar nur auf eine einzelne Woche. Ralf Zerbach widmet sich in seinem Buch drei Jahren, jedoch drei in der deutschen Geschichte entscheidenden Jahren. In denen die Reichskanzler Brüning und dann von Papen versuchten, die Weimarer Republik wieder mit einer funktionierenden Regierung auszustatten. Bis eher aus Ratlosigkeit am 30. Januar 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wurde und er Deutschland mit einem Terrorregime überzog. Nun gibt es schon reichlich Bücher zu dieser Zeit, insbesondere zu den Vorgängen in der Weimarer Republik wie auch zur Nazizeit. Brauchte die Welt also noch ein Buch zu diesem dunklen Kapitel in Deutschland? Nach dem Lesen würde ich das durchaus bejahen. Obwohl ich schon einen Stapel von Werken an geschichtlicher Literatur in den Regalen habe. Der wesentliche Unterschied bei Zerback gegenüber den anderen Büchern liegt im Fokus auf Vorgeschichte, die Vorgänge hinter den Kulissen der damaligen Tagespolitik und den vielen Randerscheinungen als Folgen. Da muss ich zugeben, dass ich das in solchen Details noch nicht gelesen hatte.
Da wären dann Bücher, die sich auf eine ganze Epoche beziehen, auf ein einzelnes Jahr wie bei Volker Ullrich, oder sogar nur auf eine einzelne Woche. Ralf Zerbach widmet sich in seinem Buch drei Jahren, jedoch drei in der deutschen Geschichte entscheidenden Jahren. In denen die Reichskanzler Brüning und dann von Papen versuchten, die Weimarer Republik wieder mit einer funktionierenden Regierung auszustatten. Bis eher aus Ratlosigkeit am 30. Januar 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wurde und er Deutschland mit einem Terrorregime überzog. Nun gibt es schon reichlich Bücher zu dieser Zeit, insbesondere zu den Vorgängen in der Weimarer Republik wie auch zur Nazizeit. Brauchte die Welt also noch ein Buch zu diesem dunklen Kapitel in Deutschland? Nach dem Lesen würde ich das durchaus bejahen. Obwohl ich schon einen Stapel von Werken an geschichtlicher Literatur in den Regalen habe. Der wesentliche Unterschied bei Zerback gegenüber den anderen Büchern liegt im Fokus auf Vorgeschichte, die Vorgänge hinter den Kulissen der damaligen Tagespolitik und den vielen Randerscheinungen als Folgen. Da muss ich zugeben, dass ich das in solchen Details noch nicht gelesen hatte.
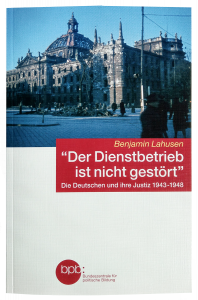 Wen könnte dieses Thema interessieren, außer vielleicht Juristen? Wenn man Bücher bei der Bundeszentrale für politische Bildung ordert, kann man sicher sein, dass der Inhalt von allgemeinem Interesse ist. Dass das auch hier der Fall ist und um welches Oberthema es sich dreht, macht der Autor Benjamin Lahusen schon unterhaltsam in der Einleitung klar. Da sitzt ein Referendar der Gesetzeskunde in einem Gerichtssaal bei einem Fall des Privatrechts. Kurz bevor er droht einzuschlafen, blättert er in einem Fachbuch und stößt auf einen Begriff: das Justitium. Dahinter verbirgt sich der Fall, wenn in einem Staat die Rechtspflege still steht. Im alten Rom bezeichnete "iustitium" sogar den Stillstand des gesamten öffentlichen Lebens, zum Beispiel in der Trauerzeit nach dem Tod des Staatsoberhauptes. So fragt er sich, ob in Deutschland in der Endphase des zweiten Weltkrieges, dem von Goebbels ausgerufenen totalen Krieg, oder nach dem Ende des Krieges und dem Ende des deutschen Reiches es einen Stillstand der Rechtspflege gab. Fast zehn Jahre, ausgebremst von der Corona-Pandemie, forscht er zum Thema, der Rechtspflege in Deutschland von 1943 bis in die Fünfziger. Erstaunlich wenig trocken wird das Thema. Dazu aus unserer heutigen Sicht mit erstaunlichen Vorgängen und Geschehnissen.
Wen könnte dieses Thema interessieren, außer vielleicht Juristen? Wenn man Bücher bei der Bundeszentrale für politische Bildung ordert, kann man sicher sein, dass der Inhalt von allgemeinem Interesse ist. Dass das auch hier der Fall ist und um welches Oberthema es sich dreht, macht der Autor Benjamin Lahusen schon unterhaltsam in der Einleitung klar. Da sitzt ein Referendar der Gesetzeskunde in einem Gerichtssaal bei einem Fall des Privatrechts. Kurz bevor er droht einzuschlafen, blättert er in einem Fachbuch und stößt auf einen Begriff: das Justitium. Dahinter verbirgt sich der Fall, wenn in einem Staat die Rechtspflege still steht. Im alten Rom bezeichnete "iustitium" sogar den Stillstand des gesamten öffentlichen Lebens, zum Beispiel in der Trauerzeit nach dem Tod des Staatsoberhauptes. So fragt er sich, ob in Deutschland in der Endphase des zweiten Weltkrieges, dem von Goebbels ausgerufenen totalen Krieg, oder nach dem Ende des Krieges und dem Ende des deutschen Reiches es einen Stillstand der Rechtspflege gab. Fast zehn Jahre, ausgebremst von der Corona-Pandemie, forscht er zum Thema, der Rechtspflege in Deutschland von 1943 bis in die Fünfziger. Erstaunlich wenig trocken wird das Thema. Dazu aus unserer heutigen Sicht mit erstaunlichen Vorgängen und Geschehnissen.
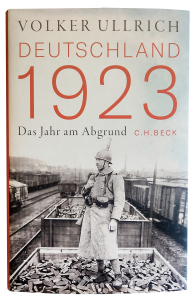 Es hat zuweilen Versuche gegeben, das Jahr 2023 mit 1923 zu vergleichen. Was sich bei näherer Betrachtung als Unsinn herausstellt. Volker Ullrich, Autor des faszinierenden Buches über die letzte Woche des Dritten Reiches, hat nun ein Buch über genau dieses deutsche Schicksalsjahr 1923 geschrieben. Und macht deutlich, dass die politische, wirtschaftliche und soziale Lage vor einem Jahrhundert eine ganz andere war als nun im 21. Jahrhundert. Die Besetzung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes durch Frankreich, die Hyperinflation als Folge daraus, das Erstarken rechtsextremer Parteien, die gefährliche Instabilität der jungen Weimarer Republik, führten zu einer völlig anderen Situation als die heutige. Nun über ein einzelnes Jahr ein so umfangreiches Buch zu schreiben, mag überraschen. Doch am Ende stellt man erstaunt fest, dass eben 1923 ein ganz spezielles Jahr war. Mit sehr vielen Entwicklungen, vielen Ereignissen, die seitdem unverrückbar in unseren Geschichtsbüchern stehen. Aber auch viele Details, die vergessen sind, kommen hier wieder in den Fokus. Geschichtsbücher reduzieren gerne die Sicht auf die Vergangenheit auf wenige Zahlen, Daten und Fakten, wo doch genau die Feinheiten, die Rolle einzelner Menschen und manchmal sogar der Zufall das Bild rund machen. Es ist die große Stärke von Volker Ullrich, diese Vielschichtigkeit in einer immer sachlichen, extrem detaillierten und doch fesselnden Weise zu servieren.
Es hat zuweilen Versuche gegeben, das Jahr 2023 mit 1923 zu vergleichen. Was sich bei näherer Betrachtung als Unsinn herausstellt. Volker Ullrich, Autor des faszinierenden Buches über die letzte Woche des Dritten Reiches, hat nun ein Buch über genau dieses deutsche Schicksalsjahr 1923 geschrieben. Und macht deutlich, dass die politische, wirtschaftliche und soziale Lage vor einem Jahrhundert eine ganz andere war als nun im 21. Jahrhundert. Die Besetzung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes durch Frankreich, die Hyperinflation als Folge daraus, das Erstarken rechtsextremer Parteien, die gefährliche Instabilität der jungen Weimarer Republik, führten zu einer völlig anderen Situation als die heutige. Nun über ein einzelnes Jahr ein so umfangreiches Buch zu schreiben, mag überraschen. Doch am Ende stellt man erstaunt fest, dass eben 1923 ein ganz spezielles Jahr war. Mit sehr vielen Entwicklungen, vielen Ereignissen, die seitdem unverrückbar in unseren Geschichtsbüchern stehen. Aber auch viele Details, die vergessen sind, kommen hier wieder in den Fokus. Geschichtsbücher reduzieren gerne die Sicht auf die Vergangenheit auf wenige Zahlen, Daten und Fakten, wo doch genau die Feinheiten, die Rolle einzelner Menschen und manchmal sogar der Zufall das Bild rund machen. Es ist die große Stärke von Volker Ullrich, diese Vielschichtigkeit in einer immer sachlichen, extrem detaillierten und doch fesselnden Weise zu servieren.
Mit dem Lesen komme ich immer noch nicht so recht weiter. Noch immer beschäftigen mich Michael Maul und Bernhard Schrammek mit der Podcast-Serie «Die Bach-Kantate», die nun immerhin seit Ende 2020 wöchentlich in MDR Kultur läuft. Nun haben Besprechungen klassischer Musik nicht selten etwas Schweres und Kompliziertes. Maul und Schrammek schaffen es jedoch, die Musik, eben speziell die Kantaten Bachs, nicht nur verständlich und bildhaft zu beschreiben. Es macht auch einfach Spaß, den beiden Moderatoren zuzuhören, denn Witzchen und Lästereien kommen nicht zu kurz. Die Folge 121 über die Kantate "Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir" ist so ein Beispiel, wo Michael Maul und Bernhard Schrammek zeigen, wie man klassische Musik auch ohne großes Hintergrundwissen und dünkelhafte Art den Hörern nahe bringen kann.
Details zu Michael Maul und Bernhard Schrammek in MDR.DE
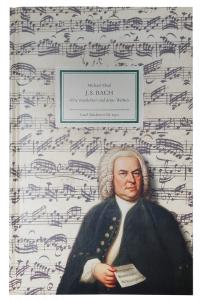 Die Geschichte ist aus dem Ruder gelaufen. Begonnen hatte sie mit diesem Buch von der Vorschlagsliste meines örtlichen Buchhändlers. Über Johann Sebastian Bach habe ich schon so Einiges gelesen, Michael Maul gilt jedoch als ausgesprochener Kenner dieses barocken Musikers. Seine Biografie spricht Bände. Kaum begonnen, stieß ich auf den Hinweis zu einer umfangreichen Podcast-Serie im Deutschlandfunk, «Universum JSB». Schon einige Jahre alt, aber Johann Sebastian ist ja schon lange nicht mehr unter uns. Also hörte ich einmal rein. Was zur Folge hatte, dass die 33 halbstündigen Beiträge mich eine ganze Zeit in Anspruch nahmen. Noch schlimmer, am Ende jeder Folge wollte ich die nächste kaum abwarten. So ging die Zeit ins Land, erst danach konnte ich zum Buch zurückkehren. Ich stieß erstmals auf Bach in einer Zeit, als solche Musik für Youngsters absolutes No-Go war. Walter Carlos bzw. Wendy brachte ihn mir nahe, wenn auch auf einem ungewöhnlichen Instrument. So erkannte ich dann, was Leute wie Keith Emerson oder Rick Wakeman als wirkliche musikalische Wurzeln hatten. Wen sie da oft in ihrer Musik zitierten. Im Grunde gehören das Buch sowie die darin verwiesene Spotify-Playlist als auch der Podcast zusammen, liefern ein unglaublich breites wie unterhaltsames Wissen über den großen Musiker des Barock. Ja, ich habe eine Menge Neues erfahren. Das Eine oder Andere sogar erst jetzt verstanden.
Die Geschichte ist aus dem Ruder gelaufen. Begonnen hatte sie mit diesem Buch von der Vorschlagsliste meines örtlichen Buchhändlers. Über Johann Sebastian Bach habe ich schon so Einiges gelesen, Michael Maul gilt jedoch als ausgesprochener Kenner dieses barocken Musikers. Seine Biografie spricht Bände. Kaum begonnen, stieß ich auf den Hinweis zu einer umfangreichen Podcast-Serie im Deutschlandfunk, «Universum JSB». Schon einige Jahre alt, aber Johann Sebastian ist ja schon lange nicht mehr unter uns. Also hörte ich einmal rein. Was zur Folge hatte, dass die 33 halbstündigen Beiträge mich eine ganze Zeit in Anspruch nahmen. Noch schlimmer, am Ende jeder Folge wollte ich die nächste kaum abwarten. So ging die Zeit ins Land, erst danach konnte ich zum Buch zurückkehren. Ich stieß erstmals auf Bach in einer Zeit, als solche Musik für Youngsters absolutes No-Go war. Walter Carlos bzw. Wendy brachte ihn mir nahe, wenn auch auf einem ungewöhnlichen Instrument. So erkannte ich dann, was Leute wie Keith Emerson oder Rick Wakeman als wirkliche musikalische Wurzeln hatten. Wen sie da oft in ihrer Musik zitierten. Im Grunde gehören das Buch sowie die darin verwiesene Spotify-Playlist als auch der Podcast zusammen, liefern ein unglaublich breites wie unterhaltsames Wissen über den großen Musiker des Barock. Ja, ich habe eine Menge Neues erfahren. Das Eine oder Andere sogar erst jetzt verstanden.