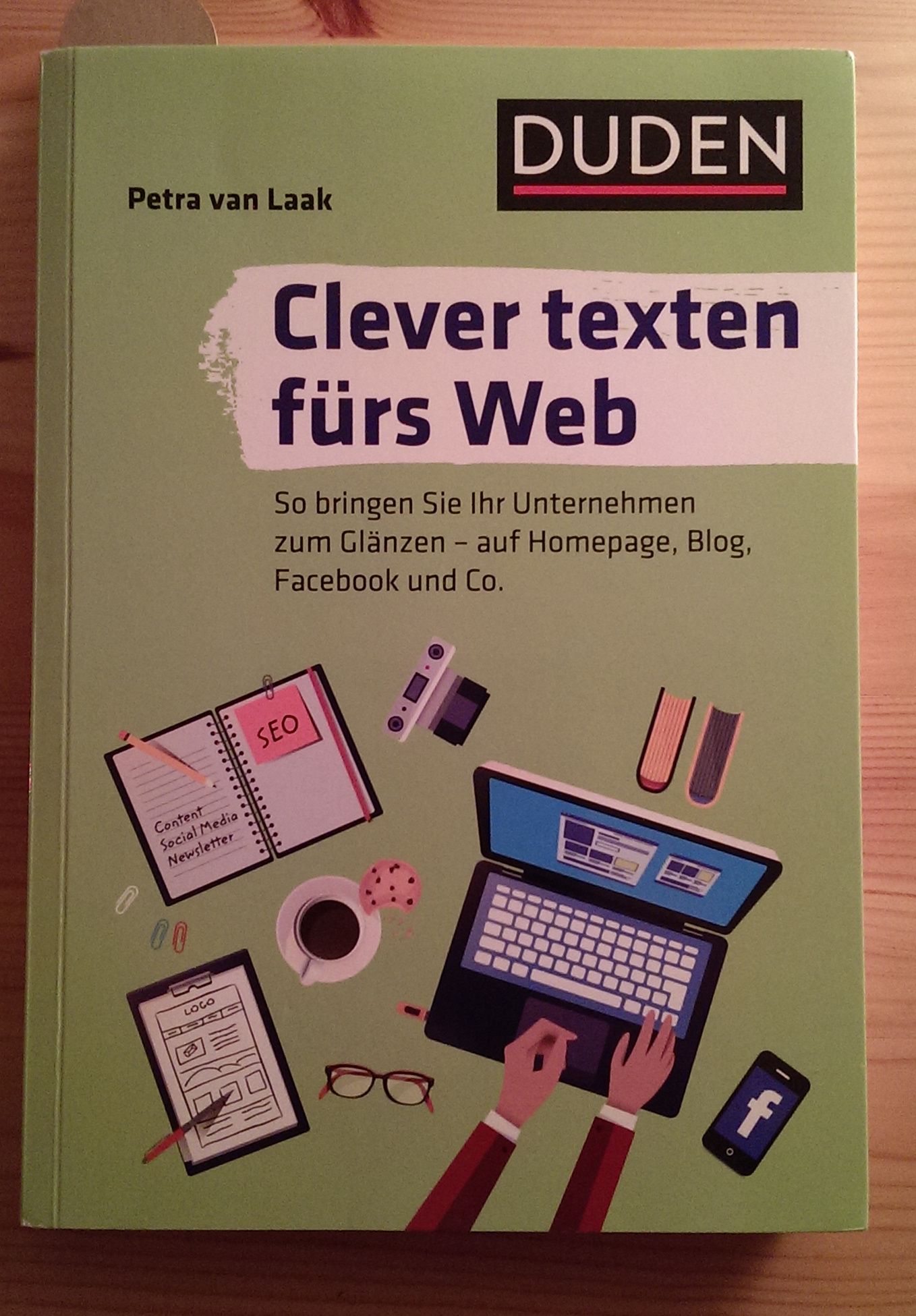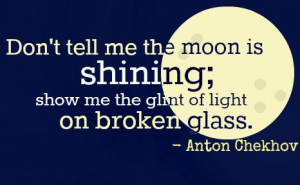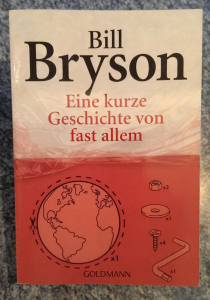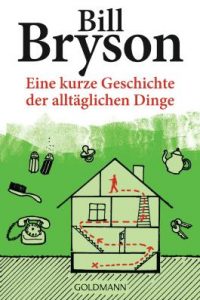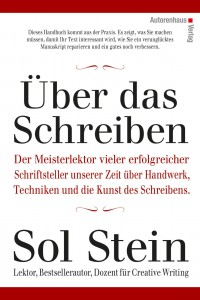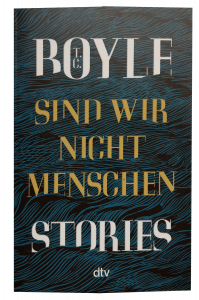 Wenn auch kein Fan von Romanen und Kurzgeschichten, habe ich die von Mark Twain, oder die Bücher von Juli Zeh oder gerade das von Ewald Frie sehr gerne gelesen. T. C. Boyle war mir nicht unbekannt. Über seinen Geschichtenband schreibt der Deutschlandfunk:
Wenn auch kein Fan von Romanen und Kurzgeschichten, habe ich die von Mark Twain, oder die Bücher von Juli Zeh oder gerade das von Ewald Frie sehr gerne gelesen. T. C. Boyle war mir nicht unbekannt. Über seinen Geschichtenband schreibt der Deutschlandfunk:
Eine große Leserschar hängt T.C. Boyle dabei regelrecht an den Lippen. Sie wird angesichts der enormen Produktivität erstaunlich selten enttäuscht. Im Gegensatz zu den groß ausgelegten Romanen, die gesellschaftliche Analysen und psychologische Entwürfe planvoll durchdeklinieren, ist Boyle in der kleinen Form der Short Story ganz bei sich als erzählender Zauberer oder verzaubernder Erzähler.
(Auch in dieser Rezension hat das Lektorat dramatisch versagt)
Also mal versuchen, als Abwechselung zwischen Sachbüchern über Geschichte, Politik oder Philosophie. Schon die erste Geschichte ließ mich ratlos zurück. Also versuchte ich die zweite. Nach der eher ertragenen dritten Geschichte beschloss ich, das Buch als Fall für die blaue Tonne einzuordnen. Die Geschichten in diesem Band haben weder eine Botschaft, noch eine Essenz, noch bieten sie irgendeine Form von Erkenntnis oder Verstehen. Das einzig Auffällige an den Geschichten war das aneinander Reihen von mehrwürdigen Sprachbildern („Die Rücklichter der Autos bluteten in die Nacht“) sowie weder logisch noch zeitlich passende Sprünge. Mir wurde nicht einmal klar, worum es in der jeweiligen Geschichte ging. Es sind Geschichten, die anscheinend nur um des Erzählens willen erzählt werden. Oder um Knete zu machen. Warum die Leserschar an Boyles Lippen hängt, ist mir in keiner Hinsicht verständlich. Aber es gibt ja bekanntlich nicht wenige Leute, die gerne Maggi-Tütensuppen essen. 13 verschwendete Euros.

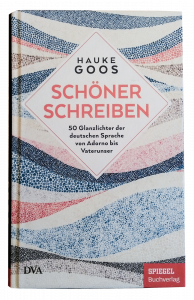

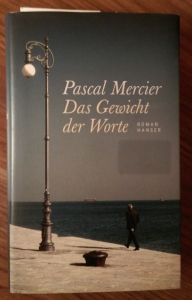
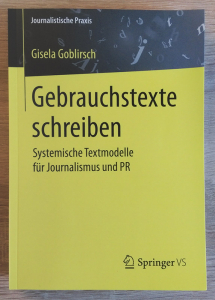
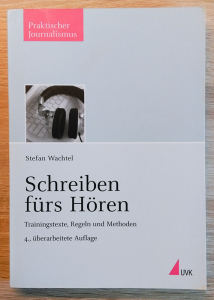
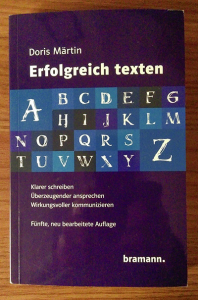
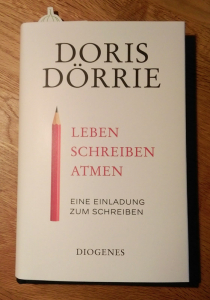


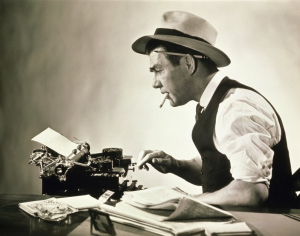
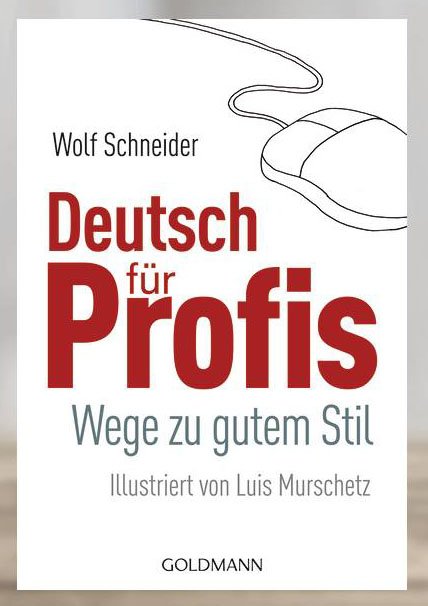
 Ich hatte in meiner seligen Jugend mal eine Freundin, die war gelernte Stenotypistin. Ein Beruf, der heute ausgestorben ist. Auf jeden Fall konnte sie auf der (elektrischen) Schreibmaschine so schnell schreiben wie ich zügig sprach. Das fand ich schon damals beeindruckend. Nun habe ich im Moment Mengen an Text zu produzieren, für einige Sendungen und Wortbeiträge. Nun bin ich ja allgemein vor nix fies, schon gar nicht vor dem technischen Fortschritt. Auch wenn ich niemals beim Radfahren das Smartphone in der Hand haben muss wie die Mädchen auf ihren uncoolen Hollandrädern, die wir damals nicht mal mit der Zange angepackt hätten. Geschweige denn gefahren. Was lag mit Windows 10 dann näher, als die eingebaute Spracherkennung Cortana zu nutzen und so die Texte schneller zu schreiben als mit meiner Vierfinger-Tippmethode? Versuch macht kluch.
Ich hatte in meiner seligen Jugend mal eine Freundin, die war gelernte Stenotypistin. Ein Beruf, der heute ausgestorben ist. Auf jeden Fall konnte sie auf der (elektrischen) Schreibmaschine so schnell schreiben wie ich zügig sprach. Das fand ich schon damals beeindruckend. Nun habe ich im Moment Mengen an Text zu produzieren, für einige Sendungen und Wortbeiträge. Nun bin ich ja allgemein vor nix fies, schon gar nicht vor dem technischen Fortschritt. Auch wenn ich niemals beim Radfahren das Smartphone in der Hand haben muss wie die Mädchen auf ihren uncoolen Hollandrädern, die wir damals nicht mal mit der Zange angepackt hätten. Geschweige denn gefahren. Was lag mit Windows 10 dann näher, als die eingebaute Spracherkennung Cortana zu nutzen und so die Texte schneller zu schreiben als mit meiner Vierfinger-Tippmethode? Versuch macht kluch.