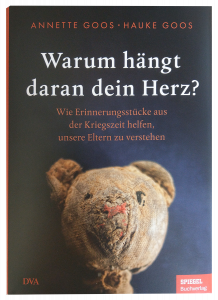Man sollte Wissenschaftlern, bevor sie Bücher schreiben, eine journalistische Grundausbildung verpassen. Sonst passiert nämlich das, was diesem Buch passiert: Zwei bzw. drei der fünf Kapitel des Buches sind für Leserinnen und Leser ohne den entsprechenden Hintergrund schlichtweg unverständlich. Das mag für Bücher auf dem freien Markt noch angehen, für Bücher in der Bundeszentrale für politische Bildung eher unangebracht. Dann zum Inhalt. Den Bedeutungsverlust der Sozialdemokratie kann man auf veränderte Gesellschaftsstrukturen zurückführen. Die klassische Zweiteilung in Arbeit und Kapital hat eben in einer Dienstleistungsgesellschaft kaum noch Berechtigung. Doch auch die konservativen Parteien, CDU/CSU, die Tories in Großbritannien oder die Democrazia Christiana in Italien haben Federn lassen müssen. Wenn sie nicht sogar auf Kleinparteien geschrumpft sind, wie in Frankreich. Wo doch gerade die Christdemokraten nicht nur in der Bundesrepublik viel dazu beigetragen haben, nach dem zweiten Weltkrieg einen liberalen und demokratischen Staat aufzubauen. Konservative Parteien sind auf dem absteigenden Ast, wenn auch in Deutschland nicht ganz so drastisch. Biebricher geht es zwar auch um die Union hier in der BRD, aber insgesamt um die Konservativen in Italien, Frankreich und Großbritannien, warum diese zum Teil in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Was Konservatismus eigentlich ist, beschreibt Biebricher schon in der Einleitung sehr plakativ: „Das Problem besteht darin, dass Konservative typischerweise nicht eigentlich das Bestehende zu verteidigen versuchen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht, sondern das Vergehende.“ Das klingt danach, dass es interessant werden könnte. Wird es aber nur zum Teil.
Man sollte Wissenschaftlern, bevor sie Bücher schreiben, eine journalistische Grundausbildung verpassen. Sonst passiert nämlich das, was diesem Buch passiert: Zwei bzw. drei der fünf Kapitel des Buches sind für Leserinnen und Leser ohne den entsprechenden Hintergrund schlichtweg unverständlich. Das mag für Bücher auf dem freien Markt noch angehen, für Bücher in der Bundeszentrale für politische Bildung eher unangebracht. Dann zum Inhalt. Den Bedeutungsverlust der Sozialdemokratie kann man auf veränderte Gesellschaftsstrukturen zurückführen. Die klassische Zweiteilung in Arbeit und Kapital hat eben in einer Dienstleistungsgesellschaft kaum noch Berechtigung. Doch auch die konservativen Parteien, CDU/CSU, die Tories in Großbritannien oder die Democrazia Christiana in Italien haben Federn lassen müssen. Wenn sie nicht sogar auf Kleinparteien geschrumpft sind, wie in Frankreich. Wo doch gerade die Christdemokraten nicht nur in der Bundesrepublik viel dazu beigetragen haben, nach dem zweiten Weltkrieg einen liberalen und demokratischen Staat aufzubauen. Konservative Parteien sind auf dem absteigenden Ast, wenn auch in Deutschland nicht ganz so drastisch. Biebricher geht es zwar auch um die Union hier in der BRD, aber insgesamt um die Konservativen in Italien, Frankreich und Großbritannien, warum diese zum Teil in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Was Konservatismus eigentlich ist, beschreibt Biebricher schon in der Einleitung sehr plakativ: „Das Problem besteht darin, dass Konservative typischerweise nicht eigentlich das Bestehende zu verteidigen versuchen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht, sondern das Vergehende.“ Das klingt danach, dass es interessant werden könnte. Wird es aber nur zum Teil.![]()
Ganzer Beitrag …
 Der Lebensborn, eine Einrichtung in der Nazi-Zeit, war mir aus verschiedenen Quellen schon geläufig. Aber wie es so ist, man kennt zwar einen Begriff, aber was dahinter steht, bleibt eher unklar. Was ich meinte, aber was der Lebensborn e. V. eben nicht war: So etwas wie eine arische Zuchtanstalt im Sinne des nationalsozialistischen Rassebegriffes. Der Lebensborn war eine Einrichtung von mehreren Häusern unter der Führung der SS, der Schutzstaffel. In deren Heimen brachten Frauen Kinder zur Welt, die entweder geheim gehalten werden sollten, deren Mütter unverheiratet waren oder die Väter nicht verfügbar. Untergetaucht, an der Front, bereits anderweitig verheiratet. Voraussetzung jedoch war, dass sowohl Mütter als auch Väter arisch, die Väter bevorzugt in der SS beteiligt oder anderweitig mit Beziehungen in der Politik. Waren Kinder behindert oder entsprachen nicht dem nationalsozialistischen Menschenbild, war der Heimaufenthalt zu Ende. Akzeptierte Kinder konnten auch an Pflegeeltern oder in die Adoption vermittelt werden. Dorothee Schmitz-Köster geht es jedoch primär nicht um die Lebensborn-Heime an sich, sondern um die Väter der Kinder. Wie bekamen die Väter die meistens unverheirateten Mütter in die Heime? Was waren die Motivationen und welche Typen von Vätern waren beteiligt? Welche Bürden tragen die ehemaligen Lebensborn-Kinder bis heute? So verschieden die Muster-Männer und Seitenspringer, flüchtenden Erzeuger und Ersatz-Väter auch waren, eins haben sie gemeinsam: Aus heutiger Sicht sind fast alle unbrauchbare Väter. Es spiegelt das Selbstbild der involvierten Väter, wie auch die rassistischen wie verlogenen NS-Geschlechterrollen. Dazu das Agieren einer Institution, deren kruder Utilitarismus den Interessen unterschiedlichster Männer entgegenkam.
Der Lebensborn, eine Einrichtung in der Nazi-Zeit, war mir aus verschiedenen Quellen schon geläufig. Aber wie es so ist, man kennt zwar einen Begriff, aber was dahinter steht, bleibt eher unklar. Was ich meinte, aber was der Lebensborn e. V. eben nicht war: So etwas wie eine arische Zuchtanstalt im Sinne des nationalsozialistischen Rassebegriffes. Der Lebensborn war eine Einrichtung von mehreren Häusern unter der Führung der SS, der Schutzstaffel. In deren Heimen brachten Frauen Kinder zur Welt, die entweder geheim gehalten werden sollten, deren Mütter unverheiratet waren oder die Väter nicht verfügbar. Untergetaucht, an der Front, bereits anderweitig verheiratet. Voraussetzung jedoch war, dass sowohl Mütter als auch Väter arisch, die Väter bevorzugt in der SS beteiligt oder anderweitig mit Beziehungen in der Politik. Waren Kinder behindert oder entsprachen nicht dem nationalsozialistischen Menschenbild, war der Heimaufenthalt zu Ende. Akzeptierte Kinder konnten auch an Pflegeeltern oder in die Adoption vermittelt werden. Dorothee Schmitz-Köster geht es jedoch primär nicht um die Lebensborn-Heime an sich, sondern um die Väter der Kinder. Wie bekamen die Väter die meistens unverheirateten Mütter in die Heime? Was waren die Motivationen und welche Typen von Vätern waren beteiligt? Welche Bürden tragen die ehemaligen Lebensborn-Kinder bis heute? So verschieden die Muster-Männer und Seitenspringer, flüchtenden Erzeuger und Ersatz-Väter auch waren, eins haben sie gemeinsam: Aus heutiger Sicht sind fast alle unbrauchbare Väter. Es spiegelt das Selbstbild der involvierten Väter, wie auch die rassistischen wie verlogenen NS-Geschlechterrollen. Dazu das Agieren einer Institution, deren kruder Utilitarismus den Interessen unterschiedlichster Männer entgegenkam.
 Als die Reisewelle die Fresswelle in den Siebzigern in Westdeutschland ablöste, galten die Deutschen als Reiseweltmeister. Das galt nicht nur für die Westdeutschen, sondern für die Ostdeutschen gleichermaßen. In den Achtzigern erreichte die Reiselust einen ersten Höhepunkt. Doch die Ostdeutschen reisten nicht weniger als die Westdeutschen, im Gegenteil, sie reisten eher mehr. Der Witz, der Reiseatlas der DDR sei das dünnste Buch der Welt, stimmt dabei ebenso wenig wie viele andere Stereotype der Wessis über die Ossis. Im Osten wurde nur anders gereist, die bevorzugten Reiseziele im Westen beschränkten sich zum großen Teil ja auch nur auf Österreich, Italien und Spanien. Während in den Achtzigern im Westen die kommerziellen Anbieter mit ihren Pauschalreisen das Reisen dominierten, waren im Osten der FDGB, die Betriebe, die FDJ und das ostdeutsche Reisebüro DER die wichtigsten Organisatoren für Reisen. Ostdeutsche mussten nicht auf Auslandsreisen verzichten. Beliebt waren besonders Ungarn und seine Hauptstadt Budapest, die einzige wirkliche Weltstadt des Ostblocks, mit westlichem Flair, internationalen Zeitungen und Schallplatten. Auch CSSR und Bulgarien standen als Ziele hoch im Kurs. Selbst Kuba, China oder Ägypten waren möglich, wenn man das nötige Budget zur Verfügung hatte. Doch der Individualtourismus blieb in der DDR immer wichtiger als FDGB-Reisen mit „Rotlichtbestrahlung“. Wie man die ständige Indoktrination mit Plakaten und Vorträgen in der DDR nannte. Deshalb war Camping geschätzt, wenn auch nicht so problemlos möglich wie im Westen. Überhaupt stimmte das Bild im Westen vom Urlaub der Ostdeutschen wenig bis gar nicht. Die verbrachten eben nicht ihre paar Urlaubstage in ihren Datschen.
Als die Reisewelle die Fresswelle in den Siebzigern in Westdeutschland ablöste, galten die Deutschen als Reiseweltmeister. Das galt nicht nur für die Westdeutschen, sondern für die Ostdeutschen gleichermaßen. In den Achtzigern erreichte die Reiselust einen ersten Höhepunkt. Doch die Ostdeutschen reisten nicht weniger als die Westdeutschen, im Gegenteil, sie reisten eher mehr. Der Witz, der Reiseatlas der DDR sei das dünnste Buch der Welt, stimmt dabei ebenso wenig wie viele andere Stereotype der Wessis über die Ossis. Im Osten wurde nur anders gereist, die bevorzugten Reiseziele im Westen beschränkten sich zum großen Teil ja auch nur auf Österreich, Italien und Spanien. Während in den Achtzigern im Westen die kommerziellen Anbieter mit ihren Pauschalreisen das Reisen dominierten, waren im Osten der FDGB, die Betriebe, die FDJ und das ostdeutsche Reisebüro DER die wichtigsten Organisatoren für Reisen. Ostdeutsche mussten nicht auf Auslandsreisen verzichten. Beliebt waren besonders Ungarn und seine Hauptstadt Budapest, die einzige wirkliche Weltstadt des Ostblocks, mit westlichem Flair, internationalen Zeitungen und Schallplatten. Auch CSSR und Bulgarien standen als Ziele hoch im Kurs. Selbst Kuba, China oder Ägypten waren möglich, wenn man das nötige Budget zur Verfügung hatte. Doch der Individualtourismus blieb in der DDR immer wichtiger als FDGB-Reisen mit „Rotlichtbestrahlung“. Wie man die ständige Indoktrination mit Plakaten und Vorträgen in der DDR nannte. Deshalb war Camping geschätzt, wenn auch nicht so problemlos möglich wie im Westen. Überhaupt stimmte das Bild im Westen vom Urlaub der Ostdeutschen wenig bis gar nicht. Die verbrachten eben nicht ihre paar Urlaubstage in ihren Datschen.
 Wäre dieses Buch ein Gericht in einem Restaurant, würde ich sagen: Schmeckt ganz merkwürdig, aber irgendwie lecker. Von Wolfgang Hegewald habe ich zum ersten Mal im Deutschlandfunk gehört, in der Sendung „Zwischentöne„. Was er da so von sich gab, klang zumindest interessant. Wolfgang Hegewald stammt aus der DDR. Dort wollte man seine Werke nicht drucken. Im Westen galt der Autor, dessen Ausreiseantrag 1983 bewilligt wurde, als magischer Realist. Sprachliche Genauigkeit ist ihm wichtig. So sagt er: „Mit Sprachverwahrlosung beginnt Weltverwahrlosung“. Aus der lange Liste an Büchern von ihm pickte ich mir dann eben «Tagessätze» heraus. Ob das Buch für ihn typisch ist, kann ich nicht sagen. Aber ich begann zu lesen. Zuerst hatte ich erhebliche Mühe zu begreifen, was Hegewald da eigentlich schrieb, worauf er hinaus wollte, was die Botschaft sein sollte. War das eine Geschichte oder ein Roman? Offensichtlich nicht. Obwohl Hegewald das Buch „Roman eines Jahres“ nennt. Nein, es ist kein Roman im herkömmlichen Sinne. Es ist eine Sammlung von Destillaten für jeden Monat des Jahres 2020. An der Monty Python ihre Freude hätten.
Wäre dieses Buch ein Gericht in einem Restaurant, würde ich sagen: Schmeckt ganz merkwürdig, aber irgendwie lecker. Von Wolfgang Hegewald habe ich zum ersten Mal im Deutschlandfunk gehört, in der Sendung „Zwischentöne„. Was er da so von sich gab, klang zumindest interessant. Wolfgang Hegewald stammt aus der DDR. Dort wollte man seine Werke nicht drucken. Im Westen galt der Autor, dessen Ausreiseantrag 1983 bewilligt wurde, als magischer Realist. Sprachliche Genauigkeit ist ihm wichtig. So sagt er: „Mit Sprachverwahrlosung beginnt Weltverwahrlosung“. Aus der lange Liste an Büchern von ihm pickte ich mir dann eben «Tagessätze» heraus. Ob das Buch für ihn typisch ist, kann ich nicht sagen. Aber ich begann zu lesen. Zuerst hatte ich erhebliche Mühe zu begreifen, was Hegewald da eigentlich schrieb, worauf er hinaus wollte, was die Botschaft sein sollte. War das eine Geschichte oder ein Roman? Offensichtlich nicht. Obwohl Hegewald das Buch „Roman eines Jahres“ nennt. Nein, es ist kein Roman im herkömmlichen Sinne. Es ist eine Sammlung von Destillaten für jeden Monat des Jahres 2020. An der Monty Python ihre Freude hätten.
 Mittlerweile gibt es eine erkleckliche Anzahl von Büchern über den Alltag in der DDR vor und kurz nach 1989. Mal mehr, mal weniger persönlich. Mit meinem ausgeprägten Interesse für die östlichen Bundesländer kam ich deshalb um dieses Buch nicht herum. Zentrum der Geschichte ist die 1986 in Wismar geborene Protagonistin Stine, der Autorin nicht unähnlich, aber nicht mit ihr identisch. Es ist aber keine Geschichte nur über den „Ost-West-Graben“, es ist genau besehen nicht mal eine nur typisch ostdeutsche Angelegenheit. Was Stine erlebt, ist die Kontinuität von Gewalt in ihrer Familie, in der Nazizeit, in der DDR oder während der Baseballschlägerjahre. Diese Gewalt entsteht nicht aus sich selbst, sondern aus Verstrickungen, in einen repressiven Staat, in Ideologien und auch in der eigenen Familie. Diese Verstrickungen ziehen sich über Generationen, mir fiel dabei der Bibelspruch ein, dass die Sünden der Väter an ihren Kindern bis ins dritte oder vierte Glied heimgesucht werden. Angefangen vom Großvater, der mit dem Nationalsozialismus anbandelte, bis zu den Eltern, für die die DDR das bessere, ja das einzig richtige Deutschland war. Da werden Mythen gesponnen, Erzählungen gepflegt, Anekdoten wiederholt, bis sich ihr Wahrheitsgehalt erübrigt. Da wird ge- und verschwiegen, werden Wahrheiten zusammen geschustert. Bis Stine beginnt nachzuforschen, besonders im Fall ihres Großvaters Paul. Erst allmählich wird Stine klar, warum ihr Lebensweg so verlief, wie er verlief. Warum sie nicht darum herum kam, den Kontakt zu ihrer Mutter abzubrechen.
Mittlerweile gibt es eine erkleckliche Anzahl von Büchern über den Alltag in der DDR vor und kurz nach 1989. Mal mehr, mal weniger persönlich. Mit meinem ausgeprägten Interesse für die östlichen Bundesländer kam ich deshalb um dieses Buch nicht herum. Zentrum der Geschichte ist die 1986 in Wismar geborene Protagonistin Stine, der Autorin nicht unähnlich, aber nicht mit ihr identisch. Es ist aber keine Geschichte nur über den „Ost-West-Graben“, es ist genau besehen nicht mal eine nur typisch ostdeutsche Angelegenheit. Was Stine erlebt, ist die Kontinuität von Gewalt in ihrer Familie, in der Nazizeit, in der DDR oder während der Baseballschlägerjahre. Diese Gewalt entsteht nicht aus sich selbst, sondern aus Verstrickungen, in einen repressiven Staat, in Ideologien und auch in der eigenen Familie. Diese Verstrickungen ziehen sich über Generationen, mir fiel dabei der Bibelspruch ein, dass die Sünden der Väter an ihren Kindern bis ins dritte oder vierte Glied heimgesucht werden. Angefangen vom Großvater, der mit dem Nationalsozialismus anbandelte, bis zu den Eltern, für die die DDR das bessere, ja das einzig richtige Deutschland war. Da werden Mythen gesponnen, Erzählungen gepflegt, Anekdoten wiederholt, bis sich ihr Wahrheitsgehalt erübrigt. Da wird ge- und verschwiegen, werden Wahrheiten zusammen geschustert. Bis Stine beginnt nachzuforschen, besonders im Fall ihres Großvaters Paul. Erst allmählich wird Stine klar, warum ihr Lebensweg so verlief, wie er verlief. Warum sie nicht darum herum kam, den Kontakt zu ihrer Mutter abzubrechen.
 Ab ca. 2016 fiel mir auf, dass in Großbritannien immer mehr mit Karte bezahlt wurde. Heute kann man dort ohne Kredit- oder Bank-Karte nicht mal mehr eine Kugel Eis kaufen oder eine öffentliche Toilette benutzen. Also gerade die Briten, die mit dem Brexit doch ihre Unabhängigkeit bewahren wollten, unterwerfen ihren kompletten Zahlungsverkehr Banken und Finanzunternehmen. Offizielle Zahlen sagen, der Bargeldgebrauch in Großbritannien habe in 2020 um 50% abgenommen. Meine Alltagserfahrungen in 2024 würden 80% sagen. Dabei hat Bargeld viele Vorteile. Es ist inklusiv, man muss kein Bankkonto haben, um bar zu bezahlen. Es ist anonym, Zahlungen können nicht nachverfolgt werden, Konsumverhalten nicht analysiert. Bargeld funktioniert auch bei Stromausfall, als US-Dollar oder Euro in vielen Ländern. Trotzdem nimmt auch in Deutschland das digitale Bezahlen zu. Nur alte weiße Männer tragen noch Stapel an Geldscheinen in ihrer Tasche herum. Der Trend zum "bargeldlosen" Zahlen wird von zwei Bereichen voran getrieben. Einmal von den Banken, Big Finance, weil Bargeld Infrastruktur benötigt, gerade in Form von Mitarbeitern. Die Banken möchten gerne weiter rationalisieren, Filialen schließen, Geldautomaten abbauen. Je mehr digital bezahlt wird, desto mehr vermeiden die Banken Kosten. Der Bereich Big Tech verdient hier an den Investitionen der Banken, dort an neuen Bezahlverfahren. Der neuste Hype sind dann noch Krypto-Währungen, die ein neues Geld sein wollen, unabhängig vom Staat und von der Finanzindustrie. Was ist daran eher religiöser Glaube? Können Bitcoin oder Dogecoin unser heutiges Geld ersetzen?
Ab ca. 2016 fiel mir auf, dass in Großbritannien immer mehr mit Karte bezahlt wurde. Heute kann man dort ohne Kredit- oder Bank-Karte nicht mal mehr eine Kugel Eis kaufen oder eine öffentliche Toilette benutzen. Also gerade die Briten, die mit dem Brexit doch ihre Unabhängigkeit bewahren wollten, unterwerfen ihren kompletten Zahlungsverkehr Banken und Finanzunternehmen. Offizielle Zahlen sagen, der Bargeldgebrauch in Großbritannien habe in 2020 um 50% abgenommen. Meine Alltagserfahrungen in 2024 würden 80% sagen. Dabei hat Bargeld viele Vorteile. Es ist inklusiv, man muss kein Bankkonto haben, um bar zu bezahlen. Es ist anonym, Zahlungen können nicht nachverfolgt werden, Konsumverhalten nicht analysiert. Bargeld funktioniert auch bei Stromausfall, als US-Dollar oder Euro in vielen Ländern. Trotzdem nimmt auch in Deutschland das digitale Bezahlen zu. Nur alte weiße Männer tragen noch Stapel an Geldscheinen in ihrer Tasche herum. Der Trend zum "bargeldlosen" Zahlen wird von zwei Bereichen voran getrieben. Einmal von den Banken, Big Finance, weil Bargeld Infrastruktur benötigt, gerade in Form von Mitarbeitern. Die Banken möchten gerne weiter rationalisieren, Filialen schließen, Geldautomaten abbauen. Je mehr digital bezahlt wird, desto mehr vermeiden die Banken Kosten. Der Bereich Big Tech verdient hier an den Investitionen der Banken, dort an neuen Bezahlverfahren. Der neuste Hype sind dann noch Krypto-Währungen, die ein neues Geld sein wollen, unabhängig vom Staat und von der Finanzindustrie. Was ist daran eher religiöser Glaube? Können Bitcoin oder Dogecoin unser heutiges Geld ersetzen?
 Die Geschichte Polens ist mehr als wechselhaft. Ein Spielball zwischen Russland und dem deutschen Reich, mal gar nicht mehr eigener Staat, sondern mit einem baltischen Staat verbunden. Bis 1918 existierte Polen nicht einmal mehr als eigene Nation. Und doch prägten die Deutschen auch nach 1918 die Gebiete im Westen. Als das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg verlor, kam es zur Westverschiebung Polens. Ab 1944 wurden die polnischen Bewohner im sowjetisch besetzten Ostpolen gezwungen, in die so genannten „wiedergewonnenen Gebiete“ umzusiedeln, die vorher unter anderem als Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien und Danzig zum Deutschen Reich gehört hatten. Die ursprünglich dort ansässige deutsche Bevölkerung floh oder wurde vertrieben. Mitnehmen durften sie höchstens einen Koffer oder einen Rucksack, zurück blieben Häuser, Höfe, Möbel und alltägliche Dinge wie Teller und Tassen. Die neuen polnischen Bewohner übernahmen das Zurückgelassene, plünderten und stahlen, oder zogen gleich selbst in die verlassenen Häuser ein. Selbst beinahe mittellos, sind so bis heute die Überreste deutschen Lebens in West- und Nordpolen zu finden. So entstanden gleich zwei Geschichten, die zeigen, wie Biografien und Dinge über Zeiträume, Landesgrenzen und Generationen hinweg bis heute miteinander verwoben sind. Wie das Vergangene und Verlorene bis ins Heute Bedeutung hat. Wenn man das Verhältnis von Polen und Deutschen in der jüngeren Geschichte verstehen will, hilft dieses Buch ungemein. Noch mehr, weckt es Interesse an dieser eher unbekannten Geschichte Europas. Viel Geschichte, viele Geschichten, die nachdenklich machen.
Die Geschichte Polens ist mehr als wechselhaft. Ein Spielball zwischen Russland und dem deutschen Reich, mal gar nicht mehr eigener Staat, sondern mit einem baltischen Staat verbunden. Bis 1918 existierte Polen nicht einmal mehr als eigene Nation. Und doch prägten die Deutschen auch nach 1918 die Gebiete im Westen. Als das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg verlor, kam es zur Westverschiebung Polens. Ab 1944 wurden die polnischen Bewohner im sowjetisch besetzten Ostpolen gezwungen, in die so genannten „wiedergewonnenen Gebiete“ umzusiedeln, die vorher unter anderem als Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien und Danzig zum Deutschen Reich gehört hatten. Die ursprünglich dort ansässige deutsche Bevölkerung floh oder wurde vertrieben. Mitnehmen durften sie höchstens einen Koffer oder einen Rucksack, zurück blieben Häuser, Höfe, Möbel und alltägliche Dinge wie Teller und Tassen. Die neuen polnischen Bewohner übernahmen das Zurückgelassene, plünderten und stahlen, oder zogen gleich selbst in die verlassenen Häuser ein. Selbst beinahe mittellos, sind so bis heute die Überreste deutschen Lebens in West- und Nordpolen zu finden. So entstanden gleich zwei Geschichten, die zeigen, wie Biografien und Dinge über Zeiträume, Landesgrenzen und Generationen hinweg bis heute miteinander verwoben sind. Wie das Vergangene und Verlorene bis ins Heute Bedeutung hat. Wenn man das Verhältnis von Polen und Deutschen in der jüngeren Geschichte verstehen will, hilft dieses Buch ungemein. Noch mehr, weckt es Interesse an dieser eher unbekannten Geschichte Europas. Viel Geschichte, viele Geschichten, die nachdenklich machen.
 Ist mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass ich ein Buch beginne und nach den ersten Artikeln wieder aufhöre. Hier aber nicht, weil etwa der Text einfach schlecht oder uninteressant ist. Sondern weil ich schlichtweg wenig verstehe, worum es geht. Aaron Sahr ist der Herausgeber des Buches, enthalten sind verschiedene Beiträge zur Geldpolitik. Nur ist das Buch für angehende oder fertige Wirtschaftswissenschaftler gedacht. Als Laie hat man jede Menge Fragezeichen im Kopf. Die Beiträge setzen nämlich ein schon erhebliches Wissen über Wirtschaft voraus, über das ich leider nicht verfüge. Kurz vor dem Zuklappen las ich noch in den Beitrag von Lukas Haffert hinein, über die Rolle von 1923 als Trauma. Wie die Hyperinflation dieser Jahre bis heute nachwirkt, jedoch verschiedene Themen und die Wirtschaftskrise von 1929 damit vermischt werden.
Ist mir jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass ich ein Buch beginne und nach den ersten Artikeln wieder aufhöre. Hier aber nicht, weil etwa der Text einfach schlecht oder uninteressant ist. Sondern weil ich schlichtweg wenig verstehe, worum es geht. Aaron Sahr ist der Herausgeber des Buches, enthalten sind verschiedene Beiträge zur Geldpolitik. Nur ist das Buch für angehende oder fertige Wirtschaftswissenschaftler gedacht. Als Laie hat man jede Menge Fragezeichen im Kopf. Die Beiträge setzen nämlich ein schon erhebliches Wissen über Wirtschaft voraus, über das ich leider nicht verfüge. Kurz vor dem Zuklappen las ich noch in den Beitrag von Lukas Haffert hinein, über die Rolle von 1923 als Trauma. Wie die Hyperinflation dieser Jahre bis heute nachwirkt, jedoch verschiedene Themen und die Wirtschaftskrise von 1929 damit vermischt werden.
 Als ich das bestellte Buch über Dinge, an denen das Herz hängt, beim Buchhändler meines Vertrauens abholte, lag tatsächlich das neue Werk von Uwe Wittstock in der Auslage. Als ich daran vorbei ging, wusste ich, dass ich es eh bald holen würde, denn Uwe Wittstock ist ein großer Erzähler über Geschichte. Februar 33 war mein erstes Buch von ihm, und ich habe es sehr zügig gelesen. Weil Wittstock über Historie schreibt wie in einem Roman, spannend, detailliert, mit wechselnden Bezügen und Orten. «Marseille 1940» ist da nicht anders. Das Jahr, in dem die deutsche Reichswehr quasi über Nacht Frankreich überfiel und einnahm, und viele Autoren und Künstler schnellstens das geliebte Paris verlassen mussten. Zuerst mit unklarem Ziel, Hauptsache weg, dann Richtung Süden, in den von den Deutschen nicht beherrschten Teil Frankreichs. Doch das Vichy-Regime, mit den Nazis kooperierend, machte es schwer, in Frankreich zu bleiben. Erzählt werden die Schicksale von mehr und weniger bekannten Menschen, Lion Feuchtwanger, Heinrich und Golo Mann, Hannah Arendt, Marc Chagall und viele mehr. Ausgerechnet ein junger Amerikaner nimmt sich vor, so viele der Verfolgten zu retten wie möglich.
Als ich das bestellte Buch über Dinge, an denen das Herz hängt, beim Buchhändler meines Vertrauens abholte, lag tatsächlich das neue Werk von Uwe Wittstock in der Auslage. Als ich daran vorbei ging, wusste ich, dass ich es eh bald holen würde, denn Uwe Wittstock ist ein großer Erzähler über Geschichte. Februar 33 war mein erstes Buch von ihm, und ich habe es sehr zügig gelesen. Weil Wittstock über Historie schreibt wie in einem Roman, spannend, detailliert, mit wechselnden Bezügen und Orten. «Marseille 1940» ist da nicht anders. Das Jahr, in dem die deutsche Reichswehr quasi über Nacht Frankreich überfiel und einnahm, und viele Autoren und Künstler schnellstens das geliebte Paris verlassen mussten. Zuerst mit unklarem Ziel, Hauptsache weg, dann Richtung Süden, in den von den Deutschen nicht beherrschten Teil Frankreichs. Doch das Vichy-Regime, mit den Nazis kooperierend, machte es schwer, in Frankreich zu bleiben. Erzählt werden die Schicksale von mehr und weniger bekannten Menschen, Lion Feuchtwanger, Heinrich und Golo Mann, Hannah Arendt, Marc Chagall und viele mehr. Ausgerechnet ein junger Amerikaner nimmt sich vor, so viele der Verfolgten zu retten wie möglich.
Der zweite Weltkrieg ist längst vorbei, seine Spuren und die Dinge, die in dieser Zeit eine Rolle spielten, sind noch da. Dinge wie ein Kleiderbügel, den die Mutter auf der Flucht dabei hatte, ein Trinkbecher, der das Sterben im Krieg verhinderte, oder eine Trillerpfeife und eine Trainingshose, die dem Vater gehörten, der aus dem Krieg nicht zurückkam. Aber auch der Ledermantel eines Nationalsozialisten, der heute als Bekleidung einer Vogelscheuche im Garten dient. Mit ihnen verbindet sich die Erinnerung an Zeiten voller Angst und Leid, für die die Menschen, die sie oft noch als Kind miterlebt haben, zuweilen keine Sprache finden. Es ist nicht nur die Sprachlosigkeit der Kriegskinder, sondern oft auch noch die der Kriegsenkel. Annette und Hauke Goos stellen 36 solcher Erinnerungsstücke vor und lassen ihre Besitzerinnen und Besitzer, darunter Prominente wie die Politiker Björn Engholm und Gerhard Baum, die Schauspielerin Marie-Luise Marjan oder den Autor Paul Maar, von den Dingen erzählen. Zurück geht die Idee für das Buch auf einen Artikel im SPIEGEL in 2019. Herausgekommen ist ein berührendes Buch zu einer Zeit, die weit zurück liegt, aber noch nicht vergangen ist.
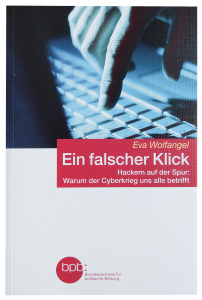 Ab 1976 habe ich in Dortmund Informatik studiert, war mehrere Jahre lang Software-Entwickler, bevor ich erst ins Marketing, später in die PR und die schreibende Zunft wechselte. Daher weiß ich, wie Viren, Würmer und Trojaner funktionieren, wie sie Systeme befallen und was dann passiert. Denn irgendwie gehört ein Teil meines Herzens immer noch der IT. In diesem Buch geht es aber nicht primär um technische Details, obwohl die dann doch zur Sprache kommen. Man muss zum Lesen des Buches keine Informatik studiert haben. Eva Wolfangel gilt als Technikjournalistin, die Hintergründe und Wirkungen der digitalen Welt ohne Abtauchen in Spezialwissen behandelt. Es geht nämlich nicht um informationstechnische Einzelheiten, sondern was sich hinter Begriffen wie Cyberwar und hybrider Kriegsführung verbirgt. Und genau an dieser Stelle muss ich zugeben, dass da bei mir eine größere Lücke bestand. Zwar hören oder lesen wir immer wieder Nachrichten, die Russen hätten mal wieder die Technik ukrainischer Kraftwerke gestört, oder dass Nordkorea in die Systeme amerikanischer Rechenzentren eingedrungen sei. Das ist aber nur die ganz dünne Oberfläche, was da hinter den Kulissen wirklich passiert. Wenn zum Beispiel eine russische Schadsoftware einen der größten Logistikbetriebe der Welt für Wochen lahm legt, und keiner mehr weiß, wo welche der 14.000 Container sind und was darin ist. Da kommt Krimistimmung auf.
Ab 1976 habe ich in Dortmund Informatik studiert, war mehrere Jahre lang Software-Entwickler, bevor ich erst ins Marketing, später in die PR und die schreibende Zunft wechselte. Daher weiß ich, wie Viren, Würmer und Trojaner funktionieren, wie sie Systeme befallen und was dann passiert. Denn irgendwie gehört ein Teil meines Herzens immer noch der IT. In diesem Buch geht es aber nicht primär um technische Details, obwohl die dann doch zur Sprache kommen. Man muss zum Lesen des Buches keine Informatik studiert haben. Eva Wolfangel gilt als Technikjournalistin, die Hintergründe und Wirkungen der digitalen Welt ohne Abtauchen in Spezialwissen behandelt. Es geht nämlich nicht um informationstechnische Einzelheiten, sondern was sich hinter Begriffen wie Cyberwar und hybrider Kriegsführung verbirgt. Und genau an dieser Stelle muss ich zugeben, dass da bei mir eine größere Lücke bestand. Zwar hören oder lesen wir immer wieder Nachrichten, die Russen hätten mal wieder die Technik ukrainischer Kraftwerke gestört, oder dass Nordkorea in die Systeme amerikanischer Rechenzentren eingedrungen sei. Das ist aber nur die ganz dünne Oberfläche, was da hinter den Kulissen wirklich passiert. Wenn zum Beispiel eine russische Schadsoftware einen der größten Logistikbetriebe der Welt für Wochen lahm legt, und keiner mehr weiß, wo welche der 14.000 Container sind und was darin ist. Da kommt Krimistimmung auf.
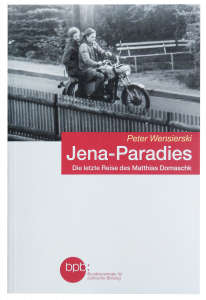 In den letzten Jahren habe ich viele Orte in Sachsen kennengelernt. Von Dresden und Leipzig bis zu Schneeberg, Lichtenstein, Oelsnitz, Augustusburg und viele andere. Nur eines war mir bisher unbekannt: wie das Leben in der DDR in den Achtziger Jahren aussah. Natürlich hatte man etwas über die Stasi gehört, über die Repressalien, über die persönliche Unfreiheit im real existierenden Sozialismus. Das kann sich mit diesem Buch ändern. Es erzählt die Geschichte des Matthias Domaschk, ein Jugendlicher wie aus heutiger Sicht wie tausende andere Youngsters auch. Mit vielen Flausen im Kopf, mit seinen eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, Politik und Leben, die er mit seinen Eltern und deren Zeitgenossen kaum teilt. Schon gar nicht mit einer repressiven Staatsmacht, für die schon das Lesen vieler Bücher über Politik und Philosophie ein Verbrechen darstellt. Wo der Begriff des "Gedankenverbrechens" die Utopien eines George Orwells wahr werden lässt. Doch eine Reise zu Freundinnen und Freunden nach Berlin, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tritt eine Lawine von Ereignissen los, die ihre Gewalt am Ende zur Katastrophe anwachsen lässt. Ein Buch wie ein Roman, das in Wirklichkeit eine Dokumentation ist. Und das uns Wessis begreifbar macht, was es hieß, in diesem Unrechtsstaat zu leben.
In den letzten Jahren habe ich viele Orte in Sachsen kennengelernt. Von Dresden und Leipzig bis zu Schneeberg, Lichtenstein, Oelsnitz, Augustusburg und viele andere. Nur eines war mir bisher unbekannt: wie das Leben in der DDR in den Achtziger Jahren aussah. Natürlich hatte man etwas über die Stasi gehört, über die Repressalien, über die persönliche Unfreiheit im real existierenden Sozialismus. Das kann sich mit diesem Buch ändern. Es erzählt die Geschichte des Matthias Domaschk, ein Jugendlicher wie aus heutiger Sicht wie tausende andere Youngsters auch. Mit vielen Flausen im Kopf, mit seinen eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, Politik und Leben, die er mit seinen Eltern und deren Zeitgenossen kaum teilt. Schon gar nicht mit einer repressiven Staatsmacht, für die schon das Lesen vieler Bücher über Politik und Philosophie ein Verbrechen darstellt. Wo der Begriff des "Gedankenverbrechens" die Utopien eines George Orwells wahr werden lässt. Doch eine Reise zu Freundinnen und Freunden nach Berlin, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tritt eine Lawine von Ereignissen los, die ihre Gewalt am Ende zur Katastrophe anwachsen lässt. Ein Buch wie ein Roman, das in Wirklichkeit eine Dokumentation ist. Und das uns Wessis begreifbar macht, was es hieß, in diesem Unrechtsstaat zu leben.
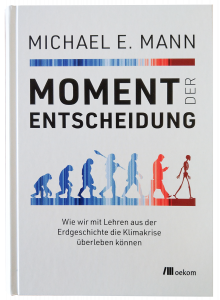 Klimawandel hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Im Extrem sogar in der Hinsicht, dass die Erde nach ihrer Entstehung zwei Milliarden Jahre lang nicht einmal eine Sauerstoff-Atmosphäre hatte. Doch nicht alle Klimaveränderungen waren naturgegeben. Mit dem Auftreten von Leben gab es nun nicht nur eine Wechselwirkung zwischen Erde und Leben, sondern auch umgekehrt. Immer aber über Jahrtausende. Nun gibt es sogar Anhaltspunkte, dass schon vor 6.000 Jahren der Mensch das Klima beeinflusste, als er weiträumig Landschaft gestaltete und Wälder abholzte. Doch so gravierend wie in den letzten zweihundert Jahren hat sich das Klima noch nie verändert. Michael E. Mann führt durch die Erdgeschichte, wie extrem und häufig sich das Klima auf diesem Planeten verändert hat, es gab sogar Phasen, in denen die Erde deutlich wärmer war als heute. Genauso wie Zeiten, in denen die Erde eine Schnee- und Eiskugel war. Fast alle Entwicklungen des Klimas lassen sich heute sehr gut erklären. Leider auch der aktuelle Klimawandel. Es geht also um die heutigen Klimaveränderungen, die der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energiequellen herbei führt. Zugleich hilft das Verstehen bisheriger Klimaveränderungen, wie wir aus der jetzigen Bredouille wieder heraus kommen. Oder wenigstens das Schlimmste verhindern.
Klimawandel hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Im Extrem sogar in der Hinsicht, dass die Erde nach ihrer Entstehung zwei Milliarden Jahre lang nicht einmal eine Sauerstoff-Atmosphäre hatte. Doch nicht alle Klimaveränderungen waren naturgegeben. Mit dem Auftreten von Leben gab es nun nicht nur eine Wechselwirkung zwischen Erde und Leben, sondern auch umgekehrt. Immer aber über Jahrtausende. Nun gibt es sogar Anhaltspunkte, dass schon vor 6.000 Jahren der Mensch das Klima beeinflusste, als er weiträumig Landschaft gestaltete und Wälder abholzte. Doch so gravierend wie in den letzten zweihundert Jahren hat sich das Klima noch nie verändert. Michael E. Mann führt durch die Erdgeschichte, wie extrem und häufig sich das Klima auf diesem Planeten verändert hat, es gab sogar Phasen, in denen die Erde deutlich wärmer war als heute. Genauso wie Zeiten, in denen die Erde eine Schnee- und Eiskugel war. Fast alle Entwicklungen des Klimas lassen sich heute sehr gut erklären. Leider auch der aktuelle Klimawandel. Es geht also um die heutigen Klimaveränderungen, die der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energiequellen herbei führt. Zugleich hilft das Verstehen bisheriger Klimaveränderungen, wie wir aus der jetzigen Bredouille wieder heraus kommen. Oder wenigstens das Schlimmste verhindern.
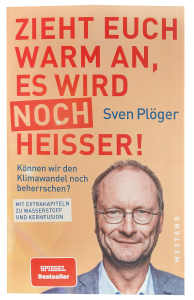 Zuerst dachte ich, dass Sven Plöger einen weiteren Band zum Thema vorgelegt hätte. Tatsächlich ist es eine Neuauflage und Erweiterung seines Buches aus 2020. Daher gilt die Rezension aus diesem Jahr unverändert weiter. Plöger hat das Buch erheblich erweitert und aktualisiert, sowohl hinsichtlich Zahlen und Daten, neuen Erkenntnissen über den Klimawandel, zwei ganz neue Kapitel sind hinzu gekommen, wie auf dem Einband zu lesen. Was sich nicht geändert hat: Welche drastischen Folgen der Klimawandel für die Welt und die Menschen nach sich zieht, wie wenig wir inzwischen getan haben, um ihn aufzuhalten. Wohltuend noch immer die nüchterne, anschauliche und faktenbasierte Art zu schreiben. Fast alle Kapitel sind erheblich umfangreicher geworden, wodurch diese Ausgabe deutlich dicker geworden ist als die erste. Die vielleicht wichtigste Botschaft Plögers ist die, dass Klima, Wetter und die Welt insgesamt ein so komplexes und unvorhersagbares System sind, dass es oft schwer fällt zu sehen, was wann und warum geschieht. Warum Winde im Westen der USA das Wetter in Indien beeinflussen. Dass die langanhaltenden Tiefs über uns, mit Unwettern und Wetteranomalien, kein Zufall sind und wie das mit den Jetstreams zusammen hängt. Es ist kein wissenschaftliches Buch, aber perfekt für alle Leute, die verstehen wollen, was Wetter und Klima sind und wie sie zusammen gehen. Auch wenn "nur" eine neue Ausgabe, ein beeindruckendes, wenn nicht beängstigendes Buch.
Zuerst dachte ich, dass Sven Plöger einen weiteren Band zum Thema vorgelegt hätte. Tatsächlich ist es eine Neuauflage und Erweiterung seines Buches aus 2020. Daher gilt die Rezension aus diesem Jahr unverändert weiter. Plöger hat das Buch erheblich erweitert und aktualisiert, sowohl hinsichtlich Zahlen und Daten, neuen Erkenntnissen über den Klimawandel, zwei ganz neue Kapitel sind hinzu gekommen, wie auf dem Einband zu lesen. Was sich nicht geändert hat: Welche drastischen Folgen der Klimawandel für die Welt und die Menschen nach sich zieht, wie wenig wir inzwischen getan haben, um ihn aufzuhalten. Wohltuend noch immer die nüchterne, anschauliche und faktenbasierte Art zu schreiben. Fast alle Kapitel sind erheblich umfangreicher geworden, wodurch diese Ausgabe deutlich dicker geworden ist als die erste. Die vielleicht wichtigste Botschaft Plögers ist die, dass Klima, Wetter und die Welt insgesamt ein so komplexes und unvorhersagbares System sind, dass es oft schwer fällt zu sehen, was wann und warum geschieht. Warum Winde im Westen der USA das Wetter in Indien beeinflussen. Dass die langanhaltenden Tiefs über uns, mit Unwettern und Wetteranomalien, kein Zufall sind und wie das mit den Jetstreams zusammen hängt. Es ist kein wissenschaftliches Buch, aber perfekt für alle Leute, die verstehen wollen, was Wetter und Klima sind und wie sie zusammen gehen. Auch wenn "nur" eine neue Ausgabe, ein beeindruckendes, wenn nicht beängstigendes Buch.
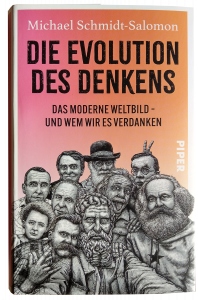 Die Bagger-Attacke auf das Telefonkabel unter dem Asphalt hatte eine längere Offline-Zeit zur Folge. Was ausgiebiges Lesen förderte. Es gibt also Nachholbedarf. Erstes Buch: Das neue Werk von Michael Schmidt-Salomon. Wenn man die pseudowissenschaftliche Esoterik und den baren Unsinn nicht nur in sozialen Medien betrachtet, fragt man sich, was aus den Erkenntnissen eines Einsteins, eines Darwins oder eines Karl Popper geworden ist. Denn diese Leute haben einmal dafür gesorgt, dass das Bild der Welt aus wissenschaftlicher Erkenntnis entstand. Michael Schmidt-Salomon vermutet, dass es einfach daran liegt, dass wir seit der Jahrhundertwende mit solchen Mengen an Informationen überschüttet werden, dass viele Leute den Überblick verlieren. Was eine Art kultureller Demenz bewirkt. In seinem Buch möchte er mit der Erinnerung an zehn Menschen daran erinnern, wie diese einen anderen Blick auf die Wirklichkeit geschaffen haben. Aber auch wie sie die Welt beeinflusst haben und was ihre zentralen Ideen waren. Er bezeichnet diese Leute, wie Albert Einstein, Marie Curie, Karl Marx oder Julian Huxley, als zehn Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild. Schmidt-Salomon geht noch einmal zu den Größen der Wissenschaft und Philosophie zurück. Schildert ihren Werdegang, ihre Persönlichkeit und welche Rolle sie in der heutigen Zeit noch spielen.
Die Bagger-Attacke auf das Telefonkabel unter dem Asphalt hatte eine längere Offline-Zeit zur Folge. Was ausgiebiges Lesen förderte. Es gibt also Nachholbedarf. Erstes Buch: Das neue Werk von Michael Schmidt-Salomon. Wenn man die pseudowissenschaftliche Esoterik und den baren Unsinn nicht nur in sozialen Medien betrachtet, fragt man sich, was aus den Erkenntnissen eines Einsteins, eines Darwins oder eines Karl Popper geworden ist. Denn diese Leute haben einmal dafür gesorgt, dass das Bild der Welt aus wissenschaftlicher Erkenntnis entstand. Michael Schmidt-Salomon vermutet, dass es einfach daran liegt, dass wir seit der Jahrhundertwende mit solchen Mengen an Informationen überschüttet werden, dass viele Leute den Überblick verlieren. Was eine Art kultureller Demenz bewirkt. In seinem Buch möchte er mit der Erinnerung an zehn Menschen daran erinnern, wie diese einen anderen Blick auf die Wirklichkeit geschaffen haben. Aber auch wie sie die Welt beeinflusst haben und was ihre zentralen Ideen waren. Er bezeichnet diese Leute, wie Albert Einstein, Marie Curie, Karl Marx oder Julian Huxley, als zehn Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild. Schmidt-Salomon geht noch einmal zu den Größen der Wissenschaft und Philosophie zurück. Schildert ihren Werdegang, ihre Persönlichkeit und welche Rolle sie in der heutigen Zeit noch spielen.
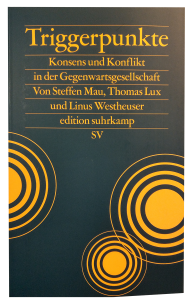 Liest man regelmäßig in den sozialen Medien, aber auch in etablierten Zeitschriften oder schaut man Nachrichten im Fernsehen, könnte man meinen, in unserem Land sei das große Hauen und Stechen ausgebrochen. Ob Migration und Einwanderung, Gendersternchen oder die Ehe für Lesben und Schwule, überall scheint der große Konflikt ausgebrochen. Man dürfe nichts mehr sagen und die Grünen würden eh alles verbieten. Aber stimmt das so überhaupt, dass es in Deutschland nur noch um Streit und extreme Meinungen geht? Der Soziologe Steffen Mau hat sich in einer groß angelegten Studie mit dieser Frage beschäftigt, sowohl in Form von Umfragen als auch in Arbeitsgruppen mit Leuten in mehreren Großstädten. Um die untersuchten Inhalte einzugrenzen und zu wirklich konkreten Aussagen zu kommen, hat er deshalb vier von ihm so genannte Arenen definiert. Die Oben-Unten-Arena, die Innen-Außen-Arena, die Wir-Sie-Arena und die Heute-Morgen-Arena. Während die erste Arena geradezu klassisch ist und es um Umverteilung und soziale Gerechtigkeit geht, sind die weiteren drei Arenen eher Themen der Neuzeit. Es geht im Wesentlichen um Zuwanderung und Migration, um Identität und Zugehörigkeit, zuletzt im Kern um Klimawandel und Ökologie. In allen vier Arenen sollen Ungleichheiten, Diskurse und Konflikte identifiziert werden. Daraus dann abgeleitet, wie gespalten unsere Gesellschaft nun wirklich ist. Die im Vordergrund stehenden Triggerpunkte kommen erst im zweiten Kapitel auf den Tisch. Am Ende mit einem eher wenig überraschenden Ergebnis.
Liest man regelmäßig in den sozialen Medien, aber auch in etablierten Zeitschriften oder schaut man Nachrichten im Fernsehen, könnte man meinen, in unserem Land sei das große Hauen und Stechen ausgebrochen. Ob Migration und Einwanderung, Gendersternchen oder die Ehe für Lesben und Schwule, überall scheint der große Konflikt ausgebrochen. Man dürfe nichts mehr sagen und die Grünen würden eh alles verbieten. Aber stimmt das so überhaupt, dass es in Deutschland nur noch um Streit und extreme Meinungen geht? Der Soziologe Steffen Mau hat sich in einer groß angelegten Studie mit dieser Frage beschäftigt, sowohl in Form von Umfragen als auch in Arbeitsgruppen mit Leuten in mehreren Großstädten. Um die untersuchten Inhalte einzugrenzen und zu wirklich konkreten Aussagen zu kommen, hat er deshalb vier von ihm so genannte Arenen definiert. Die Oben-Unten-Arena, die Innen-Außen-Arena, die Wir-Sie-Arena und die Heute-Morgen-Arena. Während die erste Arena geradezu klassisch ist und es um Umverteilung und soziale Gerechtigkeit geht, sind die weiteren drei Arenen eher Themen der Neuzeit. Es geht im Wesentlichen um Zuwanderung und Migration, um Identität und Zugehörigkeit, zuletzt im Kern um Klimawandel und Ökologie. In allen vier Arenen sollen Ungleichheiten, Diskurse und Konflikte identifiziert werden. Daraus dann abgeleitet, wie gespalten unsere Gesellschaft nun wirklich ist. Die im Vordergrund stehenden Triggerpunkte kommen erst im zweiten Kapitel auf den Tisch. Am Ende mit einem eher wenig überraschenden Ergebnis.
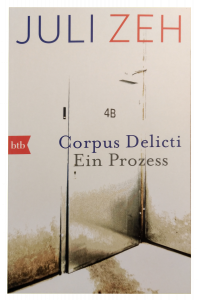 Durch ihren Roman «Über Menschen» war ich zum ersten Mal mit der Autorin Juli Zeh in Kontakt gekommen. Nach einigen schwergewichtigen Sachbüchern konnte ein Roman zwischendurch mal eine willkommene Abwechslung sein, weil mir mein erstes Buch von Juli Zeh doch sehr positiv in Erinnerung geblieben war. Erstmals 2009 erschienen, wird «Corpus Delicti» als eine Art Science Fiction beschrieben. Was meinem allgemeinen Buchgeschmack entgegen kommt. Daran stimmt zwar, dass die Geschichte in der Zukunft spielt, wenn auch nicht in einer fernen Zukunft, doch mit Science Fiktion hat der Roman wenig zu tun. Keine Raumschiffe, keine Außerirdischen und gebeamt wird auch nicht. Es geht um eine politische und gesellschaftliche Zukunft, nicht mehr ganz so fern, irgendwo im 21. Jahrhundert. Ein Deutschland, in dem die höchsten Güter Gesundheit, Hygiene und langes Leben sind. In diesem Deutschland verliert die Protagonistin, Mia Holl, ihren Bruder, der nach falscher Anklage wegen Vergewaltigung und Mord Suizid begeht. Sie glaubt nicht an seine Schuld, macht sich auf die Suche und löst eine politische Lawine aus, die sie am Ende beinahe mit ins Verderben reißt.
Durch ihren Roman «Über Menschen» war ich zum ersten Mal mit der Autorin Juli Zeh in Kontakt gekommen. Nach einigen schwergewichtigen Sachbüchern konnte ein Roman zwischendurch mal eine willkommene Abwechslung sein, weil mir mein erstes Buch von Juli Zeh doch sehr positiv in Erinnerung geblieben war. Erstmals 2009 erschienen, wird «Corpus Delicti» als eine Art Science Fiction beschrieben. Was meinem allgemeinen Buchgeschmack entgegen kommt. Daran stimmt zwar, dass die Geschichte in der Zukunft spielt, wenn auch nicht in einer fernen Zukunft, doch mit Science Fiktion hat der Roman wenig zu tun. Keine Raumschiffe, keine Außerirdischen und gebeamt wird auch nicht. Es geht um eine politische und gesellschaftliche Zukunft, nicht mehr ganz so fern, irgendwo im 21. Jahrhundert. Ein Deutschland, in dem die höchsten Güter Gesundheit, Hygiene und langes Leben sind. In diesem Deutschland verliert die Protagonistin, Mia Holl, ihren Bruder, der nach falscher Anklage wegen Vergewaltigung und Mord Suizid begeht. Sie glaubt nicht an seine Schuld, macht sich auf die Suche und löst eine politische Lawine aus, die sie am Ende beinahe mit ins Verderben reißt.
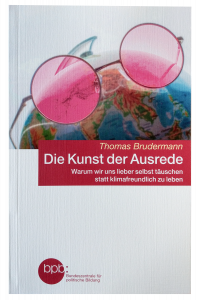 Auf einer Familienfreier kam irgendwann das Thema Klimawandel, Kohlendioxid-Emissionen und Autos. Ein Verwandter meinte dazu im Brustton der Überzeugung: "So lange die Chinesen nix machen, mache ich auch nix!". Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen, dass er einen sehr fleischzentrierten Ernährungsstil pflegt, was an seinem enormen Bauchumfang abzulesen ist. Doch es gibt noch mehr Ausreden. Es sei schon zu spät, der Einzelne könne doch nichts machen, die Erde hätte schon immer Warm- und Kaltzeiten gehabt, oder man sei doch schon klimafreundlich, da komme es mal auf einen einzelnen Flug in den Urlaub doch nicht an. Thomas Brudermann beschäftigt sich mit den Ausredevarianten im Wesentlichen aus Sicht der Verhaltensökonomie und Umweltpsychologie, zwei noch recht jungen Wissenschaftsgebieten. Speziell geht es darum, welche inneren Vorgänge hinter den Ausreden stehen, was die Fakten sind und wie man diesen Ausreden begegnet. In vielen Fällen sind Bequemlichkeit, Verlustängste, Status und schlichtweg Unwissenheit die Hintergründe. Doch es gibt auch einige andere Gründe zum Leugnen des Klimawandels, damit hat mal wieder der Neoliberalismus und der unerschütterliche Glaube an die Märkte zu tun.
Auf einer Familienfreier kam irgendwann das Thema Klimawandel, Kohlendioxid-Emissionen und Autos. Ein Verwandter meinte dazu im Brustton der Überzeugung: "So lange die Chinesen nix machen, mache ich auch nix!". Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen, dass er einen sehr fleischzentrierten Ernährungsstil pflegt, was an seinem enormen Bauchumfang abzulesen ist. Doch es gibt noch mehr Ausreden. Es sei schon zu spät, der Einzelne könne doch nichts machen, die Erde hätte schon immer Warm- und Kaltzeiten gehabt, oder man sei doch schon klimafreundlich, da komme es mal auf einen einzelnen Flug in den Urlaub doch nicht an. Thomas Brudermann beschäftigt sich mit den Ausredevarianten im Wesentlichen aus Sicht der Verhaltensökonomie und Umweltpsychologie, zwei noch recht jungen Wissenschaftsgebieten. Speziell geht es darum, welche inneren Vorgänge hinter den Ausreden stehen, was die Fakten sind und wie man diesen Ausreden begegnet. In vielen Fällen sind Bequemlichkeit, Verlustängste, Status und schlichtweg Unwissenheit die Hintergründe. Doch es gibt auch einige andere Gründe zum Leugnen des Klimawandels, damit hat mal wieder der Neoliberalismus und der unerschütterliche Glaube an die Märkte zu tun.
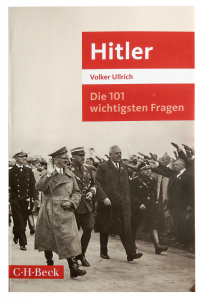 Volker Ullrich mausert sich langsam zu einem meiner liebsten Autoren in Sachen Geschichte. Er schreibt auf den Punkt, sehr lesbar, geradezu unterhaltsam und mit vielen Details. Vorher waren schon «1923» und «Acht Tage im Mai» dran. Im Vergleich zu den früheren Werken ist «Hitler» eher ein schmales Büchlein. Ich habe es trotzdem bestellt, obwohl ich meinte, es brächte jetzt nicht unbedingt die ganz neuen Erkenntnisse. Meinen Irrtum gestehe ich ein. Ullrich widmet sich dieses Mal der persönlichen Vergangenheit des NS-Diktators, wie er sich an die Macht arbeitete, was für ein Mensch Adolf Hitler überhaupt war und dem weiteren Verlauf der Geschichte bis zum bitteren Ende. Für Hitler und Deutschland. Seinen Reiz holt das Buch aber nicht nur aus Daten und Fakten, sondern Ullrich bezieht die Umstände und Bedingungen mit ein, wie und warum Hitler auf deutschem Boden eine solche Diktatur errichten konnte. Zwar heißt es immer wieder, Geschichte würde sich nicht eins zu eins wiederholen. Aber lässt man die damaligen Umgebungsbedingungen des obersten Nationalsozialisten noch einmal an sich vorbei ziehen, kommen erstaunliche Parallelen zur Gegenwart ans Licht. Nicht unbedingt beruhigende.
Volker Ullrich mausert sich langsam zu einem meiner liebsten Autoren in Sachen Geschichte. Er schreibt auf den Punkt, sehr lesbar, geradezu unterhaltsam und mit vielen Details. Vorher waren schon «1923» und «Acht Tage im Mai» dran. Im Vergleich zu den früheren Werken ist «Hitler» eher ein schmales Büchlein. Ich habe es trotzdem bestellt, obwohl ich meinte, es brächte jetzt nicht unbedingt die ganz neuen Erkenntnisse. Meinen Irrtum gestehe ich ein. Ullrich widmet sich dieses Mal der persönlichen Vergangenheit des NS-Diktators, wie er sich an die Macht arbeitete, was für ein Mensch Adolf Hitler überhaupt war und dem weiteren Verlauf der Geschichte bis zum bitteren Ende. Für Hitler und Deutschland. Seinen Reiz holt das Buch aber nicht nur aus Daten und Fakten, sondern Ullrich bezieht die Umstände und Bedingungen mit ein, wie und warum Hitler auf deutschem Boden eine solche Diktatur errichten konnte. Zwar heißt es immer wieder, Geschichte würde sich nicht eins zu eins wiederholen. Aber lässt man die damaligen Umgebungsbedingungen des obersten Nationalsozialisten noch einmal an sich vorbei ziehen, kommen erstaunliche Parallelen zur Gegenwart ans Licht. Nicht unbedingt beruhigende.
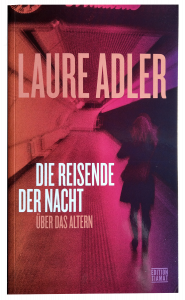 Das Spannende an Büchern ist, dass man nie so genau weiß, was einen erwartet. Erst recht interessant wird es, wenn man selbst vom Thema Betroffener ist. So erwartete ich wegen des Titels erst so etwas wie einen Roman. Doch Laure Adler macht sich in eine andere Richtung auf, ohne sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren. Laure Adler ist einige Jahre älter als ich und widmet sich in Abschnitten, die selten über ein paar Seiten hinaus gehen, dem Alter in all seinen Facetten. Sei es aus eigenen Erfahrungen mit sich selbst und anderen Menschen, in ihrer Familie und bei Freunden, soziale Fragen kommen dazu, selbst politische und philosophische. Kapitel im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Das Bild alter Menschen in der Gesellschaft wird betrachtet, wie es sich in den Epochen verändert hat und wie es in Kulturen so unterschiedlich ist. Wenn man so will, ist das Buch eine umfassende und nachdenkliche Meditation des Zustandes, unter dem die Autorin selbst mal leidet, mal einen Sinn darin zu finden versucht. Der Vorteil der feinen Gliederung ist, dass man darin blättern kann, oder es von hinten nach vorn liest, mal einen langen und mal einen kurzen Abschnitt verfolgt. Wer selbst mit dem Alter konfrontiert ist, wird viele neue Sichtweisen und Gedanken finden, welche Bedeutung das Alter für einen selbst, aber auch für andere Menschen hat. Kein Buch für die Sonnenliege am Pool, eher eines für den Nachttisch. Ein Blumenstrauß philosophischer Gedankensplitter.
Das Spannende an Büchern ist, dass man nie so genau weiß, was einen erwartet. Erst recht interessant wird es, wenn man selbst vom Thema Betroffener ist. So erwartete ich wegen des Titels erst so etwas wie einen Roman. Doch Laure Adler macht sich in eine andere Richtung auf, ohne sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren. Laure Adler ist einige Jahre älter als ich und widmet sich in Abschnitten, die selten über ein paar Seiten hinaus gehen, dem Alter in all seinen Facetten. Sei es aus eigenen Erfahrungen mit sich selbst und anderen Menschen, in ihrer Familie und bei Freunden, soziale Fragen kommen dazu, selbst politische und philosophische. Kapitel im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Das Bild alter Menschen in der Gesellschaft wird betrachtet, wie es sich in den Epochen verändert hat und wie es in Kulturen so unterschiedlich ist. Wenn man so will, ist das Buch eine umfassende und nachdenkliche Meditation des Zustandes, unter dem die Autorin selbst mal leidet, mal einen Sinn darin zu finden versucht. Der Vorteil der feinen Gliederung ist, dass man darin blättern kann, oder es von hinten nach vorn liest, mal einen langen und mal einen kurzen Abschnitt verfolgt. Wer selbst mit dem Alter konfrontiert ist, wird viele neue Sichtweisen und Gedanken finden, welche Bedeutung das Alter für einen selbst, aber auch für andere Menschen hat. Kein Buch für die Sonnenliege am Pool, eher eines für den Nachttisch. Ein Blumenstrauß philosophischer Gedankensplitter.