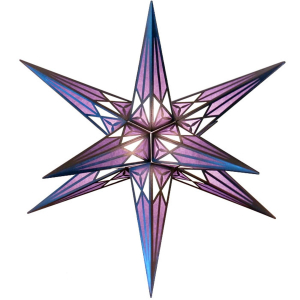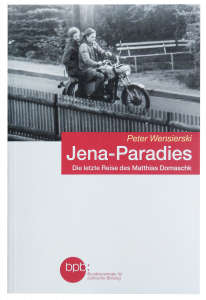 In den letzten Jahren habe ich viele Orte in Sachsen kennengelernt. Von Dresden und Leipzig bis zu Schneeberg, Lichtenstein, Oelsnitz, Augustusburg und viele andere. Nur eines war mir bisher unbekannt: wie das Leben in der DDR in den Achtziger Jahren aussah. Natürlich hatte man etwas über die Stasi gehört, über die Repressalien, über die persönliche Unfreiheit im real existierenden Sozialismus. Das kann sich mit diesem Buch ändern. Es erzählt die Geschichte des Matthias Domaschk, ein Jugendlicher wie aus heutiger Sicht wie tausende andere Youngsters auch. Mit vielen Flausen im Kopf, mit seinen eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, Politik und Leben, die er mit seinen Eltern und deren Zeitgenossen kaum teilt. Schon gar nicht mit einer repressiven Staatsmacht, für die schon das Lesen vieler Bücher über Politik und Philosophie ein Verbrechen darstellt. Wo der Begriff des „Gedankenverbrechens“ die Utopien eines George Orwells wahr werden lässt. Doch eine Reise zu Freundinnen und Freunden nach Berlin, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tritt eine Lawine von Ereignissen los, die ihre Gewalt am Ende zur Katastrophe anwachsen lässt. Ein Buch wie ein Roman, das in Wirklichkeit eine Dokumentation ist. Und das uns Wessis begreifbar macht, was es hieß, in diesem Unrechtsstaat zu leben.
In den letzten Jahren habe ich viele Orte in Sachsen kennengelernt. Von Dresden und Leipzig bis zu Schneeberg, Lichtenstein, Oelsnitz, Augustusburg und viele andere. Nur eines war mir bisher unbekannt: wie das Leben in der DDR in den Achtziger Jahren aussah. Natürlich hatte man etwas über die Stasi gehört, über die Repressalien, über die persönliche Unfreiheit im real existierenden Sozialismus. Das kann sich mit diesem Buch ändern. Es erzählt die Geschichte des Matthias Domaschk, ein Jugendlicher wie aus heutiger Sicht wie tausende andere Youngsters auch. Mit vielen Flausen im Kopf, mit seinen eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, Politik und Leben, die er mit seinen Eltern und deren Zeitgenossen kaum teilt. Schon gar nicht mit einer repressiven Staatsmacht, für die schon das Lesen vieler Bücher über Politik und Philosophie ein Verbrechen darstellt. Wo der Begriff des „Gedankenverbrechens“ die Utopien eines George Orwells wahr werden lässt. Doch eine Reise zu Freundinnen und Freunden nach Berlin, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tritt eine Lawine von Ereignissen los, die ihre Gewalt am Ende zur Katastrophe anwachsen lässt. Ein Buch wie ein Roman, das in Wirklichkeit eine Dokumentation ist. Und das uns Wessis begreifbar macht, was es hieß, in diesem Unrechtsstaat zu leben.
Beiträge
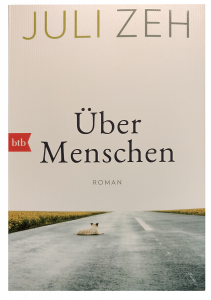 Romane kommen mir eher selten in die Hände. Es sei denn, das Bücherbudget für den Monat ist aufgebraucht, der vierte Band von Precht zur Philosophie ist zu teuer und das örtliche Sortiment zu überschaubar. Obwohl eher zweifelhafte Orientierung, ließ mich dann die Position in der Spiegel-Bestsellerliste zu diesem Buch greifen. Was ich am Ende nicht bereut habe. Es war mein erstes Buch von Juli Zeh, aber es lässt mich in Zukunft vielleicht doch wieder zu dieser Autorin greifen. Der Plot ist eher überschaubar. Die Werbetexterin Dora kauft ein altes Gutshaus in Brandenburg, trennt sich von ihrem Freund Robert in Berlin und lässt sich mit ihrer Hündin Jochen in einem Dorf in der brandenburgischen Einöde nieder. Während sie mit einem riesigen verwilderten Grundstück kämpft, lernt sie nach und nach ihre Nachbarn kennen. Zuerst eine eher unangenehme Figur, den glatzköpfigen Dorf-Nazi Gote, danach Herrn "Heini" Heinrich, der am Anfang R2-D2 heißt. Es folgt das schwule Paar Tom und Steffen. So deutlich die Schubladen, in die sie diese Menschen einsortieren könnte, so undeutlich werden sie im Lauf der Geschichte.
Romane kommen mir eher selten in die Hände. Es sei denn, das Bücherbudget für den Monat ist aufgebraucht, der vierte Band von Precht zur Philosophie ist zu teuer und das örtliche Sortiment zu überschaubar. Obwohl eher zweifelhafte Orientierung, ließ mich dann die Position in der Spiegel-Bestsellerliste zu diesem Buch greifen. Was ich am Ende nicht bereut habe. Es war mein erstes Buch von Juli Zeh, aber es lässt mich in Zukunft vielleicht doch wieder zu dieser Autorin greifen. Der Plot ist eher überschaubar. Die Werbetexterin Dora kauft ein altes Gutshaus in Brandenburg, trennt sich von ihrem Freund Robert in Berlin und lässt sich mit ihrer Hündin Jochen in einem Dorf in der brandenburgischen Einöde nieder. Während sie mit einem riesigen verwilderten Grundstück kämpft, lernt sie nach und nach ihre Nachbarn kennen. Zuerst eine eher unangenehme Figur, den glatzköpfigen Dorf-Nazi Gote, danach Herrn "Heini" Heinrich, der am Anfang R2-D2 heißt. Es folgt das schwule Paar Tom und Steffen. So deutlich die Schubladen, in die sie diese Menschen einsortieren könnte, so undeutlich werden sie im Lauf der Geschichte.
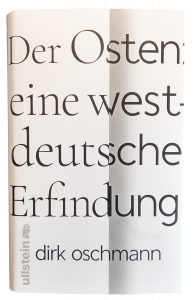 Manchmal gibt es Zufälle, die keine wirklichen Zufälle sind. Dieser Zufall war die Bestellung zweier Bücher in meiner örtlichen Buchhandlung. Beide zusammen führten am Ende zu einem anderen eigenen Bild der west-ost-deutschen Befindlichkeit. Das erste geschrieben von einem Westdeutschen 1990 bis 1991 in Dresden, das andere von einem Ostdeutschen in Ostdeutschland 2023. Ich habe als Untertitel "Eine Streitschrift" gewählt. Denn der Text ist in der Tat zornig, doch Streit sucht der Autor nicht. Dirk Oschmann hatte in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, dass der Westen sich einen Osten nach eigenem Gutdünken zusammen erfindet. Wonach der Osten immer rückständig, unflexibel, faul, demokratieunfähig und undankbar ist. Während Bayern und Rheinländer stolz auf ihren Dialekt sind, gilt Sächsisch als komisch bis nervig. Der Westen sei eben das "Normale", der Osten die Ausnahme. Weshalb der Westen sagen müsse, wo es lang geht und was das Beste für den Osten sei. Diese Sicht ist keine Ausnahme, viele Bücher und Studien, auch eben «Das letzte Jahr» von Martin Gross zeigt, wie der Westen den Osten übernahm. Als Erstes kamen der Einzelhandel und die Baumärkte, dann die westlichen Köpfe der Verwaltungen, der Politik und der Hochschulen. Wie es so schön heißt, der Westen wollte den Osten für den Umsatz und die Gewinne, als billiges Produktionsgebiet bei niedrigen Löhnen. Die Menschen waren nicht erwünscht. Aber was ist das nun eigentlich genauer, "der Osten"?
Manchmal gibt es Zufälle, die keine wirklichen Zufälle sind. Dieser Zufall war die Bestellung zweier Bücher in meiner örtlichen Buchhandlung. Beide zusammen führten am Ende zu einem anderen eigenen Bild der west-ost-deutschen Befindlichkeit. Das erste geschrieben von einem Westdeutschen 1990 bis 1991 in Dresden, das andere von einem Ostdeutschen in Ostdeutschland 2023. Ich habe als Untertitel "Eine Streitschrift" gewählt. Denn der Text ist in der Tat zornig, doch Streit sucht der Autor nicht. Dirk Oschmann hatte in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, dass der Westen sich einen Osten nach eigenem Gutdünken zusammen erfindet. Wonach der Osten immer rückständig, unflexibel, faul, demokratieunfähig und undankbar ist. Während Bayern und Rheinländer stolz auf ihren Dialekt sind, gilt Sächsisch als komisch bis nervig. Der Westen sei eben das "Normale", der Osten die Ausnahme. Weshalb der Westen sagen müsse, wo es lang geht und was das Beste für den Osten sei. Diese Sicht ist keine Ausnahme, viele Bücher und Studien, auch eben «Das letzte Jahr» von Martin Gross zeigt, wie der Westen den Osten übernahm. Als Erstes kamen der Einzelhandel und die Baumärkte, dann die westlichen Köpfe der Verwaltungen, der Politik und der Hochschulen. Wie es so schön heißt, der Westen wollte den Osten für den Umsatz und die Gewinne, als billiges Produktionsgebiet bei niedrigen Löhnen. Die Menschen waren nicht erwünscht. Aber was ist das nun eigentlich genauer, "der Osten"?
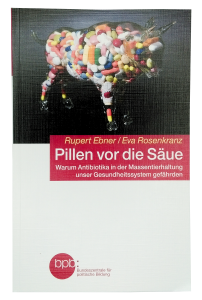 Als das Corona-Virus Anfang 2020 von China aus sich auf die Reise in alle Welt machte, war recht schnell klar, woher es kam: Aus den früher unberührten Urwäldern, die immer mehr von Menschen durchdrungen werden. Doch mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen, die exotische Tierarten als Delikatessen verspeisen, sollten gerade wir Europäer uns sparen. Wir sind seit den Achtzigern fleißig dabei, noch viel gefährlichere Mikroben zu züchten. Nämlich Bakterien, die zunehmend gegen die Wunderwaffe der Medizin, die Antibiotika, resistent werden und über Penizillin nur lachen können. Sogar Infektionen, die wir schon lange als Vergangenheit sahen, wie Tuberkulose oder Salmonellen, tauchen vermehrt in einer Version auf, gegen die Antibiotika nicht mehr nützen. Von den mehrfach resistenten Keimen in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Das haben die Bakterien nicht selbst so ausbaldowert, sondern wir produzieren sie durch den unnötigen und massenhaften Einsatz von Antibiotika in den Megaställen. Wie in Niedersachsen, mit bis zu 50.000 Schweinen oder Hühnern, zusammen gepfercht auf kleinstem Raum, auf Legeleistung oder Fleischansatz gezüchtet, mit kaputten Immunsystemen und unerträglichen Haltungsbedingungen. Da werden allein prophylaktisch Tonnen Medikamente unters Futter gemischt, die nicht nur in Hühnerkot oder Gülle in die Umwelt gelangen. Selbst im Schnitzel oder in der Putenbrust beim Discounter sind die Antibiotika noch nachweisbar. Der Grund: So viel Fleisch und Umsatz wie möglich, so billig wie möglich. Wie beim Klimawandel heißt die Devise dann: Augen zu und durch. Hauptsache die Grillwurst schmeckt und kost' nix.
Als das Corona-Virus Anfang 2020 von China aus sich auf die Reise in alle Welt machte, war recht schnell klar, woher es kam: Aus den früher unberührten Urwäldern, die immer mehr von Menschen durchdrungen werden. Doch mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen, die exotische Tierarten als Delikatessen verspeisen, sollten gerade wir Europäer uns sparen. Wir sind seit den Achtzigern fleißig dabei, noch viel gefährlichere Mikroben zu züchten. Nämlich Bakterien, die zunehmend gegen die Wunderwaffe der Medizin, die Antibiotika, resistent werden und über Penizillin nur lachen können. Sogar Infektionen, die wir schon lange als Vergangenheit sahen, wie Tuberkulose oder Salmonellen, tauchen vermehrt in einer Version auf, gegen die Antibiotika nicht mehr nützen. Von den mehrfach resistenten Keimen in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Das haben die Bakterien nicht selbst so ausbaldowert, sondern wir produzieren sie durch den unnötigen und massenhaften Einsatz von Antibiotika in den Megaställen. Wie in Niedersachsen, mit bis zu 50.000 Schweinen oder Hühnern, zusammen gepfercht auf kleinstem Raum, auf Legeleistung oder Fleischansatz gezüchtet, mit kaputten Immunsystemen und unerträglichen Haltungsbedingungen. Da werden allein prophylaktisch Tonnen Medikamente unters Futter gemischt, die nicht nur in Hühnerkot oder Gülle in die Umwelt gelangen. Selbst im Schnitzel oder in der Putenbrust beim Discounter sind die Antibiotika noch nachweisbar. Der Grund: So viel Fleisch und Umsatz wie möglich, so billig wie möglich. Wie beim Klimawandel heißt die Devise dann: Augen zu und durch. Hauptsache die Grillwurst schmeckt und kost' nix.
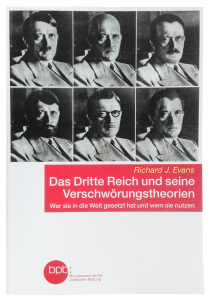 Man könnte annehmen, Verschwörungstheorien hätten erst mit der Verbreitung des Internets wirkliche Bedeutung erlangt. Tatsächlich gehen diese bis ins Mittelalter zurück, siehe Hexenverfolgung und die Inquisition der Kirche. Nun ist Evans nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Suche zu "Verschwörungstheorie" in Büchern bei Amazon liefert über 2.000 Einträge. Das Thema sollte genug behandelt sein. Doch Evans geht die Geschichte etwas anders an. Mit fünf Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich stehen. Es geht ihm jedoch nicht darum, Verschwörungstheorien grundsätzlich zu betrachten und zu erklären, sondern ihre Funktion im historischen Kontext auszuforschen. Denn Evans ist in erster Linie Historiker. Und es geht in diesem Kontext natürlich um Antisemitismus, aber nur in drei der fünf Beispiele, in zwei davon eher konstruiert als begründet. Es versteht sich, dass die Funktionen, Merkmale und Stereotypen von Verschwörungstheorien mit einbezogen werden. Man könnte das Buch als eine Vertiefung zum Thema betrachten, als Aufzeigen von konkreten Konstruktionen, wem sie dienen und warum sie so wirkmächtig sind. Jedoch am Ende noch einmal mit der Warnung, dass Verschwörungstheorien nichts sind, das man nur belächeln und sich darüber lustig machen kann, sondern dass sie Bedrohungen der Wahrheit sind. In einigen Fällen sogar zu bedrohlichen Maßnahmen ihrer Anhänger führten.
Man könnte annehmen, Verschwörungstheorien hätten erst mit der Verbreitung des Internets wirkliche Bedeutung erlangt. Tatsächlich gehen diese bis ins Mittelalter zurück, siehe Hexenverfolgung und die Inquisition der Kirche. Nun ist Evans nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Suche zu "Verschwörungstheorie" in Büchern bei Amazon liefert über 2.000 Einträge. Das Thema sollte genug behandelt sein. Doch Evans geht die Geschichte etwas anders an. Mit fünf Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich stehen. Es geht ihm jedoch nicht darum, Verschwörungstheorien grundsätzlich zu betrachten und zu erklären, sondern ihre Funktion im historischen Kontext auszuforschen. Denn Evans ist in erster Linie Historiker. Und es geht in diesem Kontext natürlich um Antisemitismus, aber nur in drei der fünf Beispiele, in zwei davon eher konstruiert als begründet. Es versteht sich, dass die Funktionen, Merkmale und Stereotypen von Verschwörungstheorien mit einbezogen werden. Man könnte das Buch als eine Vertiefung zum Thema betrachten, als Aufzeigen von konkreten Konstruktionen, wem sie dienen und warum sie so wirkmächtig sind. Jedoch am Ende noch einmal mit der Warnung, dass Verschwörungstheorien nichts sind, das man nur belächeln und sich darüber lustig machen kann, sondern dass sie Bedrohungen der Wahrheit sind. In einigen Fällen sogar zu bedrohlichen Maßnahmen ihrer Anhänger führten.
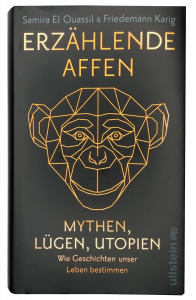 Homo Sapiens ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das der Sprache mächtig ist. Sein großer evolutionärer Vorteil, weil so Erfahrungen, Wissen und Informationen weitergegeben werden, an andere Menschen und gerade an seine Nachfahren. Doch es ist nicht die Sprache allein, was den Menschen ausmacht. Mittels Sprache kann der Mensch Geschichten erzählen, seien es wahre Begebenheiten, Mythen, Märchen, Phantasien und Lügen. Denn nach Geschichten, so El Ouassil und Karig, sind die Menschen geradezu süchtig. Aus gutem Grund, denn nur Geschichten helfen zu verstehen, Zusammenhänge zu erfassen und Begründungen zu finden, für möglichst alles, was Menschen umgibt. Noch mehr, brauchen die Menschen sogar kausale Zusammenhänge, suchen sie verzweifelt, wenn sie nicht offensichtlich sind. Götter, die Wetter, Naturkatastrophen und Schicksale bestimmen, Freunde und Feinde, die über Wohl und Wehe entscheiden. Doch gerade da liegt auch die Gefahr von Geschichten. Von der Begründung der Religionen über angebliche Erbfeindschaften bis hin zu Lügengebäuden wie die der Nationalsozialisten oder eines Donald Trump. Schon wieder so ein Brecher von Buch. Und wieder eines, das bis zum Ende spannend bleibt. Sogar erstaunliche Einsichten liefert. Auch zu sehen auf der Buchmesse Frankfurt.
Homo Sapiens ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das der Sprache mächtig ist. Sein großer evolutionärer Vorteil, weil so Erfahrungen, Wissen und Informationen weitergegeben werden, an andere Menschen und gerade an seine Nachfahren. Doch es ist nicht die Sprache allein, was den Menschen ausmacht. Mittels Sprache kann der Mensch Geschichten erzählen, seien es wahre Begebenheiten, Mythen, Märchen, Phantasien und Lügen. Denn nach Geschichten, so El Ouassil und Karig, sind die Menschen geradezu süchtig. Aus gutem Grund, denn nur Geschichten helfen zu verstehen, Zusammenhänge zu erfassen und Begründungen zu finden, für möglichst alles, was Menschen umgibt. Noch mehr, brauchen die Menschen sogar kausale Zusammenhänge, suchen sie verzweifelt, wenn sie nicht offensichtlich sind. Götter, die Wetter, Naturkatastrophen und Schicksale bestimmen, Freunde und Feinde, die über Wohl und Wehe entscheiden. Doch gerade da liegt auch die Gefahr von Geschichten. Von der Begründung der Religionen über angebliche Erbfeindschaften bis hin zu Lügengebäuden wie die der Nationalsozialisten oder eines Donald Trump. Schon wieder so ein Brecher von Buch. Und wieder eines, das bis zum Ende spannend bleibt. Sogar erstaunliche Einsichten liefert. Auch zu sehen auf der Buchmesse Frankfurt.
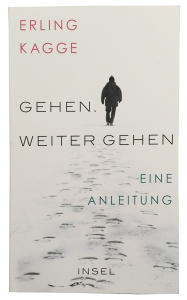 Nach einer im «The Guardian» veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, den Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum das Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken, die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet. Wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die Bipedie, ist jedoch nicht seine Erfindung, schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo Sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kagge viel mehr als Bequemlichkeit, es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurück kommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen, das ist es, was Kagge antreibt. Und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut. Wenn ich an meine Wanderungen in Snowdonia und im Lake District zurück denke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern.
Nach einer im «The Guardian» veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, den Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum das Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken, die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet. Wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die Bipedie, ist jedoch nicht seine Erfindung, schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo Sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kagge viel mehr als Bequemlichkeit, es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurück kommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen, das ist es, was Kagge antreibt. Und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut. Wenn ich an meine Wanderungen in Snowdonia und im Lake District zurück denke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Erling Kagge aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Erling Kagge aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
[/av_promobox]
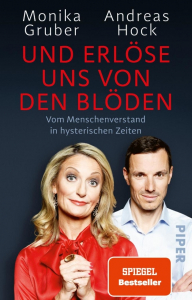 Die bestellten Bücher sind noch nicht in der Buchhandlung angekommen, also zur Überbrückung ein E-Book. Offen gestanden, kannte ich die beiden Autoren bisher gar nicht, was wohl an meinem homöopathischen Fernsehkonsum liegt. Inzwischen weiß ich, dass sie im Hauptberuf Kabarettistin sowie Journalist und Kabarettist sind, was mir im Nachhinein das Buch erklärt. Es ist also mehr Satire als Sachbuch. Nun darf Satire landläufig so ziemlich alles, also auch über ZeitgenossInnen herziehen, Geschichten überinterpretieren und Fakten zur Unterhaltung ein wenig verdrehen. Die Ziele sind nun jedoch mal nicht vorrangig Prominente oder Politiker, sondern die Menschen und Ereignisse unseres Alltags. Die merkwürdigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen, Raucher, Autofahrer, Fleischesser, Jutta Ditfurth und Muslime, und weitere Entwicklungen der Neuzeit wie Influencer. Über all diese wird nun ein gewisser Hohn und Spott ausgekübelt. So stellte sich mir die Frage, was der Sinn darin sein könnte, was sich Gruber und Hock wohl dabei gedacht haben, außer Unterhaltung zu liefern. Wie bei Satire üblich, bewegt man sich als Satiriker wie auch als Kabarettist auf einer schmalen Linie, wenn nicht gleich auf mehreren. Zwischen Klamauk und Humor, Sinn und Unsinn, zwischen Gesellschaftskritik und Besserwisserei. Was das Buch zu einem wechselhaften Genuss macht. Und doch, manche Fehlentwicklungen sind nicht zu leugnen.
Die bestellten Bücher sind noch nicht in der Buchhandlung angekommen, also zur Überbrückung ein E-Book. Offen gestanden, kannte ich die beiden Autoren bisher gar nicht, was wohl an meinem homöopathischen Fernsehkonsum liegt. Inzwischen weiß ich, dass sie im Hauptberuf Kabarettistin sowie Journalist und Kabarettist sind, was mir im Nachhinein das Buch erklärt. Es ist also mehr Satire als Sachbuch. Nun darf Satire landläufig so ziemlich alles, also auch über ZeitgenossInnen herziehen, Geschichten überinterpretieren und Fakten zur Unterhaltung ein wenig verdrehen. Die Ziele sind nun jedoch mal nicht vorrangig Prominente oder Politiker, sondern die Menschen und Ereignisse unseres Alltags. Die merkwürdigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen, Raucher, Autofahrer, Fleischesser, Jutta Ditfurth und Muslime, und weitere Entwicklungen der Neuzeit wie Influencer. Über all diese wird nun ein gewisser Hohn und Spott ausgekübelt. So stellte sich mir die Frage, was der Sinn darin sein könnte, was sich Gruber und Hock wohl dabei gedacht haben, außer Unterhaltung zu liefern. Wie bei Satire üblich, bewegt man sich als Satiriker wie auch als Kabarettist auf einer schmalen Linie, wenn nicht gleich auf mehreren. Zwischen Klamauk und Humor, Sinn und Unsinn, zwischen Gesellschaftskritik und Besserwisserei. Was das Buch zu einem wechselhaften Genuss macht. Und doch, manche Fehlentwicklungen sind nicht zu leugnen.
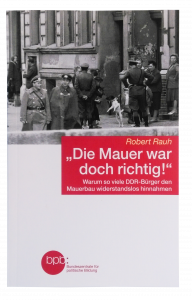 Ab Sonntag, dem 13. August 1961, machte die DDR gegenüber dem Westen dicht. Zuerst waren es Rollen aus Stacheldraht und sowjetische Panzer an den wichtigen ehemaligen Schnittstellen zwischen Ost und West. Wie am Brandenburger Tor. Über die Jahre wurden daraus eine Betonmauer mit Todesstreifen und Selbstschussanlagen. Daraufhin kam es zu Demonstrationszügen, Protesten und Kundgebungen. In West-Berlin und in der Bundesrepublik. In der DDR dagegen war es ruhig, kein Aufstand und keine wirkliche Regung, höchstens Ungläubigkeit und Betroffenheit. Die wenigen Versuche von Versammlungen wurden sofort aufgelöst. Also ganz anders als am 17. Juni 1953, oder nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Nachdenklich wurde der Autor, als ein wohl ehemaliger Bürger der früheren DDR bei der Besichtigung der früheren Grenze an der Berliner Bernauer Straße die Frage eines Schülers mit dem Satz "Die Mauer war doch richtig!" beantwortete. Nämlich als der Schüler fragte, warum sich die Menschen in der DDR 1961 nicht gewehrt haben. Zuerst kann man alle denkbaren Gründe dafür finden, dass aus der Bevölkerung der DDR praktisch kein Widerstand kam. Angst vor Konsequenzen durch die DDR-Staatsmacht, Angst von Jobverlust oder sogar Gefängnis, oder Resignation. Oder Zustimmung. Robert Rauh geht in diesem Buch der Geschichte nach, warum die Bevölkerung der DDR damals stumm blieb, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Erscheint dieses Thema zuerst als sehr fokussiert, bietet dann der Verlauf der Betrachtung viele Einblicke in den realsozialistischen Staat der sowjetischen Zone, in das Leben, aber auch in Denkweisen und Überzeugungen seiner Bewohner. Ein weiterer Puzzlestein der rätselhaften Welt, die Wessis noch immer zu ergründen versuchen.
Ab Sonntag, dem 13. August 1961, machte die DDR gegenüber dem Westen dicht. Zuerst waren es Rollen aus Stacheldraht und sowjetische Panzer an den wichtigen ehemaligen Schnittstellen zwischen Ost und West. Wie am Brandenburger Tor. Über die Jahre wurden daraus eine Betonmauer mit Todesstreifen und Selbstschussanlagen. Daraufhin kam es zu Demonstrationszügen, Protesten und Kundgebungen. In West-Berlin und in der Bundesrepublik. In der DDR dagegen war es ruhig, kein Aufstand und keine wirkliche Regung, höchstens Ungläubigkeit und Betroffenheit. Die wenigen Versuche von Versammlungen wurden sofort aufgelöst. Also ganz anders als am 17. Juni 1953, oder nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Nachdenklich wurde der Autor, als ein wohl ehemaliger Bürger der früheren DDR bei der Besichtigung der früheren Grenze an der Berliner Bernauer Straße die Frage eines Schülers mit dem Satz "Die Mauer war doch richtig!" beantwortete. Nämlich als der Schüler fragte, warum sich die Menschen in der DDR 1961 nicht gewehrt haben. Zuerst kann man alle denkbaren Gründe dafür finden, dass aus der Bevölkerung der DDR praktisch kein Widerstand kam. Angst vor Konsequenzen durch die DDR-Staatsmacht, Angst von Jobverlust oder sogar Gefängnis, oder Resignation. Oder Zustimmung. Robert Rauh geht in diesem Buch der Geschichte nach, warum die Bevölkerung der DDR damals stumm blieb, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Erscheint dieses Thema zuerst als sehr fokussiert, bietet dann der Verlauf der Betrachtung viele Einblicke in den realsozialistischen Staat der sowjetischen Zone, in das Leben, aber auch in Denkweisen und Überzeugungen seiner Bewohner. Ein weiterer Puzzlestein der rätselhaften Welt, die Wessis noch immer zu ergründen versuchen.
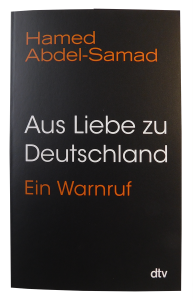 Es hat etwas nachgelassen, doch vom Tisch ist das Thema immer noch nicht wirklich. Was soll das sein, was aus politisch rechten bis rechtsextremen Zirkeln immer wieder als deutsche Identität beschworen wird. Auf welch tönernen Füßen das Gewäsch steht, wird schon beim Einwand klar, ob man über Ostfriesen oder Oberbayern, über Sachsen oder Saarländer redet. Was ist mit dem Schreiber dieser Zeilen, der dort drüben seit seiner Jugend nach wenigen Wochen Aufenthalt seine deutsche gegen eine irgendwie englische Identität tauscht, Englisch spricht, englische Nationalgerichte liebt, nie auf der falschen Straßenseite fährt, im Supermarkt keinem im Wege steht und auf jedem Parkplatz Smalltalk pflegt? Noch ausgeprägter sind diese Fragen für Hamed Abdel-Samad, der sich ursprünglich als Araber, Ägypter oder Palästinenser fühlte, je nach aktuellem Standort. Dann über Zwischenstationen nach Deutschland kam und hier blieb. Doch noch immer beschäftigt ihn die Frage, was seine Identität ist. Weder kann er seine arabische Identität leugnen, noch inzwischen seinen inneren Anteil als Deutscher. Will er auch nicht. Abdel-Samad zeigt an seinem eigenen Beispiel sehr deutlich, dass Identität ein Konstrukt ist. Das ist der eine Teil des Buches. Der andere ist seine Sicht auf dieses Deutschland, was es prägt, geschichtlich, gesellschaftlich wie politisch. Dieses Deutschland, das es erst seit 1871 gibt, das noch immer trotz der Geschehen in 1990 keine gewachsene Nation ist wie Großbritannien oder Frankreich. Trotz des dummen Geredes von Alexander Gauland über tausendjährige Geschichte und Vogelschiss. Es gäbe keinen Anlass für Zweifel, so Abdel-Samad, dass dieses Deutschland der beste Staat sei, der je auf diesem Boden existiert hat. Es ist für ihn unverständlich, warum eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen hier mit diesem Staat hadert, ja einige wenige ihn sogar beseitigen möchten. Vielleicht braucht es gerade den unverblümten Blick eines "Zugewanderten", um wieder ein klares Bild dieser Nation zu bekommen.
Es hat etwas nachgelassen, doch vom Tisch ist das Thema immer noch nicht wirklich. Was soll das sein, was aus politisch rechten bis rechtsextremen Zirkeln immer wieder als deutsche Identität beschworen wird. Auf welch tönernen Füßen das Gewäsch steht, wird schon beim Einwand klar, ob man über Ostfriesen oder Oberbayern, über Sachsen oder Saarländer redet. Was ist mit dem Schreiber dieser Zeilen, der dort drüben seit seiner Jugend nach wenigen Wochen Aufenthalt seine deutsche gegen eine irgendwie englische Identität tauscht, Englisch spricht, englische Nationalgerichte liebt, nie auf der falschen Straßenseite fährt, im Supermarkt keinem im Wege steht und auf jedem Parkplatz Smalltalk pflegt? Noch ausgeprägter sind diese Fragen für Hamed Abdel-Samad, der sich ursprünglich als Araber, Ägypter oder Palästinenser fühlte, je nach aktuellem Standort. Dann über Zwischenstationen nach Deutschland kam und hier blieb. Doch noch immer beschäftigt ihn die Frage, was seine Identität ist. Weder kann er seine arabische Identität leugnen, noch inzwischen seinen inneren Anteil als Deutscher. Will er auch nicht. Abdel-Samad zeigt an seinem eigenen Beispiel sehr deutlich, dass Identität ein Konstrukt ist. Das ist der eine Teil des Buches. Der andere ist seine Sicht auf dieses Deutschland, was es prägt, geschichtlich, gesellschaftlich wie politisch. Dieses Deutschland, das es erst seit 1871 gibt, das noch immer trotz der Geschehen in 1990 keine gewachsene Nation ist wie Großbritannien oder Frankreich. Trotz des dummen Geredes von Alexander Gauland über tausendjährige Geschichte und Vogelschiss. Es gäbe keinen Anlass für Zweifel, so Abdel-Samad, dass dieses Deutschland der beste Staat sei, der je auf diesem Boden existiert hat. Es ist für ihn unverständlich, warum eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen hier mit diesem Staat hadert, ja einige wenige ihn sogar beseitigen möchten. Vielleicht braucht es gerade den unverblümten Blick eines "Zugewanderten", um wieder ein klares Bild dieser Nation zu bekommen.
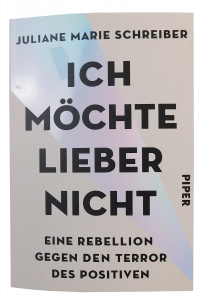 Der Satz, der den Titel des Buches bildet, wird dem Einen oder der Anderen bekannt vorkommen. Er stammt aus der Erzählung von Herman Melville, Bartleby der Schreiber, der seinen Chef mit dieser Antwort – im englischen Original “I would prefer not to” – auf Anweisungen in den Wahnsinn treibt. Doch um Bartleby geht im Grunde nicht, oder wieder doch. Genauer geht es darum, diese Antwort zu geben, wenn wir von der Glücksindustrie mal wieder angehalten werden, alles positiv zu sehen. Das Glück in Badesalz, parfümiertem Kräutertee oder der neusten Spielekonsole zu finden. Oder noch den letzten Reinfall als Chance zu sehen, statt als Versagen oder Pech. Auch passt diese Antwort fast immer auf den glänzenden Hinweis, jeder könne alles erreichen, wenn er es nur ganz fest will. Gerade neoliberale Zeitgenossen, oder auch Genossinnen, lieben diese Plattitüde bis zur Schmerzgrenze. Juliane Marie Schreiber schlägt vor, sich diesem Terror des Positiven möglichst zu entziehen. Als wenn Glück, oder das, was uns als solches verkauft wird, unserem Leben irgendeinen Sinn gibt. Es war der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman, der sich mit dem Konzept der positiven Psychologie die Taschen reichlich füllte, durch die US-Regierung und das Militär, als er behauptete, dass er mit seinen psychologisch positiv orientierten Verfahren sogar Kriegstraumata heilen könne und Soldaten motivieren, begeistert in den Krieg zu ziehen. Aufgegriffen hat das auch schon früh die Industrie, als sie suggerierte, sich mit diesem Waschmittel oder dieser Zigarettenmarke Glück kaufen zu können. Als wäre Glück wirklich eine Bereicherung oder ein Lebensziel. Mein erster Gedanke dazu waren die blöden Sprüche an Depressive, sie sollten doch nicht alles so schwarz sehen und positiv in die Zukunft blicken. Schreiber ruft zum Widerstand auf gegen diese Ideologie unserer Zeit, Scheitern als Chance zu sehen und ständig an unserer Optimierung zu arbeiten. Dagegen hilft nur Rebellion, meint sie. Die Welt sei nicht von den Glücklichen verändert worden, sondern von den Unzufriedenen.
Der Satz, der den Titel des Buches bildet, wird dem Einen oder der Anderen bekannt vorkommen. Er stammt aus der Erzählung von Herman Melville, Bartleby der Schreiber, der seinen Chef mit dieser Antwort – im englischen Original “I would prefer not to” – auf Anweisungen in den Wahnsinn treibt. Doch um Bartleby geht im Grunde nicht, oder wieder doch. Genauer geht es darum, diese Antwort zu geben, wenn wir von der Glücksindustrie mal wieder angehalten werden, alles positiv zu sehen. Das Glück in Badesalz, parfümiertem Kräutertee oder der neusten Spielekonsole zu finden. Oder noch den letzten Reinfall als Chance zu sehen, statt als Versagen oder Pech. Auch passt diese Antwort fast immer auf den glänzenden Hinweis, jeder könne alles erreichen, wenn er es nur ganz fest will. Gerade neoliberale Zeitgenossen, oder auch Genossinnen, lieben diese Plattitüde bis zur Schmerzgrenze. Juliane Marie Schreiber schlägt vor, sich diesem Terror des Positiven möglichst zu entziehen. Als wenn Glück, oder das, was uns als solches verkauft wird, unserem Leben irgendeinen Sinn gibt. Es war der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman, der sich mit dem Konzept der positiven Psychologie die Taschen reichlich füllte, durch die US-Regierung und das Militär, als er behauptete, dass er mit seinen psychologisch positiv orientierten Verfahren sogar Kriegstraumata heilen könne und Soldaten motivieren, begeistert in den Krieg zu ziehen. Aufgegriffen hat das auch schon früh die Industrie, als sie suggerierte, sich mit diesem Waschmittel oder dieser Zigarettenmarke Glück kaufen zu können. Als wäre Glück wirklich eine Bereicherung oder ein Lebensziel. Mein erster Gedanke dazu waren die blöden Sprüche an Depressive, sie sollten doch nicht alles so schwarz sehen und positiv in die Zukunft blicken. Schreiber ruft zum Widerstand auf gegen diese Ideologie unserer Zeit, Scheitern als Chance zu sehen und ständig an unserer Optimierung zu arbeiten. Dagegen hilft nur Rebellion, meint sie. Die Welt sei nicht von den Glücklichen verändert worden, sondern von den Unzufriedenen.
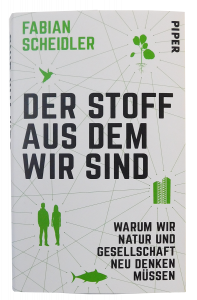 Schon im Altertum fragten sich die Philosophen, woraus die Stoffe und letztlich wir selbst bestehen. Die Antworten waren damals recht unbefriedigend. Konkreter wurde es vor ca. 400 Jahren, als sich die Naturwissenschaften nach unserem heutigen Verständnis entwickelten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Theorien, dass Materie aus ganz kleinen Teilen besteht, den Atomen. Damit begann ein Welterklärungsprogramm, wurde eine mechanistische Sicht der Welt geschaffen, in der alle Vorgänge durch mechanische Wirkungen erklärt wurden. Nicht zufällig war das in der Zeit, als auch das entstand, was wir heute neokapitalistische Wirtschaft nennen. Gerade die Physik sollte sich als die große Erkenntnismaschine entpuppen, aus der Wissenschaften, Forschung und Wirtschaft ihre Vorteile zogen. Zweifel an dieser Sicht der Welt gab es früh, besonders, aber nicht nur aus der Philosophie. Ob das ganze Universum nicht viel komplexer sei als ein paar winzige Kügelchen, die umeinander kreisen, in der alle Zusammenhänge aus Regeln besteht, die dem Wenn-Dann-Immer-Prinzip folgen. Eine erste Macke bekam diese Sicht auf die Welt und die Natur durch die Theorien von Albert Einstein, dass Zeit nichts Unveränderliches ist, wodurch die Schwerkraft entsteht, die Äquivalenz von Energie und Masse. Ganz übel wurde es dann mit der Quantenphysik, die letztlich das Atommodell, das heute noch an allen Schulen gelehrt wird, völlig in Frage stellt. Die Vorstellung, dass Materie aus Feldern, ihrer Wechselwirkung und ihren Beziehungen entsteht, ist fast allen Menschen noch heute fremd. Wenn wir aber längst wissen, dass die mechanistische Erklärung der Welt, und des Lebens, ganz anders ist als gedacht, warum hängen wir dann immer noch an diesem Bild? Die Antwort liegt nicht zuletzt darin, dass es für die Politik und die Wirtschaft von großem Vorteil ist. Deshalb möchte Fabian Scheidler mit diesem Naturbild aufräumen.
Schon im Altertum fragten sich die Philosophen, woraus die Stoffe und letztlich wir selbst bestehen. Die Antworten waren damals recht unbefriedigend. Konkreter wurde es vor ca. 400 Jahren, als sich die Naturwissenschaften nach unserem heutigen Verständnis entwickelten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Theorien, dass Materie aus ganz kleinen Teilen besteht, den Atomen. Damit begann ein Welterklärungsprogramm, wurde eine mechanistische Sicht der Welt geschaffen, in der alle Vorgänge durch mechanische Wirkungen erklärt wurden. Nicht zufällig war das in der Zeit, als auch das entstand, was wir heute neokapitalistische Wirtschaft nennen. Gerade die Physik sollte sich als die große Erkenntnismaschine entpuppen, aus der Wissenschaften, Forschung und Wirtschaft ihre Vorteile zogen. Zweifel an dieser Sicht der Welt gab es früh, besonders, aber nicht nur aus der Philosophie. Ob das ganze Universum nicht viel komplexer sei als ein paar winzige Kügelchen, die umeinander kreisen, in der alle Zusammenhänge aus Regeln besteht, die dem Wenn-Dann-Immer-Prinzip folgen. Eine erste Macke bekam diese Sicht auf die Welt und die Natur durch die Theorien von Albert Einstein, dass Zeit nichts Unveränderliches ist, wodurch die Schwerkraft entsteht, die Äquivalenz von Energie und Masse. Ganz übel wurde es dann mit der Quantenphysik, die letztlich das Atommodell, das heute noch an allen Schulen gelehrt wird, völlig in Frage stellt. Die Vorstellung, dass Materie aus Feldern, ihrer Wechselwirkung und ihren Beziehungen entsteht, ist fast allen Menschen noch heute fremd. Wenn wir aber längst wissen, dass die mechanistische Erklärung der Welt, und des Lebens, ganz anders ist als gedacht, warum hängen wir dann immer noch an diesem Bild? Die Antwort liegt nicht zuletzt darin, dass es für die Politik und die Wirtschaft von großem Vorteil ist. Deshalb möchte Fabian Scheidler mit diesem Naturbild aufräumen.
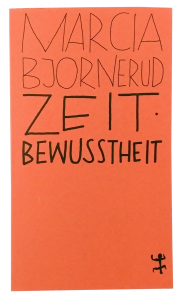 Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Der heutige Mensch tauchte erst von ca. 300.000 Jahren auf. Einem beliebtem Bild nach, wenn man die Zeit der Existenz der Erde als einen Tag betrachtet, erschien Homo in der letzten Sekunde vor Mitternacht. Aber was kommt in diesem Bild eigentlich nach Mitternacht? So widmet sich Marcia Bjornerud, Geologin, gleich mehreren Fragen, von der, wie die Erde kurz nach ihrem Entstehen aussah, wie sie sich in den Milliarden Jahren verändert hat, welche Rolle der Mensch dabei spielt und wie die Geschichte wohl weitergeht. Das Ende ist klar, in ca. drei Milliarden Jahren wird die Sonne immer heißer, dehnt sich aus und verschluckt die meisten Planeten, die sie heute umkreisen. Dazu nimmt Bjornerud den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit aus geologischer Sicht. So weit unserer heutiger Wissensstand dazu ausreicht, denn viele Fragen sind noch lange nicht beantwortet. Warum gab es mindestens fünf große Phasen des Massensterbens auf der Erde, wobei das Sterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit noch das harmloseste war? Auch noch nicht ganz geklärt ist, wieso die Erde mehrmals ihre Atmosphäre gewechselt hat. Die erste enthielt noch gar keinen Sauerstoff, erst Cyanobakterien sorgten für wenige Promille. Trotz vieler unbeantworteter Fragen haben wir heute ein klareres Bild der Erde, wie wir sie jetzt kennen, doch auch das erst mit dem 20 Jahrhundert. Wie entstanden Gebirge? Die Theorie der Plattentektonik entstand erst 1960. Aber Bjornerud geht weiter. Sie blickt genau so aus ökologischen und ökomischen Sichtweisen darauf, dass der Mensch in wenigen Jahrhunderten die Erde stärker verändert hat als die Natur über Jahrmillionen. Also ein geologischer und ein ökologischer Ritt durch die Zeit. Die wir Menschen völlig falsch einschätzen.
Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Der heutige Mensch tauchte erst von ca. 300.000 Jahren auf. Einem beliebtem Bild nach, wenn man die Zeit der Existenz der Erde als einen Tag betrachtet, erschien Homo in der letzten Sekunde vor Mitternacht. Aber was kommt in diesem Bild eigentlich nach Mitternacht? So widmet sich Marcia Bjornerud, Geologin, gleich mehreren Fragen, von der, wie die Erde kurz nach ihrem Entstehen aussah, wie sie sich in den Milliarden Jahren verändert hat, welche Rolle der Mensch dabei spielt und wie die Geschichte wohl weitergeht. Das Ende ist klar, in ca. drei Milliarden Jahren wird die Sonne immer heißer, dehnt sich aus und verschluckt die meisten Planeten, die sie heute umkreisen. Dazu nimmt Bjornerud den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit aus geologischer Sicht. So weit unserer heutiger Wissensstand dazu ausreicht, denn viele Fragen sind noch lange nicht beantwortet. Warum gab es mindestens fünf große Phasen des Massensterbens auf der Erde, wobei das Sterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit noch das harmloseste war? Auch noch nicht ganz geklärt ist, wieso die Erde mehrmals ihre Atmosphäre gewechselt hat. Die erste enthielt noch gar keinen Sauerstoff, erst Cyanobakterien sorgten für wenige Promille. Trotz vieler unbeantworteter Fragen haben wir heute ein klareres Bild der Erde, wie wir sie jetzt kennen, doch auch das erst mit dem 20 Jahrhundert. Wie entstanden Gebirge? Die Theorie der Plattentektonik entstand erst 1960. Aber Bjornerud geht weiter. Sie blickt genau so aus ökologischen und ökomischen Sichtweisen darauf, dass der Mensch in wenigen Jahrhunderten die Erde stärker verändert hat als die Natur über Jahrmillionen. Also ein geologischer und ein ökologischer Ritt durch die Zeit. Die wir Menschen völlig falsch einschätzen.
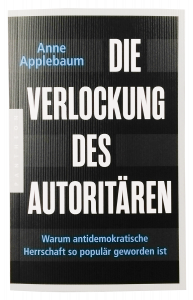 Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.
Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.
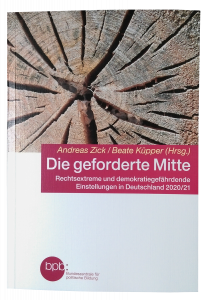 Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die "Mitte" ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.
Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die "Mitte" ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.
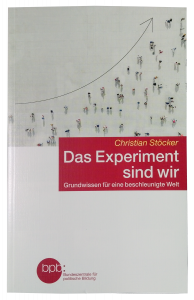 Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:
Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:
Nur 18% der Studenten lieferten spontan die richtige Antwort, von den anderen 82% meinte die große Mehrheit, das sei nach 24 Tagen der Fall gewesen. Was zeigt, dass Menschen, auch die mit einer höheren Bildung, mit exponentiellen Funktionen nicht umgehen können. So waren auch Politiker und sogar Wissenschaftler von der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus überrascht. Ich war ob des Themas von einer gewissen Skepsis beim Beginn des Buches befangen, musste aber schnell feststellen, dass Stöcker mit seiner These völlig recht hat. Dieser eingebaute Mangel an Verständnis für Mathematik hat Konsequenzen. Unsere Entscheidungsblindheit und unsere Neigung zu unlogischen Annahmen hat schon Daniel Kahneman bewiesen, der in diesem Buch oft zitiert wird. Die eigentliche Frage ist daher, was diese Einschränkung bewirkt, in einer Welt, die von exponentiellen Entwicklungen geprägt ist. Sei es in der Technik und der Wissenschaft, in gesellschaftlichen und politischen Tendenzen, in der weltweiten Bevölkerungszahl oder beim Klimawandel. Doch ist das das nicht das einzige Thema, nicht einmal das zentrale, sondern Stöcker ist in der Forschung der künstlichen Intelligenz beteiligt. Auch die entwickelt sich exponentiell, nicht nur wegen immer leistungsfähigerer Hardware, sondern auch wegen ganz neuer Wege und Methoden in der Software. KI greift schon dort immer mehr in unser Leben ein als gedacht, wo wir sie direkt gar nicht sehen: in den sozialen Medien. Mit weitreichenden Folgen, die immer gefährlicher werden. Also ist es nicht ein Buch über menschliche Fehlannahmen, sondern mehr über künstliche Intelligenz.
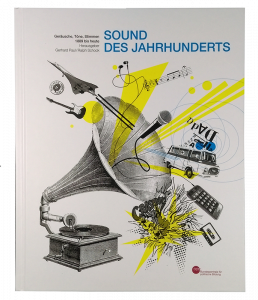 Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.
Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.
Begleitet werden die 100 Beiträge unterschiedlichster Autoren vieler Wissensbereiche von einer DVD mit mehr als 80 akustischen Dokumenten, die von historischen Klängen bis zu politischen Reden und einfach Geräuschen die Texte ergänzen. Ein Brecher von Buch mit vielen Bildern und Illustrationen. Für ein Buch dieses Umfangs und dieser Tiefe zu einem unfassbar fairen Preis bei der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de). Für alle an der Akustik technisch, kulturell und historisch Interessierten eine tolle Lektüre, die einen lange beschäftigt.
Der Klappentext:
Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute
Wie klingt eigentlich Geschichte? Das zwanzigste Jahrhundert erlebte akustische Zäsuren wie keine Zeit zuvor. Was war der charakteristische Sound der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen? Welche Kraft hatten bestimmte Schallereignisse? Wie ist das Verhältnis von Sound und Macht? Wie sehr präg(t)en akustische Welt und Hörsinn den menschlichen Alltag und das historische Geschehen? Schriftliche und bildliche Quellen werden schon lange untersucht, aber in diesem Dossier stehen Geräusche, Töne und Stimmen im Fokus. Die interdisziplinär ausgelegten Beiträge erhellen die sozialen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen oder geschlechterspezifischen Aspekte einzelner Klanggeschichten.
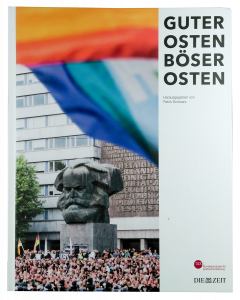 Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg 'gemacht'. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der "ZEIT im Osten". Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,-- Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.
Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg 'gemacht'. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der "ZEIT im Osten". Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,-- Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.
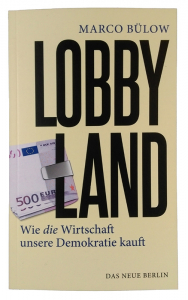 Ein Mitglied der SPD aus Dortmund kommt 2002 mit gerade mal 31 Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag. Er ist voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein, hat hehre Vorstellungen von Politik, will verändern und progressive linke Politik machen. Doch kaum ist er in Berlin angekommen, wird er ausgebremst und diszipliniert. Von Parteitaktik und Fraktionszwang, von den ungeschriebenen Regeln. Kritiker der Großen Koalition während der Regierungsbildung 2017/2018, stimmt er im März 2018 gegen Angela Merkel. Seine Progressive Plattform verfolgt zwei Ziele: In einem linken Bündnis die SPD zu erneuern und gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland anzugehen. 5.000 Menschen unterschrieben seinen Aufruf, rund die Hälfte SPD-Mitglieder, die andere Hälfte Mitglieder in anderen Parteien oder parteilos. Doch er scheitert. 2018 tritt er aus der SPD aus. In seinem Buch Lobbyland erzählt er seine Geschichte, von seinen Erlebnissen in der Politik und erklärt seine Sicht auf den deutschen Politikbetrieb. Da ich bisher nicht gehört habe, dass jemand gegen diese Aussagen geklagt hätte, ist unsere Demokratie wohl viel weniger von der AfD oder von Verschwörungserzählern bedroht, sondern eher durch das Treiben unter der großen gläsernen Kuppel am Platz der Republik 1.
Ein Mitglied der SPD aus Dortmund kommt 2002 mit gerade mal 31 Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag. Er ist voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein, hat hehre Vorstellungen von Politik, will verändern und progressive linke Politik machen. Doch kaum ist er in Berlin angekommen, wird er ausgebremst und diszipliniert. Von Parteitaktik und Fraktionszwang, von den ungeschriebenen Regeln. Kritiker der Großen Koalition während der Regierungsbildung 2017/2018, stimmt er im März 2018 gegen Angela Merkel. Seine Progressive Plattform verfolgt zwei Ziele: In einem linken Bündnis die SPD zu erneuern und gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland anzugehen. 5.000 Menschen unterschrieben seinen Aufruf, rund die Hälfte SPD-Mitglieder, die andere Hälfte Mitglieder in anderen Parteien oder parteilos. Doch er scheitert. 2018 tritt er aus der SPD aus. In seinem Buch Lobbyland erzählt er seine Geschichte, von seinen Erlebnissen in der Politik und erklärt seine Sicht auf den deutschen Politikbetrieb. Da ich bisher nicht gehört habe, dass jemand gegen diese Aussagen geklagt hätte, ist unsere Demokratie wohl viel weniger von der AfD oder von Verschwörungserzählern bedroht, sondern eher durch das Treiben unter der großen gläsernen Kuppel am Platz der Republik 1.