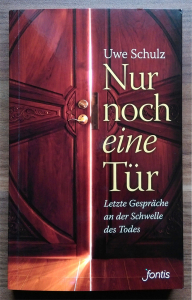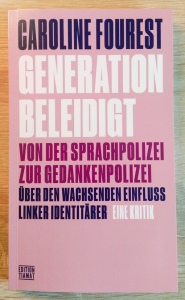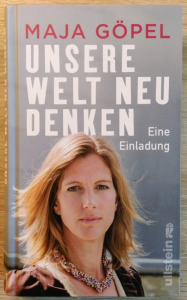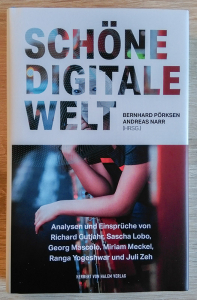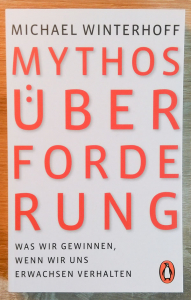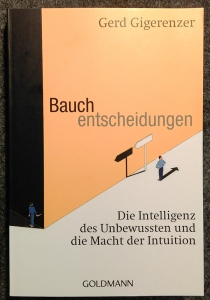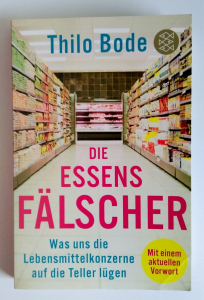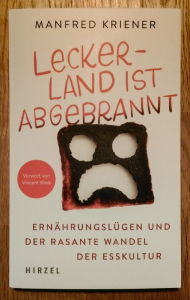Lange genug habe ich Bögen um dieses Buch gemacht. Dabei ist der Autor eine meiner liebsten Stimmen im WDR. Uwe Schulz, Journalist, Autor, Moderator, Trainer, seit 1993 war er bei Eins Live, dem WDR-Fernsehen, WDR 2 und in der WM-Redaktion 2006 des ARD-Hörfunks beschäftigt. Aktuell hört man ihn oft in WDR 5, vom Morgenecho über Alles in Butter bis zur Medienschelte in Töne, Texte, Bilder. Eine Zeit lang war er stellvertretender Studioleiter in Bielefeld und hatte eine Korrespondenten-Vertretung im ARD-Studio in London. Sein Buch Nur noch eine Tür behandelt ein Thema, mit dem die Beschäftigung mit 30 noch leicht fällt, aber um so schwerer, wenn man wie ich die 60 schon länger hinter sich gelassen hat. Dabei ist es weder eine philosophische, noch eine wissenschaftliche, noch eine theoretische Betrachtung. Es ist eine Art Reflektion über diesen letzten Weg, diese letzte Tür, durch die wir alle irgendwann gehen müssen. Uwe Schulz leuchtet aus, was der Tod in unserem Alltag bedeutet, mit Menschen, bei denen eben diese letzte Tür zum Alltag oder sogar zu ihrem Beruf gehört. Oder die selbst das Ende ihres irdischen Daseins vor Augen haben. Denn mal mutig ans Werk. Spoileralarm: es lohnt sich.
Beiträge
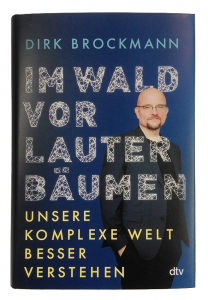 Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?
Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?
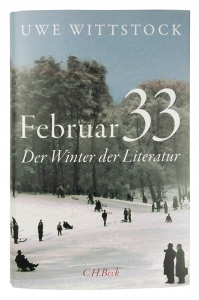 Wer noch etwas mit Namen wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Carl von Ossietzky, Heinrich von Brentano, Berthold Brecht und sogar Gustav Kiepenheuer anfangen kann, für den ist das Buch das richtige. Allen gemein ist, dass sie von den Nazis nach der Machtübernahme mit der Vereidigung Adolf Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933 vertrieben, verhaftet oder wenigstens mundtot gemacht wurden. Künstler, Schauspieler, Journalisten und Theaterleute bis hin zu Verlegern und natürlich auch Politiker. Es geht jedoch in diesem Buch nicht um Politiker, die spielen eher eine Nebenrolle, als historische Fakten, Taktgeber oder Zeitgenossen. Wie das verbrecherische Regime ab der Machtübernahme die deutsche Kulturszene umkrempelte, als nur noch den Nazis wohlgefällige oder dienstbare Geister oder besser gleich Parteimitglieder einen völkischen, antisemitischen und stramm rechten Kurs durchsetzten. Der Februar 1933 war in diesem Trauerspiel ein zentraler Monat, nach den Notverordnungen der Beginn der Horrorjahre bis 1945. Aber Februar 33 ist kein Geschichtsbuch, keine Auflistung von Daten und Geschehnissen, sondern ein Roman. Es geht um die Zeit, als man im Januar Deutschland als demokratische Republik verließ und im März in eine Diktatur zurückkehrte.
Wer noch etwas mit Namen wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Carl von Ossietzky, Heinrich von Brentano, Berthold Brecht und sogar Gustav Kiepenheuer anfangen kann, für den ist das Buch das richtige. Allen gemein ist, dass sie von den Nazis nach der Machtübernahme mit der Vereidigung Adolf Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933 vertrieben, verhaftet oder wenigstens mundtot gemacht wurden. Künstler, Schauspieler, Journalisten und Theaterleute bis hin zu Verlegern und natürlich auch Politiker. Es geht jedoch in diesem Buch nicht um Politiker, die spielen eher eine Nebenrolle, als historische Fakten, Taktgeber oder Zeitgenossen. Wie das verbrecherische Regime ab der Machtübernahme die deutsche Kulturszene umkrempelte, als nur noch den Nazis wohlgefällige oder dienstbare Geister oder besser gleich Parteimitglieder einen völkischen, antisemitischen und stramm rechten Kurs durchsetzten. Der Februar 1933 war in diesem Trauerspiel ein zentraler Monat, nach den Notverordnungen der Beginn der Horrorjahre bis 1945. Aber Februar 33 ist kein Geschichtsbuch, keine Auflistung von Daten und Geschehnissen, sondern ein Roman. Es geht um die Zeit, als man im Januar Deutschland als demokratische Republik verließ und im März in eine Diktatur zurückkehrte.
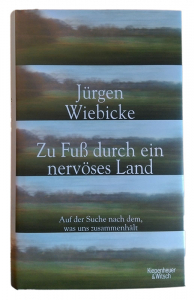 Jürgen Wiebicke ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, durch Deutschland zu Fuß zu reisen. Und doch macht er es anders. Kein sportlicher Hintergrund, sondern ein politisch-philosophischer. Nicht durch ganz Deutschland, oder quer durch Deutschland, sondern nur von Köln an den Niederrhein, durch das Münsterland bis nach Ostwestfalen. Er will herausfinden, was dieses Land noch zusammen hält, im so spektakulären Jahr 2015. Dazu erwischt er einen der heißesten Sommer im schweißtreibenden Juli. Das Buch erschien schon 2016, gelesen in einer Neuauflage in 2019. So macht er sich auf den Weg, schaut sich im Land um, spricht Leute an, die ihm auf seinem Weg begegnen, hat jedoch zusätzlich feste Termine, wie mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, einer Philosophin, einer Künstlerin, einem Pater in einem Kloster, mit einem Museumsleiter in Herne. Es ist keine so ungewöhnliche Reise, ungewöhnlich ist, wie ein Philosoph auf die Dinge schaut. Auf die Dinge, die das Jahr 2015 prägen, die vielen Flüchtlinge, die Krise in Griechenland, die die Eurozone zu sprengen droht, der Aufstieg der AfD, überhaupt die Nervosität in Deutschland. Und wie man es von Jürgen Wiebicke erwarten würde, sind es nicht die Ereignisse auf dieser Reise, die den wirklichen Inhalt des Buches ausmachen. Sondern seine Gedanken dazu, wie es wohl Aristoteles, Marc Aurel oder Sokrates sehen würde. Oder eben Jürgen Wiebicke.
Jürgen Wiebicke ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, durch Deutschland zu Fuß zu reisen. Und doch macht er es anders. Kein sportlicher Hintergrund, sondern ein politisch-philosophischer. Nicht durch ganz Deutschland, oder quer durch Deutschland, sondern nur von Köln an den Niederrhein, durch das Münsterland bis nach Ostwestfalen. Er will herausfinden, was dieses Land noch zusammen hält, im so spektakulären Jahr 2015. Dazu erwischt er einen der heißesten Sommer im schweißtreibenden Juli. Das Buch erschien schon 2016, gelesen in einer Neuauflage in 2019. So macht er sich auf den Weg, schaut sich im Land um, spricht Leute an, die ihm auf seinem Weg begegnen, hat jedoch zusätzlich feste Termine, wie mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, einer Philosophin, einer Künstlerin, einem Pater in einem Kloster, mit einem Museumsleiter in Herne. Es ist keine so ungewöhnliche Reise, ungewöhnlich ist, wie ein Philosoph auf die Dinge schaut. Auf die Dinge, die das Jahr 2015 prägen, die vielen Flüchtlinge, die Krise in Griechenland, die die Eurozone zu sprengen droht, der Aufstieg der AfD, überhaupt die Nervosität in Deutschland. Und wie man es von Jürgen Wiebicke erwarten würde, sind es nicht die Ereignisse auf dieser Reise, die den wirklichen Inhalt des Buches ausmachen. Sondern seine Gedanken dazu, wie es wohl Aristoteles, Marc Aurel oder Sokrates sehen würde. Oder eben Jürgen Wiebicke.
 Die Veränderung des Klimas auf der Erde, das Steigen der Jahres-Durchschnittstemperaturen, all das sind keine Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts. Schon in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts fielen diese rapiden Veränderungen Wissenschaftlern auf. Nicht umsonst warnte schon 1992 der Club of Rome in seinem Bericht Neue Grenzen des Wachstums vor den Auswirkungen der zunehmend freigesetzten Treibhausgase. Seitdem gibt es tausende von Berichten und Analysen, die die Erderwärmung nicht nur erklären, sondern auch beweisen. Was bisher fehlte, jedenfalls in der deutschen Literatur, war eine Art Meta-Betrachtung all dieser Daten. Das holen Nick Reimer und Toralf Staud in diesem Buch nach. Bezogen auf das Wissen, das wir heute über die Erderwärmung haben, wie sieht demnach im Jahre 2050 die Lage in Deutschland aus? Was sind die Auswirkungen für Deutschland, auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität? Die Grundlage für das Buch sind Zahlen, Daten und Fakten. Natürlich sind es letztendlich Projektionen und Prognosen. Wer aber im Physik- und Chemieunterricht in der Schule halbwegs wach war, kann die Schlüsse und Folgerungen der Autoren mühelos nachvollziehen. Das Ergebnis müsste eigentlich mindestens alle Politiker und Wirtschaftsmenschen in helle Panik versetzen. Den normalen Bürger genau so. Warum das eben nicht so ist, versucht ein Interview als letztes Kapitel zu klären. Danach kann ich am Ende nur so zusammen fassen: Es sieht übel aus.
Die Veränderung des Klimas auf der Erde, das Steigen der Jahres-Durchschnittstemperaturen, all das sind keine Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts. Schon in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts fielen diese rapiden Veränderungen Wissenschaftlern auf. Nicht umsonst warnte schon 1992 der Club of Rome in seinem Bericht Neue Grenzen des Wachstums vor den Auswirkungen der zunehmend freigesetzten Treibhausgase. Seitdem gibt es tausende von Berichten und Analysen, die die Erderwärmung nicht nur erklären, sondern auch beweisen. Was bisher fehlte, jedenfalls in der deutschen Literatur, war eine Art Meta-Betrachtung all dieser Daten. Das holen Nick Reimer und Toralf Staud in diesem Buch nach. Bezogen auf das Wissen, das wir heute über die Erderwärmung haben, wie sieht demnach im Jahre 2050 die Lage in Deutschland aus? Was sind die Auswirkungen für Deutschland, auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität? Die Grundlage für das Buch sind Zahlen, Daten und Fakten. Natürlich sind es letztendlich Projektionen und Prognosen. Wer aber im Physik- und Chemieunterricht in der Schule halbwegs wach war, kann die Schlüsse und Folgerungen der Autoren mühelos nachvollziehen. Das Ergebnis müsste eigentlich mindestens alle Politiker und Wirtschaftsmenschen in helle Panik versetzen. Den normalen Bürger genau so. Warum das eben nicht so ist, versucht ein Interview als letztes Kapitel zu klären. Danach kann ich am Ende nur so zusammen fassen: Es sieht übel aus.
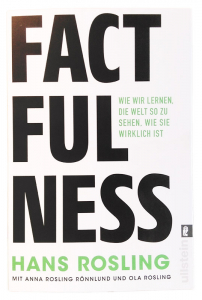 Wahrscheinlich ist es eher selten, dass ich mit Bill Gates und Barack Obama einer Meinung bin. Was dieses Buch angeht dann aber schon. Beide bezeichnen es als ein sehr lesenswertes und inspirierendes Buch. Es geht um unser Denken und unsere Vorstellung der Wirklichkeit. Wobei das Thema an sich für mich nicht ganz so neu war, denn auch die Bücher von Gerd Gigerenzer und Daniel Kahneman beschäftigen sich mit der Frage, warum wir mit unseren Bauchgefühlen und Intuitionen so oft falsch liegen. Rosling beweist das nicht nur besonders anschaulich, sondern zeigt unsere Fehleinschätzungen der Realität besonders plakativ und überraschend zugleich. Dabei war Rosling nicht Psychologe oder Soziologe oder gar Philosoph, sondern kam aus der Medizin. Genau dort stieß er jedoch auf Hinweise, dass wir mit unseren Einschätzungen und Urteilen weit unter Zufallsergebnissen liegen. Und sogar schlechter in Fragenkatalogen zu medizinischen, politischen und sozialen Themen abschneiden als eine Horde Schimpansen. Das führt er auf einige, wie er sie nennt, Instinkte in unserem Denken zurück. Wie der Instinkt der Dringlichkeit. Deshalb dieses Buch lesen! Sofort! Ehe es zu spät ist!!!
Wahrscheinlich ist es eher selten, dass ich mit Bill Gates und Barack Obama einer Meinung bin. Was dieses Buch angeht dann aber schon. Beide bezeichnen es als ein sehr lesenswertes und inspirierendes Buch. Es geht um unser Denken und unsere Vorstellung der Wirklichkeit. Wobei das Thema an sich für mich nicht ganz so neu war, denn auch die Bücher von Gerd Gigerenzer und Daniel Kahneman beschäftigen sich mit der Frage, warum wir mit unseren Bauchgefühlen und Intuitionen so oft falsch liegen. Rosling beweist das nicht nur besonders anschaulich, sondern zeigt unsere Fehleinschätzungen der Realität besonders plakativ und überraschend zugleich. Dabei war Rosling nicht Psychologe oder Soziologe oder gar Philosoph, sondern kam aus der Medizin. Genau dort stieß er jedoch auf Hinweise, dass wir mit unseren Einschätzungen und Urteilen weit unter Zufallsergebnissen liegen. Und sogar schlechter in Fragenkatalogen zu medizinischen, politischen und sozialen Themen abschneiden als eine Horde Schimpansen. Das führt er auf einige, wie er sie nennt, Instinkte in unserem Denken zurück. Wie der Instinkt der Dringlichkeit. Deshalb dieses Buch lesen! Sofort! Ehe es zu spät ist!!!
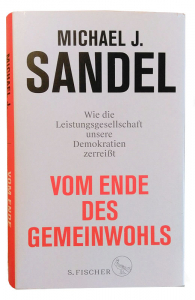 Mit ins Deutsche übersetzten Büchern amerikanischer Autoren tue ich mich manchmal schwer. Es sei denn, es geht um Musiktheorie oder Physik. Zu unterschiedlich sind, trotz aller politischen und wirtschaftlichen Parallelen, Werte und soziale Normen in Deutschland und den USA. Auch Michael J. Sandels Buch über das Ende des Gemeinwohls fußt auf amerikanischen Verhältnissen und der amerikanischen Geschichte. Besonders in diesem Fall den Verhältnissen an Universitäten und der Gesellschaft jenseits des Atlantiks. So konzentriert sich Sandel auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Machtverhältnisse und wirtschaftlichen Lage in seinem Land. Also zuerst gesehen fern der bundesdeutschen Realität, könnte man meinen. Doch es täuscht. Sandel liefert eine gelegentlich etwas abgehobene, detailverliebte und dann wieder sehr feinsinnige Analyse, warum Brexit, Donald Trump und Rechtpopulismus weltweit solche Siegeszüge antreten konnten. Oder wie der Spruch lautet, dass die Entwicklungen in Deutschland denen in den USA nur um zehn Jahre hinterher hinken. Da ist etwas dran.
Mit ins Deutsche übersetzten Büchern amerikanischer Autoren tue ich mich manchmal schwer. Es sei denn, es geht um Musiktheorie oder Physik. Zu unterschiedlich sind, trotz aller politischen und wirtschaftlichen Parallelen, Werte und soziale Normen in Deutschland und den USA. Auch Michael J. Sandels Buch über das Ende des Gemeinwohls fußt auf amerikanischen Verhältnissen und der amerikanischen Geschichte. Besonders in diesem Fall den Verhältnissen an Universitäten und der Gesellschaft jenseits des Atlantiks. So konzentriert sich Sandel auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Machtverhältnisse und wirtschaftlichen Lage in seinem Land. Also zuerst gesehen fern der bundesdeutschen Realität, könnte man meinen. Doch es täuscht. Sandel liefert eine gelegentlich etwas abgehobene, detailverliebte und dann wieder sehr feinsinnige Analyse, warum Brexit, Donald Trump und Rechtpopulismus weltweit solche Siegeszüge antreten konnten. Oder wie der Spruch lautet, dass die Entwicklungen in Deutschland denen in den USA nur um zehn Jahre hinterher hinken. Da ist etwas dran.
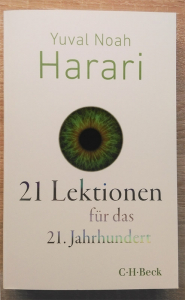 Der Mittelteil seiner Trilogie Eine kurze Geschichte der Menschheit, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. Während der erste Teil auf die Entstehung des Homo Sapiens zurückblickt und der letzte in die ferne Zukunft unserer Spezies voraus, geht Harari hier in die nahe Zukunft des Menschen. Wie er das tut, ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht revolutionär. Er nimmt sich 21 Stichwörter in fünf Bereichen oder Kapiteln und, nun ja, philosophiert darüber. Wofür stehen Menschen bei diesen Begriffen und was wird daraus in der nächsten Zeit werden? Welche Rolle spielen sie aktuell und welche in der nahen Zukunft? Das sind Begriffe wie Desillusionierung, Gleichheit, Religion, Demut oder Postfaktisch. In diesem Sinne tendiert das Buch eher in eine philosophische Richtung als in eine historische, anstatt Sachbuch oder Analyse zu sein. So steht eine Prognose im Vordergrund, noch mehr eine Reflektion, trotz des Blicks in die Zukunft. Mal wieder ein sperriges Buch von Harari, nix für die Sonnenliege auf Malle. Trotzdem klug, faszinierend und erhellend. Ein Buch, dem es gelingt, einen auf eigene Gedanken zu bringen.
Der Mittelteil seiner Trilogie Eine kurze Geschichte der Menschheit, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. Während der erste Teil auf die Entstehung des Homo Sapiens zurückblickt und der letzte in die ferne Zukunft unserer Spezies voraus, geht Harari hier in die nahe Zukunft des Menschen. Wie er das tut, ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht revolutionär. Er nimmt sich 21 Stichwörter in fünf Bereichen oder Kapiteln und, nun ja, philosophiert darüber. Wofür stehen Menschen bei diesen Begriffen und was wird daraus in der nächsten Zeit werden? Welche Rolle spielen sie aktuell und welche in der nahen Zukunft? Das sind Begriffe wie Desillusionierung, Gleichheit, Religion, Demut oder Postfaktisch. In diesem Sinne tendiert das Buch eher in eine philosophische Richtung als in eine historische, anstatt Sachbuch oder Analyse zu sein. So steht eine Prognose im Vordergrund, noch mehr eine Reflektion, trotz des Blicks in die Zukunft. Mal wieder ein sperriges Buch von Harari, nix für die Sonnenliege auf Malle. Trotzdem klug, faszinierend und erhellend. Ein Buch, dem es gelingt, einen auf eigene Gedanken zu bringen.
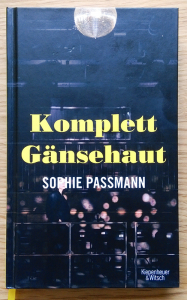 Als ich 27 war, wohnte ich noch in der gleichen Stadt, in der ich geboren wurde. In der ich die Volksschule und die Fachoberschule besuchte. Und doch waren die drei Welten ganz verschiedene. Sogar das heutige Berlin hat mit meinem Berlin aus den Achtzigern nicht mehr viel zu tun. Selbst Kreuzberg nicht. Aber so ist es einmal eine andere Welt, wenn man 38 Jahre älter ist als Sophie Passmann. Ich weiß nicht einmal genau, wie ich an dieses Buch gekommen bin, könnte eine Leseempfehlung in der Psychologie Heute gewesen sein. Solche Bücher lese ich, wenn ich mehr über sie weiß, meistens nicht. Meistens. In diesem Fall war ich froh, das Buch in der Buchhandlung meines Vertrauens geordert zu haben, die nicht mit A anfängt, sondern mit M.
Als ich 27 war, wohnte ich noch in der gleichen Stadt, in der ich geboren wurde. In der ich die Volksschule und die Fachoberschule besuchte. Und doch waren die drei Welten ganz verschiedene. Sogar das heutige Berlin hat mit meinem Berlin aus den Achtzigern nicht mehr viel zu tun. Selbst Kreuzberg nicht. Aber so ist es einmal eine andere Welt, wenn man 38 Jahre älter ist als Sophie Passmann. Ich weiß nicht einmal genau, wie ich an dieses Buch gekommen bin, könnte eine Leseempfehlung in der Psychologie Heute gewesen sein. Solche Bücher lese ich, wenn ich mehr über sie weiß, meistens nicht. Meistens. In diesem Fall war ich froh, das Buch in der Buchhandlung meines Vertrauens geordert zu haben, die nicht mit A anfängt, sondern mit M.
Das Buch ist kein Sachbuch, es ist kein Roman, nicht mal ein Essay. Es ist ein Buch, in dem die Autorin in ihrer neuen schönen Wohnung sitzt und sich fragt, was sie und ihre Generation denn wohl besser gemacht haben als Eltern. Von Großeltern ganz abgesehen. Ob sie wirklich die ihr angedachten Chancen genutzt, die Digitalisierung gewinnbringend eingesetzt haben und überhaupt klüger waren, als sie es ihren Eltern zustanden. So gesehen ist es eine niedergeschriebene Reflektion, öffentlich zugänglich gemacht. Das klingt nach nicht viel. Aber manchmal ist weniger mehr.
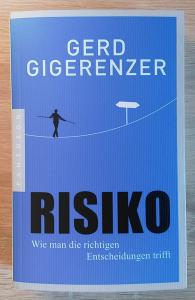 Bestimmt haben Sie auf Ihrem Smartphone auch eine Wetter-App. Neben der Wetterprognose wird dort eine sogenannte Regenwahrscheinlichkeit angegeben, nämlich in Prozent. Aber was sagt die Zahl 40% aus? Dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen wird? Oder dass die Meteorologen zu 40% mit ihren Voraussagen richtig lagen? In Wikipedia liest sich das so: "Eine prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit für den 1. November von 100 % für die Stadt Wuppertal bedeutet, dass es bei vergleichbaren Wetterlagen (Luftdruck, Windrichtung, Luftmassen usw.) in der Vergangenheit immer irgendwo in Wuppertal geregnet hat, so dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch am 1. November im Stadtgebiet regnen wird. Daraus lässt sich demnach nicht ableiten, dass es den ganzen Tag (100 % des Zeitraumes) regnen wird oder dass es überall in Wuppertal regnen wird (100 % des Vorhersagegebietes).". Heißt, dass die Voraussage für Bielefeld in Paderborn wenig hilft. Selbst in Bielefeld ist sie schwer zu verstehen. Damit eigentlich nutzlos.
Bestimmt haben Sie auf Ihrem Smartphone auch eine Wetter-App. Neben der Wetterprognose wird dort eine sogenannte Regenwahrscheinlichkeit angegeben, nämlich in Prozent. Aber was sagt die Zahl 40% aus? Dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen wird? Oder dass die Meteorologen zu 40% mit ihren Voraussagen richtig lagen? In Wikipedia liest sich das so: "Eine prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit für den 1. November von 100 % für die Stadt Wuppertal bedeutet, dass es bei vergleichbaren Wetterlagen (Luftdruck, Windrichtung, Luftmassen usw.) in der Vergangenheit immer irgendwo in Wuppertal geregnet hat, so dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch am 1. November im Stadtgebiet regnen wird. Daraus lässt sich demnach nicht ableiten, dass es den ganzen Tag (100 % des Zeitraumes) regnen wird oder dass es überall in Wuppertal regnen wird (100 % des Vorhersagegebietes).". Heißt, dass die Voraussage für Bielefeld in Paderborn wenig hilft. Selbst in Bielefeld ist sie schwer zu verstehen. Damit eigentlich nutzlos.
Anderes Beispiel für die Verwirrung durch Zahlen. Als in Großbritannien die dritte Generation der Antibabypille eingeführt wurde, berichtete der britische Gesundheitsdienst, dass sich mit diesem neuen Medikament die Zahl der Thrombosefälle gegenüber der Vorversion verdoppelt habe. Genauer um 100% gestiegen sei sie. In absoluten Zahlen gab es zuvor bei 1.000 Frauen, die sie nahmen, einen Thrombosefall. Mit der dritten Pillengeneration waren es nun zwei. Bei wieder 1.000 Frauen. Dafür stieg in Großbritannien zu dieser Zeit die Zahl an Abtreibungen und ungewollten Schwangerschaften erheblich. Weil viele Frauen durch die genannten Zahlen abgeschreckt wurden. Gegen dieses Unwissen über und Unverständnis für tatsächliche oder vermutete Risiken schreibt Gerd Gigerenzer an. Und liefert damit ein faszinierendes Buch.
Obwohl ich Jürgen Wiebickes Buch nun schon länger abgeschlossen habe, wirkt die Geschichte in mir nach. Einmal, weil es viele Parallelen gibt, Wiebicke ist Jahrgang 1962, ich bin Jahrgang 1956. Auch meine Mutter ist die vorletzte Person in meiner Familie, die noch den letzten Krieg selbst erlebt hat, zu meiner Tante, Witwe des Bruders meiner Mutter, habe ich keinen Kontakt mehr. So wie Wiebicke seinen tief roten, sozialdemokratischen Opa hatte, der trotzdem für aus seiner Sicht schlechte Menschen den Begriff "Jüd" verwendete, gab es bei mir Onkel Heini, Bruder meiner Großmutter, der noch bis zu seinem Tod in den Achtzigern den überzeugten Nazi heraushängen ließ. Seine Tochter schwärmte von den tollen Zeiten im BDM (Bund deutscher Mädchen), Jude und Neger waren noch übliche Schmähungen in dieser Zeit. Das, was Wiebicke als Nazigift bezeichnet, war genau so in meine Familie tief eingedrungen, war ein Teil der DNA geworden. Dazwischen ich, die Pubertät gerade hinter mir, politisch weit links und bereits Teil der beginnenden Globalisierung. Nicht mehr lange und ich sollte in den USA, in Australien und England arbeiten und leben, wenigstens einige Zeit. So wie Wiebicke rücke ich beim Ableben meiner Mutter, 1933 geboren, ein Kästchen weiter nach vorn. Dann bin ich der Älteste in der Familie. Und der Letzte, der wenigstens noch von Zeitzeugen unmittelbar etwas über den Krieg gehört hat. Die Welt mit seiner Mutter, die Erzählungen über Bombenangriffe, Bunkernächte und die unbesiegbare Angst, kenne ich wie Wiebicke von seiner Mutter gut. Und doch ist es nicht das allein, was nachwirkt.
 Das Attribut 'berührend' verwende ich für Bücher nur sehr spärlich. Das einzige Buch, dem ich es nach meiner Erinnerung zugestanden habe, war das Buch «Nur noch eine Tür» von Uwe Schulz. Nun ist ein weiteres Buch dazu gekommen. Es stammt von Jürgen Wiebicke, freier Journalist, Autor, Philosoph, Moderator bei WDR5 für Das Philosophische Radio, aber auch das Tagesgespräch oder Neugier genügt. Dazu am philosophischen Festival phil.COLOGNE beteiligt. Nun könnte man annehmen, dass das Thema Sterben und Tod immer irgendwie berührend sei, schon wegen der Unumgänglichkeit für uns selbst. Aber das ist es nicht, der reale Tod nimmt hier nur in der Vergangenheit einen Platz ein, beim Tod des Vaters oder des Großvaters. Es geht ihm um etwas Anderes. Als Wiebicke klar wird, dass seine Mutter nicht mehr lange zu leben hat, beginnt er zu dokumentieren, was die Erlebnisse, Erfahrungen und Geheimnisse dieser Kriegsgeneration sind, von der seine Mutter in seiner Familie die vorletzte Vertreterin ist. Woher das häufige Schweigen kommt, über diese Zeit, welche Dinge nicht in die Öffentlichkeit sollten, was von den Geschehnissen der Zeit ab 1933 bis 1945 übrig blieb. Herausgekommen ist ein Buch, das um so nachdenklicher stimmt, je enger der zeitliche Horizont des Lesers ist. Oder, wie Wiebicke es formuliert, dass man selbst mit dem Tod der Eltern ein Kästchen weiter nach vorne rückt.
Das Attribut 'berührend' verwende ich für Bücher nur sehr spärlich. Das einzige Buch, dem ich es nach meiner Erinnerung zugestanden habe, war das Buch «Nur noch eine Tür» von Uwe Schulz. Nun ist ein weiteres Buch dazu gekommen. Es stammt von Jürgen Wiebicke, freier Journalist, Autor, Philosoph, Moderator bei WDR5 für Das Philosophische Radio, aber auch das Tagesgespräch oder Neugier genügt. Dazu am philosophischen Festival phil.COLOGNE beteiligt. Nun könnte man annehmen, dass das Thema Sterben und Tod immer irgendwie berührend sei, schon wegen der Unumgänglichkeit für uns selbst. Aber das ist es nicht, der reale Tod nimmt hier nur in der Vergangenheit einen Platz ein, beim Tod des Vaters oder des Großvaters. Es geht ihm um etwas Anderes. Als Wiebicke klar wird, dass seine Mutter nicht mehr lange zu leben hat, beginnt er zu dokumentieren, was die Erlebnisse, Erfahrungen und Geheimnisse dieser Kriegsgeneration sind, von der seine Mutter in seiner Familie die vorletzte Vertreterin ist. Woher das häufige Schweigen kommt, über diese Zeit, welche Dinge nicht in die Öffentlichkeit sollten, was von den Geschehnissen der Zeit ab 1933 bis 1945 übrig blieb. Herausgekommen ist ein Buch, das um so nachdenklicher stimmt, je enger der zeitliche Horizont des Lesers ist. Oder, wie Wiebicke es formuliert, dass man selbst mit dem Tod der Eltern ein Kästchen weiter nach vorne rückt.
Die Sicht der Autorin ist eine spezielle. Caroline Fourest ist eine französische feministische Schriftstellerin und Journalistin. Daher öffnet sich ihr Blick auf ihr Thema aus einer künstlerischen Sicht, auf Theater und Film, Literatur und Weltgeschehen. Da gibt es ein Mordsgezeter, weil eine weiße, niederländische Frau ein Gedicht der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten übersetzen soll. Das Original von einer schwarzen Frau geschrieben. Das ginge nicht, weil die Niederländerin ja eben nicht schwarz, sondern weiß sei. Scarlett Johansson wurde abgesprochen, in einem Film eine transsexuelle Person zu spielen, weil sie eben nicht transsexuell sei und weil ihr deshalb das Thema nicht zustehe. Ein weißer Pop-Musiker erntet einen riesigen Shitstorm, weil er zu einer Preisverleihung in einem dem indonesischen Raum zugeordneten Kleidungsstück erscheint. Genauer: einer Hose. Parallel zu den Tiraden vom rechten Rand des politischen Spektrums macht sich eine merkwürdige Identitätspolitik von links breit. Die sich von dem Gerede über Heimat und Identität kaum unterscheidet. Es folgen eine ganze Reihe von konkreten Beispielen, wo jemandem angeblich Dinge nicht zustehen, weil er nicht zu dieser Identität gehört. Eine Uni-Mensa muss vietnamesische Gerichte von der Karte nehmen, weil sie nicht das Original seien. Als wenn nur jemand eine Pizza zubereiten dürfte, wenn er gebürtiger Italiener sei. Der Wahnsinn scheint geradezu Methode zu haben. Doch er weist auf beunruhigende Entwicklungen hin.
Wenn wir nicht zurück kehren zu einer Empathie für die Natur, haben wir keine Chance, den ökologischen Kollaps zu verhindern. Schreibt der Internist, Psychiater und psychosomatische Mediziner Joachim Bauer in seinem Buch Fühlen, was die Welt fühlt aus 2020. Er ist emeritierter Universitätsprofessor an der Universität Freiburg, im Bereich Psychoneuroimmunologie tätig. Mit der Vernunft allein kämen wir nicht weiter, es brauche viel mehr einen "Empathischen Impuls". Das klingt erst einmal ein wenig esoterisch, aber Bauer ist Wissenschaftler, kein Heiler mit dem Pendel. Jedoch versucht Bauer zu ergründen, warum es so weit gekommen ist, dass der Mensch sich quasi den Ast absägt, auf dem er sitzt. Er führt es auf einen Verlust einer emotionalen Bindung zwischen Mensch und Natur zurück. Entstanden sei dieser Bruch zu einem sehr lange zurück liegenden Zeitpunkt, nämlich mit der neolithischen Revolution, dem Sesshaftwerden des Menschen vor rund 12.000 Jahren. Während der Mensch als Jäger und Sammler in einer holistischen, ganzheitlichen Welt lebte, wurde die Natur mit Ackerbau und Viehzucht zu einem Gebrauchsobjekt. Bei indigenen Völkern, die es zum Glück noch gibt, ist diese Einheit, diese Beziehung zur Natur noch zu finden. Aber warum haben die Menschen sie mit dem Übergang zur Landwirtschaft verloren?
Will man ihre Botschaft in einem Satz zusammen fassen, würde der lauten: Wir können so nicht weiter machen. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich in den letzten 30 Jahren die Welt grundlegend verändert. Der Westen, allen voran die USA, betrachtet sich als Sieger im Wettlauf um die bessere Gesellschaftsform und verhält sich dementsprechend. Die Globalisierung hat Ausmaße angenommen, die vor 30 Jahren noch nicht vorstellbar waren. Unternehmen sind unabhängig von Staaten geworden, sie lassen sich dort nieder, wo der maximale Gewinn lockt. Es geht uns auf der Nordhalbkugel richtig gut. Aber das Wohlstandsmodell hat seinen Preis, Umweltschäden und Klimawandel bedrohen unsere Zukunft, Demokratien drohen zu zerfallen. Doch "der Markt" und die Politik verkünden immer nur eine Richtung. Weiter machen wie bisher, bloß nichts verändern, bloß nicht verzichten. Stattdessen immer mehr, niemals weniger. Jedes sechste online gekaufte Paket geht zurück. Scheinbar kostenlos. Auch wenn es die kleinen Anbieter ruiniert. Scheinbar, weil niemand die Energie und Arbeit für den Rücktransport einrechnet. Vom zusätzlichen CO2 ganz zu schweigen. Wie bei den billigen Flugtickets, um den entstehenden Müll soll sich jemand anders kümmern. Das nennt man externalisierte Kosten.
Maja Göpel ist Politökonomin, Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Wissenschaftliche Direktorin der 2020 in Hamburg gegründeten Denkfabrik The New Institute. Hat eine Honorarprofessur an der Leuphana Universität Lüneburg. Ihr Buch Unsere Welt neu denken gibt es schon länger, bei mir ist es in der Auflage von 2021 gelandet, wohl weitgehend gegenüber früheren Auflagen überarbeitet. Es ist eine radikale Abrechnung mit einem ausufernden Lebensstil, der die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen arm und reich, globalem Norden und Süden, Umwelt und Konsum nur weiter verstärkt. Statt zu einem nachhaltigen Wirtschaften zu kommen, Umwelt und Gesellschaft zu schonen, wird der Wahnsinn des westlichen Verbrauchs an Ressourcen nur immer weiter gesteigert. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber Maja Göpel setzt die Zusammenhänge neu zusammen. Und fordert ein radikales Umdenken.
Seit ich meine Bücher nicht mehr beim großen A bestelle, sondern im Online-Shop der kleinen Buchhandlung in der nahen Kleinstadt, nutze ich auch die Möglichkeit, bestimmten Autoren zu folgen. Damit ich ihre neusten Veröffentlichungen mitbekomme. So sah ich auch Ende 2020 das neue Buch von Bernhard Pörksen, Schöne digitale Welt, was es direkt auf die Wunschliste des Online-Shops brachte. Erst beim Abholen wurde klar, dass Pörksen und Narr nur Herausgeber waren, nicht Autoren in eigentlichen Sinne. Stattdessen ist das Buch eine Zusammenstellung von Reden und Essays diverser wohlbekannter Leute, zuvorderst für mich Sascha Lobo, Ranga Yogeshwar und Miriam Meckel. Also keine neuen Gedanken des Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen, der den Begriff der Erregungsgesellschaft geprägt hat, sondern die von Leuten, denen bei der Betrachtung der aktuellen Gesellschaftslage einige Kompetenz zugesprochen werden kann. Spoiler vorweg: keine brandneuen Erkenntnisse, keine Lösung der dringendsten Fragen und Schwierigkeiten. Aber dafür eine breit angelegte Zusammenfassung des Status Quo. Was auch keine leichte Aufgabe ist.
Nach den ersten Seiten hatte ich die Befürchtung, zu einem Ratgeber gegriffen zu haben. Was sich spätestens ab der vierten oder fünften Seite erledigte. Hätte ich mir bei Michael Winterhoff, einem der bekanntesten Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten, auch nicht vorstellen können. Schließlich hatte ich mir das Buch ja nicht wegen eines eigenen Gefühls gekauft, sondern wegen des Klappentextes. Was ist dran, an der breit gestreuten Ermüdung und Überforderung, dem Gefühl des Dauerstresses, der zunehmenden Zahl an diagnostizierten Burnouts und der Ruhelosigkeit? Und was ist dran an den Klagen von Lehr- und Kindergartenpersonal über Helikoptereltern, völlig überzogene Forderungen an Schule und KiTa? Als gut beschäftigter Psychiater, der diese Kinder, und natürlich deren Eltern, tagtäglich in seiner Praxis hat, sollte er etwas dazu sagen können, ob sich die Rollen zwischen Eltern und Kindern so stark geändert haben. Beobachten kann ich es selbst, wenn die engen Straßen in meinem Dorf kurz vor acht komplett verstopft sind, weil Horden von Eltern ihre fast zehnjährigen Kinder mit riesigen SUVs fast noch mittig auf dem Schulhof abliefern. Da hat sich schon etwas verändert, doch die Palette an Veränderung ist breit, weshalb Winterhoffs Analysen nicht gerade einfach sind. Und seine Ratschläge für Abhilfe werden einige Leser enttäuschen.
Als im Sommer 2020 absehbar wurde, dass ich von meinem Job die Nase voll hatte und zum Jahreswechsel Rente beantragen würde, kam schnell ein Gedanke auf. Nämlich der, Niedersachsen wieder zu verlassen und in meine alte Heimat Ostwestfalen zurück zu kehren. So klebte ich zwei DIN A4-Blätter zusammen, bildete eine Matrix aus Argumenten wie kulturelles Angebot, Freizeitmöglichkeiten, Wandermöglichkeiten, Kontakt zu Freunden und Familie, Mietspiegel und vieles mehr. Nachdem eine lange Liste zusammen gekommen war, die jeweiligen Aspekte sortiert und bewertet waren, saß ich eher hilflos vor der Sammlung. Irgendwie spiegelte diese Aktion nicht wirklich das wider, worum es mir ging. So knüllte ich das Papier zusammen, warf es in den Papierkorb und setzte in ImmobilienScout24.de eine Suchanzeige nach Mietwohnungen in der Umgebung von Paderborn auf. Was hatte die Entscheidung nun tatsächlich zu Stande gebracht?
Noch ein Buch übers Essen. Also etwas Ähnliches wie dieses hier, aber aus einer anderen Perspektive. Was macht man, wenn ein Markt völlig gesättigt ist, wie steigert man trotzdem noch seine Umsätze? Das erste Semester in Marketing lehrt als Antwort, dass man dem Mitbewerb Kunden abspenstig machen muss. Oder neue Märkte schaffen. Genau so machen das Nestlé, PepsiCo oder Dr. Oetker. Davon, wie die Lebensmittelkonzerne ihre Umsätze immer noch steigern, dazu den Verbraucher täuschen und belügen, schummeln und tricksen, darum geht es im Buch von Thilo Bode, Mitbegründer der Organisation foodwatch. Ganz neu ist das Buch nicht, es stammt aus 2010, doch die Methoden der Essensfälscher sind immer noch die gleichen, leider. Mit solchen zuständigen Leuten wie Julia Klöckner, aktuell Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, die es schafft, alle Veränderungen zugunsten der Konsumenten zu verhindern, wird das noch lange so bleiben. Die erfolgreich unterstützt, dass uns die Lebensmittelproduzenten mit noch mehr Zucker, noch mehr Aromen und Geschmacksverstärkern bei der Stange halten. Genau gegen diese offene und versteckte Lobby schreibt Thilo Bode an. Man kann es plakativ nennen, oder ehrlich.
Ich habe mich immer für einen kritischen Esser und Verbraucher gehalten. Aber dieses Buch hat mir noch einmal gezeigt, dass mein Wissen über Lebensmittel und Essen überhaupt noch lange nicht belastbar ist. Eigentlich kenne ich Manfred Kriener aus einer anderen Ecke, nämlich als Gründer der Tageszeitung taz. Beschäftigt sich vor allem mit Umwelt und Umweltpolitik wie auch mit Ernährungsthemen. Dieses Buch aus 2020 will aber nicht der nächste Ratgeber sein, der uns sagt, was wir noch essen dürfen und was nicht, was gut und was falsch ist. Kriener will Wissen über unser Essen vermitteln, wo es herkommt, wie es entsteht, welche Wirkungen es hat, dass wir Produkte nutzen oder nicht. Moralische Aspekte im Sinne der Biogeneration bleiben außen vor. Stattdessen geht es um Fakten, Daten und Informationen. Man weiß bei vielen Dingen nicht, was einem da aufgetischt wird. Das will Kriener ändern, das schafft er sogar unterhaltsam. Trotzdem vergeht einem manchmal der Appetit. Nur wegen der Faktenlage.