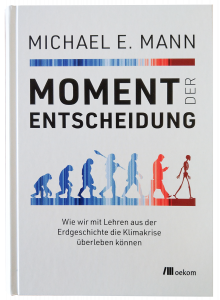 Klimawandel hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Im Extrem sogar in der Hinsicht, dass die Erde nach ihrer Entstehung zwei Milliarden Jahre lang nicht einmal eine Sauerstoff-Atmosphäre hatte. Doch nicht alle Klimaveränderungen waren naturgegeben. Mit dem Auftreten von Leben gab es nun nicht nur eine Wechselwirkung zwischen Erde und Leben, sondern auch umgekehrt. Immer aber über Jahrtausende. Nun gibt es sogar Anhaltspunkte, dass schon vor 6.000 Jahren der Mensch das Klima beeinflusste, als er weiträumig Landschaft gestaltete und Wälder abholzte. Doch so gravierend wie in den letzten zweihundert Jahren hat sich das Klima noch nie verändert. Michael E. Mann führt durch die Erdgeschichte, wie extrem und häufig sich das Klima auf diesem Planeten verändert hat, es gab sogar Phasen, in denen die Erde deutlich wärmer war als heute. Genauso wie Zeiten, in denen die Erde eine Schnee- und Eiskugel war. Fast alle Entwicklungen des Klimas lassen sich heute sehr gut erklären. Leider auch der aktuelle Klimawandel. Es geht also um die heutigen Klimaveränderungen, die der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energiequellen herbei führt. Zugleich hilft das Verstehen bisheriger Klimaveränderungen, wie wir aus der jetzigen Bredouille wieder heraus kommen. Oder wenigstens das Schlimmste verhindern.
Klimawandel hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Im Extrem sogar in der Hinsicht, dass die Erde nach ihrer Entstehung zwei Milliarden Jahre lang nicht einmal eine Sauerstoff-Atmosphäre hatte. Doch nicht alle Klimaveränderungen waren naturgegeben. Mit dem Auftreten von Leben gab es nun nicht nur eine Wechselwirkung zwischen Erde und Leben, sondern auch umgekehrt. Immer aber über Jahrtausende. Nun gibt es sogar Anhaltspunkte, dass schon vor 6.000 Jahren der Mensch das Klima beeinflusste, als er weiträumig Landschaft gestaltete und Wälder abholzte. Doch so gravierend wie in den letzten zweihundert Jahren hat sich das Klima noch nie verändert. Michael E. Mann führt durch die Erdgeschichte, wie extrem und häufig sich das Klima auf diesem Planeten verändert hat, es gab sogar Phasen, in denen die Erde deutlich wärmer war als heute. Genauso wie Zeiten, in denen die Erde eine Schnee- und Eiskugel war. Fast alle Entwicklungen des Klimas lassen sich heute sehr gut erklären. Leider auch der aktuelle Klimawandel. Es geht also um die heutigen Klimaveränderungen, die der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energiequellen herbei führt. Zugleich hilft das Verstehen bisheriger Klimaveränderungen, wie wir aus der jetzigen Bredouille wieder heraus kommen. Oder wenigstens das Schlimmste verhindern.
Beiträge
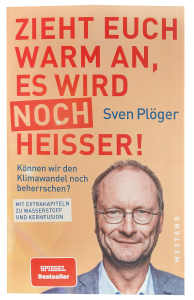 Zuerst dachte ich, dass Sven Plöger einen weiteren Band zum Thema vorgelegt hätte. Tatsächlich ist es eine Neuauflage und Erweiterung seines Buches aus 2020. Daher gilt die Rezension aus diesem Jahr unverändert weiter. Plöger hat das Buch erheblich erweitert und aktualisiert, sowohl hinsichtlich Zahlen und Daten, neuen Erkenntnissen über den Klimawandel, zwei ganz neue Kapitel sind hinzu gekommen, wie auf dem Einband zu lesen. Was sich nicht geändert hat: Welche drastischen Folgen der Klimawandel für die Welt und die Menschen nach sich zieht, wie wenig wir inzwischen getan haben, um ihn aufzuhalten. Wohltuend noch immer die nüchterne, anschauliche und faktenbasierte Art zu schreiben. Fast alle Kapitel sind erheblich umfangreicher geworden, wodurch diese Ausgabe deutlich dicker geworden ist als die erste. Die vielleicht wichtigste Botschaft Plögers ist die, dass Klima, Wetter und die Welt insgesamt ein so komplexes und unvorhersagbares System sind, dass es oft schwer fällt zu sehen, was wann und warum geschieht. Warum Winde im Westen der USA das Wetter in Indien beeinflussen. Dass die langanhaltenden Tiefs über uns, mit Unwettern und Wetteranomalien, kein Zufall sind und wie das mit den Jetstreams zusammen hängt. Es ist kein wissenschaftliches Buch, aber perfekt für alle Leute, die verstehen wollen, was Wetter und Klima sind und wie sie zusammen gehen. Auch wenn "nur" eine neue Ausgabe, ein beeindruckendes, wenn nicht beängstigendes Buch.
Zuerst dachte ich, dass Sven Plöger einen weiteren Band zum Thema vorgelegt hätte. Tatsächlich ist es eine Neuauflage und Erweiterung seines Buches aus 2020. Daher gilt die Rezension aus diesem Jahr unverändert weiter. Plöger hat das Buch erheblich erweitert und aktualisiert, sowohl hinsichtlich Zahlen und Daten, neuen Erkenntnissen über den Klimawandel, zwei ganz neue Kapitel sind hinzu gekommen, wie auf dem Einband zu lesen. Was sich nicht geändert hat: Welche drastischen Folgen der Klimawandel für die Welt und die Menschen nach sich zieht, wie wenig wir inzwischen getan haben, um ihn aufzuhalten. Wohltuend noch immer die nüchterne, anschauliche und faktenbasierte Art zu schreiben. Fast alle Kapitel sind erheblich umfangreicher geworden, wodurch diese Ausgabe deutlich dicker geworden ist als die erste. Die vielleicht wichtigste Botschaft Plögers ist die, dass Klima, Wetter und die Welt insgesamt ein so komplexes und unvorhersagbares System sind, dass es oft schwer fällt zu sehen, was wann und warum geschieht. Warum Winde im Westen der USA das Wetter in Indien beeinflussen. Dass die langanhaltenden Tiefs über uns, mit Unwettern und Wetteranomalien, kein Zufall sind und wie das mit den Jetstreams zusammen hängt. Es ist kein wissenschaftliches Buch, aber perfekt für alle Leute, die verstehen wollen, was Wetter und Klima sind und wie sie zusammen gehen. Auch wenn "nur" eine neue Ausgabe, ein beeindruckendes, wenn nicht beängstigendes Buch.
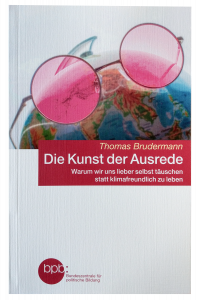 Auf einer Familienfreier kam irgendwann das Thema Klimawandel, Kohlendioxid-Emissionen und Autos. Ein Verwandter meinte dazu im Brustton der Überzeugung: "So lange die Chinesen nix machen, mache ich auch nix!". Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen, dass er einen sehr fleischzentrierten Ernährungsstil pflegt, was an seinem enormen Bauchumfang abzulesen ist. Doch es gibt noch mehr Ausreden. Es sei schon zu spät, der Einzelne könne doch nichts machen, die Erde hätte schon immer Warm- und Kaltzeiten gehabt, oder man sei doch schon klimafreundlich, da komme es mal auf einen einzelnen Flug in den Urlaub doch nicht an. Thomas Brudermann beschäftigt sich mit den Ausredevarianten im Wesentlichen aus Sicht der Verhaltensökonomie und Umweltpsychologie, zwei noch recht jungen Wissenschaftsgebieten. Speziell geht es darum, welche inneren Vorgänge hinter den Ausreden stehen, was die Fakten sind und wie man diesen Ausreden begegnet. In vielen Fällen sind Bequemlichkeit, Verlustängste, Status und schlichtweg Unwissenheit die Hintergründe. Doch es gibt auch einige andere Gründe zum Leugnen des Klimawandels, damit hat mal wieder der Neoliberalismus und der unerschütterliche Glaube an die Märkte zu tun.
Auf einer Familienfreier kam irgendwann das Thema Klimawandel, Kohlendioxid-Emissionen und Autos. Ein Verwandter meinte dazu im Brustton der Überzeugung: "So lange die Chinesen nix machen, mache ich auch nix!". Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen, dass er einen sehr fleischzentrierten Ernährungsstil pflegt, was an seinem enormen Bauchumfang abzulesen ist. Doch es gibt noch mehr Ausreden. Es sei schon zu spät, der Einzelne könne doch nichts machen, die Erde hätte schon immer Warm- und Kaltzeiten gehabt, oder man sei doch schon klimafreundlich, da komme es mal auf einen einzelnen Flug in den Urlaub doch nicht an. Thomas Brudermann beschäftigt sich mit den Ausredevarianten im Wesentlichen aus Sicht der Verhaltensökonomie und Umweltpsychologie, zwei noch recht jungen Wissenschaftsgebieten. Speziell geht es darum, welche inneren Vorgänge hinter den Ausreden stehen, was die Fakten sind und wie man diesen Ausreden begegnet. In vielen Fällen sind Bequemlichkeit, Verlustängste, Status und schlichtweg Unwissenheit die Hintergründe. Doch es gibt auch einige andere Gründe zum Leugnen des Klimawandels, damit hat mal wieder der Neoliberalismus und der unerschütterliche Glaube an die Märkte zu tun.
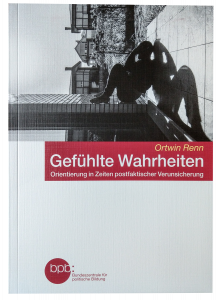 Geht man einmal dreihundert Jahre zurück, sammelten Menschen Erfahrungen und Wissen aus ihrer direkten Umwelt. Was in Haus und Hof funktionierte und was nicht, was stimmte und was nicht. Wir dagegen haben es im Vergleich dazu schwer. Unsere Umwelt ist so komplex und unüberschaubar geworden, dass wir ständig auf die Aussagen und Urteile anderer Leute angewiesen sind. Selbst in den Siebzigern des 20. Jahrhunderts noch interessierte uns im Wesentlichen Deutschland, eventuell noch ein bisschen die USA. Heute landen Vorgänge und Geschehen in Ländern auf der anderen Seite der Welt in Sekundenbruchteilen auf unserem Smartphone. Unmöglich, sich da eine eigene Meinung zu bilden, geschweige denn Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Doch haben nicht wenige Menschen damit ein Problem. Selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, Nachrichten zu überprüfen, wer wollte denn ohne das nötige Fachwissen entscheiden, ob mRNA-Impfstoffe sicher sind, Glyphosat gefährlich oder harmlos, ob sich tatsächlich das Weltklima verändert. Doch wem vertrauen und was bezweifeln? Ortwin Renn kommt aus der Risikoforschung, hat sein Buch in 2022 für die 3. Auflage grundlegend überarbeitet sowie die Erfahrungen mit Corona und Flüchtlingskrise einfließen lassen. Und widmet sich ausgiebig der Frage, warum sich so viele Menschen lieber auf gefühlte Wahrheiten aus sozialen Medien als auf Ergebnisse der Forschung und Ratschläge von Wissenschaftlerinnen und Experten verlassen.
Geht man einmal dreihundert Jahre zurück, sammelten Menschen Erfahrungen und Wissen aus ihrer direkten Umwelt. Was in Haus und Hof funktionierte und was nicht, was stimmte und was nicht. Wir dagegen haben es im Vergleich dazu schwer. Unsere Umwelt ist so komplex und unüberschaubar geworden, dass wir ständig auf die Aussagen und Urteile anderer Leute angewiesen sind. Selbst in den Siebzigern des 20. Jahrhunderts noch interessierte uns im Wesentlichen Deutschland, eventuell noch ein bisschen die USA. Heute landen Vorgänge und Geschehen in Ländern auf der anderen Seite der Welt in Sekundenbruchteilen auf unserem Smartphone. Unmöglich, sich da eine eigene Meinung zu bilden, geschweige denn Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Doch haben nicht wenige Menschen damit ein Problem. Selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, Nachrichten zu überprüfen, wer wollte denn ohne das nötige Fachwissen entscheiden, ob mRNA-Impfstoffe sicher sind, Glyphosat gefährlich oder harmlos, ob sich tatsächlich das Weltklima verändert. Doch wem vertrauen und was bezweifeln? Ortwin Renn kommt aus der Risikoforschung, hat sein Buch in 2022 für die 3. Auflage grundlegend überarbeitet sowie die Erfahrungen mit Corona und Flüchtlingskrise einfließen lassen. Und widmet sich ausgiebig der Frage, warum sich so viele Menschen lieber auf gefühlte Wahrheiten aus sozialen Medien als auf Ergebnisse der Forschung und Ratschläge von Wissenschaftlerinnen und Experten verlassen.
Kaum ein Journalist kann mit dem Namen Wolf Schneider nichts anfangen. In Wikipedia heißt es über ihn:
Von 1995 bis 2012 hielt Wolf Schneider Sprachseminare für Presse und Wirtschaft und war Ausbilder an Journalistenschulen. Er schrieb 28 Sachbücher, darunter Standardwerke wie Deutsch fürs Leben. Was die Schule zu lehren vergaß (1994), Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde (1987), Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil (1982) und Das neue Handbuch des Journalismus. Seit der Ausgabe vom Januar 2012 erscheint Das neue Handbuch des Journalismus unter dem Titel Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus (gemeinsam mit Paul-Josef Raue). Schneider rät zur knappen, aber informationsreichen Schreibweise.
Nun gibt es eine Wolf Schneider KI, die in Schneiders Sinne Texte analysiert oder sogar korrigiert. Ich habe mal einen Absatz aus einer Rezension der KI zur Überprüfung gegeben. So sieht das Ergebnis aus:
| Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen zunehmende Einsamkeit, bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase und eher unerwartet bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Beide Gruppen deshalb, weil bei ihnen starke Veränderung im Lebensverlauf auftreten. Einerseits Eintritt in den Ruhestand, Verlust der Partnerin oder des Partners, Verselbstständigung der Kinder. Dann wieder Studienbeginn, Umzug, Wegbrechen der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden. Das Buch «Einsam in Gesellschaft» mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema Einsamkeit ist zum großen Teil an der TU Dortmund entstanden, durch eine Vortrags- und Diskussionsreihe unter dem Arbeitstitel "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit".
Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz. |
Das Buch "Einsam in Gesellschaft" ist eine Sammlung von Beiträgen zum Thema Einsamkeit, die größtenteils an der TU Dortmund entstanden sind. Es behandelt die zunehmende Einsamkeit bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase sowie bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Diese beiden Gruppen sind besonders betroffen, da sie starke Veränderungen im Lebensverlauf durchmachen. Für ältere Menschen bedeutet dies den Eintritt in den Ruhestand, den Verlust des Partners oder der Partnerin und die Verselbstständigung der Kinder. Für jüngere Menschen wiederum geht es um den Studienbeginn, den Umzug und den Verlust der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden.
Das Buch bietet eine Vielzahl von Beiträgen, die das Thema Einsamkeit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Es reicht von rein wissenschaftlichen Betrachtungen bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Dabei wird deutlich, dass das Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Personen, die mit alleinstehenden oder einsamen Menschen arbeiten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der wissenschaftlichen, insbesondere sozialwissenschaftlichen und psychologischen Betrachtung der Einsamkeit. Dennoch kommen auch praktische Aspekte nicht zu kurz. Insgesamt bietet das Buch eine fundierte und vielseitige Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit. Es liefert sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Einblicke und regt zum Nachdenken an. Die Beiträge sind gut strukturiert und verständlich geschrieben. Die Autoren verwenden klare und präzise Sprache, sodass auch Leser ohne Fachkenntnisse dem Inhalt gut folgen können. Ein positiver Aspekt des Buches ist die Vielfalt der Perspektiven, aus denen das Thema Einsamkeit betrachtet wird. Dies ermöglicht es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Facetten der Einsamkeit zu entwickeln. Die Beiträge sind gut recherchiert und mit konkreten Beispielen untermauert, was ihre Glaubwürdigkeit stärkt. Ein möglicher Kritikpunkt ist, dass das Buch sich hauptsächlich an Fachleute richtet und weniger an Menschen, die selbst von Einsamkeit betroffen sind. Es fehlen konkrete Ratschläge oder Handlungsempfehlungen für Betroffene, die das Buch als Hilfe zur Bewältigung ihrer Einsamkeit nutzen könnten. Insgesamt ist "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit" eine empfehlenswerte Lektüre für Fachleute, die sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen. Es bietet eine fundierte und vielseitige Perspektive auf das Thema und regt zum Nachdenken an. |
Die neue Fassung mag zwar im Sinne von Wolf Schneider lesbarer zu sein, wächst jedoch von 170 Wörtern auf 248 Wörter an. Leider verändert sie auch Sinninhalte.
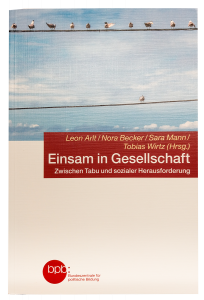 Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen zunehmende Einsamkeit, bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase und eher unerwartet bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Beide Gruppen deshalb, weil bei ihnen starke Veränderung im Lebensverlauf auftreten. Einerseits Eintritt in den Ruhestand, Verlust der Partnerin oder des Partners, Verselbstständigung der Kinder. Dann wieder Studienbeginn, Umzug, Wegbrechen der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden. Das Buch «Einsam in Gesellschaft» mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema Einsamkeit ist zum großen Teil an der TU Dortmund entstanden, durch eine Vortrags- und Diskussionsreihe unter dem Arbeitstitel "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit". Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz.
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen zunehmende Einsamkeit, bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase und eher unerwartet bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Beide Gruppen deshalb, weil bei ihnen starke Veränderung im Lebensverlauf auftreten. Einerseits Eintritt in den Ruhestand, Verlust der Partnerin oder des Partners, Verselbstständigung der Kinder. Dann wieder Studienbeginn, Umzug, Wegbrechen der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden. Das Buch «Einsam in Gesellschaft» mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema Einsamkeit ist zum großen Teil an der TU Dortmund entstanden, durch eine Vortrags- und Diskussionsreihe unter dem Arbeitstitel "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit". Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz.
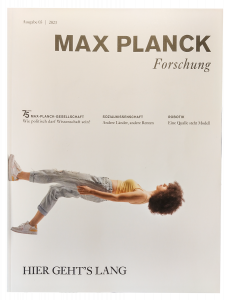 MaxPlanckForschung ist das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft und berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an ihren Instituten aus vielen Gebieten. Von Grundlagen über Medizin und Biologie bis zur Informationstechnik. Es hat den Anspruch, wissenschaftliche Themen allgemeinverständlich aufzubereiten. Die Zielgruppe sind interessierte Laien, Schüler, Lehrer und Journalisten.Veröffentlicht werden Berichte aus den Rubriken: „Zur Sache“, „Physik & Astronomie“, „Biologie & Medizin“, „Material & Technik“, „Umwelt & Klima“ sowie „Kultur und Gesellschaft“. Daneben ist in jeder Ausgabe unter dem Titel „Fokus“ ein Themenschwerpunkt vorhanden. Es erscheint alle drei Monate in deutscher und englischer Sprache. Das Abonnement ist kostenlos, als Print oder Online. Natürlich stehen auch Versionen zum Download bereit.
MaxPlanckForschung ist das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft und berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an ihren Instituten aus vielen Gebieten. Von Grundlagen über Medizin und Biologie bis zur Informationstechnik. Es hat den Anspruch, wissenschaftliche Themen allgemeinverständlich aufzubereiten. Die Zielgruppe sind interessierte Laien, Schüler, Lehrer und Journalisten.Veröffentlicht werden Berichte aus den Rubriken: „Zur Sache“, „Physik & Astronomie“, „Biologie & Medizin“, „Material & Technik“, „Umwelt & Klima“ sowie „Kultur und Gesellschaft“. Daneben ist in jeder Ausgabe unter dem Titel „Fokus“ ein Themenschwerpunkt vorhanden. Es erscheint alle drei Monate in deutscher und englischer Sprache. Das Abonnement ist kostenlos, als Print oder Online. Natürlich stehen auch Versionen zum Download bereit.
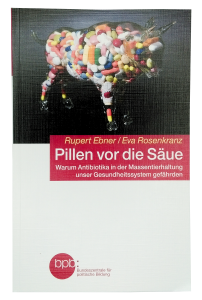 Als das Corona-Virus Anfang 2020 von China aus sich auf die Reise in alle Welt machte, war recht schnell klar, woher es kam: Aus den früher unberührten Urwäldern, die immer mehr von Menschen durchdrungen werden. Doch mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen, die exotische Tierarten als Delikatessen verspeisen, sollten gerade wir Europäer uns sparen. Wir sind seit den Achtzigern fleißig dabei, noch viel gefährlichere Mikroben zu züchten. Nämlich Bakterien, die zunehmend gegen die Wunderwaffe der Medizin, die Antibiotika, resistent werden und über Penizillin nur lachen können. Sogar Infektionen, die wir schon lange als Vergangenheit sahen, wie Tuberkulose oder Salmonellen, tauchen vermehrt in einer Version auf, gegen die Antibiotika nicht mehr nützen. Von den mehrfach resistenten Keimen in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Das haben die Bakterien nicht selbst so ausbaldowert, sondern wir produzieren sie durch den unnötigen und massenhaften Einsatz von Antibiotika in den Megaställen. Wie in Niedersachsen, mit bis zu 50.000 Schweinen oder Hühnern, zusammen gepfercht auf kleinstem Raum, auf Legeleistung oder Fleischansatz gezüchtet, mit kaputten Immunsystemen und unerträglichen Haltungsbedingungen. Da werden allein prophylaktisch Tonnen Medikamente unters Futter gemischt, die nicht nur in Hühnerkot oder Gülle in die Umwelt gelangen. Selbst im Schnitzel oder in der Putenbrust beim Discounter sind die Antibiotika noch nachweisbar. Der Grund: So viel Fleisch und Umsatz wie möglich, so billig wie möglich. Wie beim Klimawandel heißt die Devise dann: Augen zu und durch. Hauptsache die Grillwurst schmeckt und kost' nix.
Als das Corona-Virus Anfang 2020 von China aus sich auf die Reise in alle Welt machte, war recht schnell klar, woher es kam: Aus den früher unberührten Urwäldern, die immer mehr von Menschen durchdrungen werden. Doch mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen, die exotische Tierarten als Delikatessen verspeisen, sollten gerade wir Europäer uns sparen. Wir sind seit den Achtzigern fleißig dabei, noch viel gefährlichere Mikroben zu züchten. Nämlich Bakterien, die zunehmend gegen die Wunderwaffe der Medizin, die Antibiotika, resistent werden und über Penizillin nur lachen können. Sogar Infektionen, die wir schon lange als Vergangenheit sahen, wie Tuberkulose oder Salmonellen, tauchen vermehrt in einer Version auf, gegen die Antibiotika nicht mehr nützen. Von den mehrfach resistenten Keimen in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Das haben die Bakterien nicht selbst so ausbaldowert, sondern wir produzieren sie durch den unnötigen und massenhaften Einsatz von Antibiotika in den Megaställen. Wie in Niedersachsen, mit bis zu 50.000 Schweinen oder Hühnern, zusammen gepfercht auf kleinstem Raum, auf Legeleistung oder Fleischansatz gezüchtet, mit kaputten Immunsystemen und unerträglichen Haltungsbedingungen. Da werden allein prophylaktisch Tonnen Medikamente unters Futter gemischt, die nicht nur in Hühnerkot oder Gülle in die Umwelt gelangen. Selbst im Schnitzel oder in der Putenbrust beim Discounter sind die Antibiotika noch nachweisbar. Der Grund: So viel Fleisch und Umsatz wie möglich, so billig wie möglich. Wie beim Klimawandel heißt die Devise dann: Augen zu und durch. Hauptsache die Grillwurst schmeckt und kost' nix.
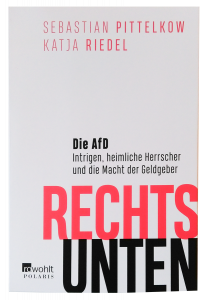 Wofür die «Alternative für Deutschland», die AfD, im deutschen Parteienspektrum steht, ist einfach und zugleich schwer zu beantworten. Entstanden ist sie 2013 in Oberursel als Euro-kritische, liberalkonservative Partei, bis sie wenig später von Rechtspopulisten übernommen wurde. Die bisherigen Größen der Partei, wie Bernd Lucke, wurden entmachtet und aus der Partei gedrängt. Der verbliebene Vorstand mit Frauke Petri und Alexander Gauland steuerte die Partei bis ganz weit nach rechts. Ihren großen Auftritt hatte die AfD dann mit dem Einsetzen der Flüchtlingswelle in 2015, als sie sich an die Spitze der Flüchtlingsgegner, Islam-Hasser und angeblichen Retter Deutschlands setzte. Seit dem Abebben der Migration nach Europa kämpft sie darum, sich einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel durch Anbiederung an Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Das, was anstatt politischem Wirken bis heute übrig blieb, sind interne Grabenkämpfe, noch immer nicht ganz aufgeklärte Spendenskandale, dazu rechtsextreme, fremdenfeindliche oder schlicht peinliche Auftritte im Bundestag und in den Ländern. Sieben Jahre lang haben Sebastian Pittelkow und Katja Riedel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das Treiben der AfD verfolgt. Und dabei erstaunliche wie verstörende Aktivitäten der Rechtextremen ans Licht gebracht. Wie die «Quasselgruppe», merkwürdige Spenden von deutschen und schweizerischen Milliardären sowie befremdliche Kontakte nach Russland. Wenn man über den Alltag hinausgehende Informationen über diese Partei, die eigentlich keine ist, erfahren möchte, liegt man mit diesem Buch goldrichtig.
Wofür die «Alternative für Deutschland», die AfD, im deutschen Parteienspektrum steht, ist einfach und zugleich schwer zu beantworten. Entstanden ist sie 2013 in Oberursel als Euro-kritische, liberalkonservative Partei, bis sie wenig später von Rechtspopulisten übernommen wurde. Die bisherigen Größen der Partei, wie Bernd Lucke, wurden entmachtet und aus der Partei gedrängt. Der verbliebene Vorstand mit Frauke Petri und Alexander Gauland steuerte die Partei bis ganz weit nach rechts. Ihren großen Auftritt hatte die AfD dann mit dem Einsetzen der Flüchtlingswelle in 2015, als sie sich an die Spitze der Flüchtlingsgegner, Islam-Hasser und angeblichen Retter Deutschlands setzte. Seit dem Abebben der Migration nach Europa kämpft sie darum, sich einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel durch Anbiederung an Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Das, was anstatt politischem Wirken bis heute übrig blieb, sind interne Grabenkämpfe, noch immer nicht ganz aufgeklärte Spendenskandale, dazu rechtsextreme, fremdenfeindliche oder schlicht peinliche Auftritte im Bundestag und in den Ländern. Sieben Jahre lang haben Sebastian Pittelkow und Katja Riedel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das Treiben der AfD verfolgt. Und dabei erstaunliche wie verstörende Aktivitäten der Rechtextremen ans Licht gebracht. Wie die «Quasselgruppe», merkwürdige Spenden von deutschen und schweizerischen Milliardären sowie befremdliche Kontakte nach Russland. Wenn man über den Alltag hinausgehende Informationen über diese Partei, die eigentlich keine ist, erfahren möchte, liegt man mit diesem Buch goldrichtig.
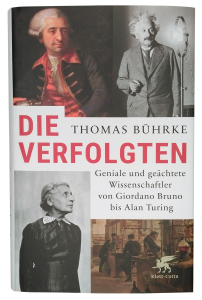 Dass Politiker und Autoren zu vielen Zeiten verfolgt und sogar umgebracht wurden, weil sie Machthabern nicht in den Kram passten, ist nichts Neues. Aber auch Wissenschaftler waren immer wieder Verfolgung ausgesetzt. Entweder weil ihre Forschungen oder ihre Person Bildern und Erwartungen nicht gerecht wurden. Diesen Wissenschaftlern folgt Thomas Bührke durch ihr Leben und ihre Arbeitsgebiete. Die Liste ist erstaunlich. Wie Lise Meitner und Albert Einstein, die beide wegen ihrer jüdischen Abstammungen ihre Heimat verlassen mussten. Einstein traf es danach noch einmal, als er in den USA in der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt wurde. Alan Turing war ein genialer wie seltsamer Spezialist für Informations-Wissenschaft und besonders für Kryptografie. Ihm wurde seine Homosexualität zum Verhängnis, der Versuch einer Konversion trieb ihn am Ende in den Suizid. Giordano Bruno war Astronom und Philosoph. Seine Erkenntnisse in der Astronomie konnte die Kirche nicht hinnehmen. Denn schon er ahnte, das Universum sei unendlich und die Zahl der bewohnbaren Erden unüberschaubar. Das passte nicht zum Gottesbegriff der Kirche.
Dass Politiker und Autoren zu vielen Zeiten verfolgt und sogar umgebracht wurden, weil sie Machthabern nicht in den Kram passten, ist nichts Neues. Aber auch Wissenschaftler waren immer wieder Verfolgung ausgesetzt. Entweder weil ihre Forschungen oder ihre Person Bildern und Erwartungen nicht gerecht wurden. Diesen Wissenschaftlern folgt Thomas Bührke durch ihr Leben und ihre Arbeitsgebiete. Die Liste ist erstaunlich. Wie Lise Meitner und Albert Einstein, die beide wegen ihrer jüdischen Abstammungen ihre Heimat verlassen mussten. Einstein traf es danach noch einmal, als er in den USA in der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt wurde. Alan Turing war ein genialer wie seltsamer Spezialist für Informations-Wissenschaft und besonders für Kryptografie. Ihm wurde seine Homosexualität zum Verhängnis, der Versuch einer Konversion trieb ihn am Ende in den Suizid. Giordano Bruno war Astronom und Philosoph. Seine Erkenntnisse in der Astronomie konnte die Kirche nicht hinnehmen. Denn schon er ahnte, das Universum sei unendlich und die Zahl der bewohnbaren Erden unüberschaubar. Das passte nicht zum Gottesbegriff der Kirche.
So bietet Bührke acht Biografien berühmter Wissenschaftler und warum sie scheiterten. Obwohl diese Biografien eher grob gehalten sind, erfährt man doch eine Menge über diese Menschen, ihren Lebenslauf und einige Details zu ihren Forschungen. Die Gründe, warum sie verfolgt wurden, sind vielfältig, wie auch die Charaktere der Protagonisten. Gemeinsam haben die Verfolgungen, dass Widersprüche gegen Rassismus, politische Ansprüche und Intoleranz nicht ohne Folgen blieben. Eine interessante Übersicht zu einem selten beachteten Thema.
Thomas Bührke (* 7. Dezember 1956 in Celle) ist ein deutscher Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Buchautor in den Bereichen Raumfahrt, Physik und Astrophysik. Nach der Schulzeit in Celle begann Bührke 1976 ein Physikstudium in Göttingen. 1980 wechselte er an die Universität Heidelberg, wo er 1983 am Max-Planck-Institut für Kernphysik abschloss. 1986 promovierte er am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Ab 1988 schrieb er als Redakteur bei den Physikalischen Blättern. Seit 1990 arbeitet er als Redakteur von Physik in unserer Zeit sowie als freier Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Darstellung astronomischer Themen. Regelmäßig veröffentlicht er in Tageszeitungen und Zeitschriften wie «Süddeutsche Zeitung», «Die Welt», «Berliner Zeitung», «Spektrum der Wissenschaft», «Bild der Wissenschaft» und «Sterne und Weltraum». Bührke wohnt in Schwetzingen.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Thomas Bührke aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Thomas Bührke aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
 «Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier ...». So steht es in der Bibel in Genesis 1, 28. Leichter gesagt als getan. Aber das mit den Fischen ist ein guter Einstieg. Da bauten nämlich Ende des 19. Jahrhundert die Leute in Chicago den Sanitary and Ship Canal, um die Abwasser aus Chicago statt in den Lake Michigan in den Chicago River und Mississippi zu leiten. Dazu musste die Fließrichtung des Chicago River ab einer bestimmten Stelle umgeleitet werden. Womit sich in einem großen Teil der USA die Wasserversorgung drastisch veränderte. Doch es kam noch schlimmer. Unterhalb des Chicago River hausten vier asiatische Barscharten, die man ausgesetzt hatte, um Algen in den Griff zu bekommen. Leider gerieten die Barsche außer Kontrolle und vermehrten sich explosionsartig. Diese vier Barscharten in Kombination fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Durch den neuen Kanal konnten die Barsche in die großen Seen im Norden einwandern, welche sie ratzekahl leer gefressen hätten. So bekam das United States Army Corps of Engineers den Auftrag, einen Elektrozaun im Chicago River zu bauen, um die Barsche fernzuhalten. Doch damit war die Kette an Problemen, die man sich eingebrockt hatte, noch lange nicht zu Ende. Also kein Buch über Theorien, sondern ganz praktische Beispiele, wie die Krone der Schöpfung die Kontrolle verlor.
«Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier ...». So steht es in der Bibel in Genesis 1, 28. Leichter gesagt als getan. Aber das mit den Fischen ist ein guter Einstieg. Da bauten nämlich Ende des 19. Jahrhundert die Leute in Chicago den Sanitary and Ship Canal, um die Abwasser aus Chicago statt in den Lake Michigan in den Chicago River und Mississippi zu leiten. Dazu musste die Fließrichtung des Chicago River ab einer bestimmten Stelle umgeleitet werden. Womit sich in einem großen Teil der USA die Wasserversorgung drastisch veränderte. Doch es kam noch schlimmer. Unterhalb des Chicago River hausten vier asiatische Barscharten, die man ausgesetzt hatte, um Algen in den Griff zu bekommen. Leider gerieten die Barsche außer Kontrolle und vermehrten sich explosionsartig. Diese vier Barscharten in Kombination fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Durch den neuen Kanal konnten die Barsche in die großen Seen im Norden einwandern, welche sie ratzekahl leer gefressen hätten. So bekam das United States Army Corps of Engineers den Auftrag, einen Elektrozaun im Chicago River zu bauen, um die Barsche fernzuhalten. Doch damit war die Kette an Problemen, die man sich eingebrockt hatte, noch lange nicht zu Ende. Also kein Buch über Theorien, sondern ganz praktische Beispiele, wie die Krone der Schöpfung die Kontrolle verlor.
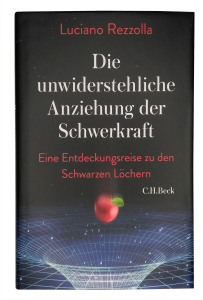 Ich habe einen Moment nachdenken müssen, warum mir der Titel des Buches so bekannt vorkam. Es ist der verballhornte Name des Monty Python-Films »Die wunderbare Welt der Schwerkraft«. Mit Sketchen oder Satire hat das Buch jedoch nichts zu tun. Es erhebt nämlich den Anspruch, auch physikalisch und mathematisch wenig vorbelasteten Lesern den Wirkungskreis der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie vorzustellen. Es geht um Neutronensterne, Schwarze Löcher und weitere Phänomene wie Gravitationswellen. Kompetenz kann man Luciano Rezzolla bestimmt nicht absprechen. Der in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker gehörte zu den Ersten, denen es gelang, fotografische Bilder eines supermassiven Schwarzen Lochs zu erstellen. Wie das ging, ist im Buch ausführlich beschrieben. Nun hat Charlie Chaplin bei einem Pressetermin zu Albert Einstein gesagt, die Menschen liebten ihn, weil alle verstehen, was er macht. Während sie Einstein liebten, weil sie nichts von dem verstehen, was er macht. An diesem Punkt war ich auch, wollte aber immer gerne wissen, was Ereignishorizont, Raumzeit und Gravitation eigentlich sind. So war ich gespannt, ob das Buch hält, was der Autor verspricht.
Ich habe einen Moment nachdenken müssen, warum mir der Titel des Buches so bekannt vorkam. Es ist der verballhornte Name des Monty Python-Films »Die wunderbare Welt der Schwerkraft«. Mit Sketchen oder Satire hat das Buch jedoch nichts zu tun. Es erhebt nämlich den Anspruch, auch physikalisch und mathematisch wenig vorbelasteten Lesern den Wirkungskreis der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie vorzustellen. Es geht um Neutronensterne, Schwarze Löcher und weitere Phänomene wie Gravitationswellen. Kompetenz kann man Luciano Rezzolla bestimmt nicht absprechen. Der in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker gehörte zu den Ersten, denen es gelang, fotografische Bilder eines supermassiven Schwarzen Lochs zu erstellen. Wie das ging, ist im Buch ausführlich beschrieben. Nun hat Charlie Chaplin bei einem Pressetermin zu Albert Einstein gesagt, die Menschen liebten ihn, weil alle verstehen, was er macht. Während sie Einstein liebten, weil sie nichts von dem verstehen, was er macht. An diesem Punkt war ich auch, wollte aber immer gerne wissen, was Ereignishorizont, Raumzeit und Gravitation eigentlich sind. So war ich gespannt, ob das Buch hält, was der Autor verspricht.
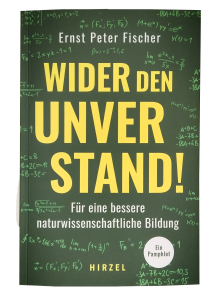 Was mich bei Querdenkern, Impfgegnern und anderen Schwurblern am meisten auf die Palme bringt, ist das völlige naturwissenschaftliche und technische Unwissen. Da passen elektronische Schaltkreise mit mehreren Millimetern Kantenlänge durch Injektionsnadeln, die außen weniger als einen halben Millimeter dick sind. Ganz zu schweigen davon, wo die Schaltungen im Blut ihre Stromversorgung herbekommen. mRNA-Impfstoffe verändern angeblich die Erbanlagen. Wenn man eine flache Scheibe im Weltall platzieren würde, wäre davon nach absehbarer Zeit eh nur noch eine Kugel da, weil physikalische Kräfte wie die Gravitation nun mal so wirken. Erst recht stutzig machte mich die Feststellung, dass mir Querdenker in Großbritannien oder den Niederlanden nicht aufgefallen sind. Also ein deutsches Phänomen? In gewisser Weise ja, sagt Ernst Peter Fischer in seinem aktuellen Buch. Die naturwissenschaftliche Bildung eines großen Teils der deutschsprachigen Gesellschaft sei praktisch nicht vorhanden, damit kann auch technisches Wissen nicht funktionieren. Millionen Leute wischen auf ihren Smartphones herum, ohne nur eine Spur von Ahnung darüber, was in der Schachtel passiert, und wie und warum. Je komplexer Technik wird, umso mehr erscheint sie als Mysterium. Auf dieser Grundlage grassieren dann Verschwörungstheorien, Mythen und Unsinn wie Schimmelpilze. Aber woher stammt diese Wissenschaftsfeindlichkeit, geradezu das Verlangen nach Unwissen und Inkompetenz, besonders in den Naturwissenschaften? Da muss man dann mit Fischer mal einige Jahrzehnte in die Vergangenheit schauen.
Was mich bei Querdenkern, Impfgegnern und anderen Schwurblern am meisten auf die Palme bringt, ist das völlige naturwissenschaftliche und technische Unwissen. Da passen elektronische Schaltkreise mit mehreren Millimetern Kantenlänge durch Injektionsnadeln, die außen weniger als einen halben Millimeter dick sind. Ganz zu schweigen davon, wo die Schaltungen im Blut ihre Stromversorgung herbekommen. mRNA-Impfstoffe verändern angeblich die Erbanlagen. Wenn man eine flache Scheibe im Weltall platzieren würde, wäre davon nach absehbarer Zeit eh nur noch eine Kugel da, weil physikalische Kräfte wie die Gravitation nun mal so wirken. Erst recht stutzig machte mich die Feststellung, dass mir Querdenker in Großbritannien oder den Niederlanden nicht aufgefallen sind. Also ein deutsches Phänomen? In gewisser Weise ja, sagt Ernst Peter Fischer in seinem aktuellen Buch. Die naturwissenschaftliche Bildung eines großen Teils der deutschsprachigen Gesellschaft sei praktisch nicht vorhanden, damit kann auch technisches Wissen nicht funktionieren. Millionen Leute wischen auf ihren Smartphones herum, ohne nur eine Spur von Ahnung darüber, was in der Schachtel passiert, und wie und warum. Je komplexer Technik wird, umso mehr erscheint sie als Mysterium. Auf dieser Grundlage grassieren dann Verschwörungstheorien, Mythen und Unsinn wie Schimmelpilze. Aber woher stammt diese Wissenschaftsfeindlichkeit, geradezu das Verlangen nach Unwissen und Inkompetenz, besonders in den Naturwissenschaften? Da muss man dann mit Fischer mal einige Jahrzehnte in die Vergangenheit schauen.
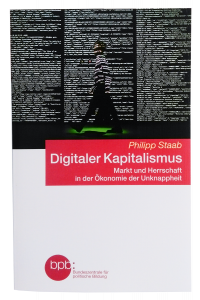 Philipp Staabs Biografie täuscht nicht. Aus ganzem Herzen Soziologe mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Ökonomie, so geriet auch dieses Buch. Lockerer formuliert: ein Brecher, den man nicht mal so eben weg liest. Nun ist Ökonomie nicht unbedingt mein Interessenschwerpunkt, das Digitale und seine Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik schon. Bald nach den ersten Seiten wurde mir klar, dass ich mit Staabs Buch keine nette Lektüre für die Mittagsruhe erwischt hatte, sondern ein in viele Details und Tiefen herab steigendes Werk. So schwer sich das Buch liest, so interessant ist Staabs Analyse dessen, was mit dem schwammigen Begriff digitaler Kapitalismus umschrieben wird. Der Verdacht ist berechtigt, es geht um die großen Internet-Herrscher Amazon, Google, Apple, Facebook. Und Konsorten wie Alibaba und WeChat dazu, ihre östlichen Pendants. Nun kann man sich einen schlanken Fuß machen und Amazon nur als eine andere Ausprägung eines Händlers sehen. Ohne weitere Feinheiten wie im Mittelalter die Fugger, heute Otto-Versand oder meine Hundeleckerli-Versorger Bosch und Vitakraft. Doch dieses Sicht ist nicht nur zu kurz, sie ist falsch. Denn es geht bei diesem Thema nicht allein um den Handel, es geht um die Digitalisierung, die Macht der Algorithmen, über die Methoden und Vorgehensweisen, die diese großen Metaplattformen nutzen, um eine ganz neue Art von Kapitalismus aufzuziehen. Als wenn das nicht schon komplex genug wäre, nimmt einen Staab noch mit in eine historische Analyse des Kapitalismus und warum es geradezu zwangsläufig in diese neue Art des Kapitalismus gehen musste. So dass man bei der nächsten Stehparty galant über den Fordismus und den Postfordimus mansplainen kann.
Philipp Staabs Biografie täuscht nicht. Aus ganzem Herzen Soziologe mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Ökonomie, so geriet auch dieses Buch. Lockerer formuliert: ein Brecher, den man nicht mal so eben weg liest. Nun ist Ökonomie nicht unbedingt mein Interessenschwerpunkt, das Digitale und seine Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik schon. Bald nach den ersten Seiten wurde mir klar, dass ich mit Staabs Buch keine nette Lektüre für die Mittagsruhe erwischt hatte, sondern ein in viele Details und Tiefen herab steigendes Werk. So schwer sich das Buch liest, so interessant ist Staabs Analyse dessen, was mit dem schwammigen Begriff digitaler Kapitalismus umschrieben wird. Der Verdacht ist berechtigt, es geht um die großen Internet-Herrscher Amazon, Google, Apple, Facebook. Und Konsorten wie Alibaba und WeChat dazu, ihre östlichen Pendants. Nun kann man sich einen schlanken Fuß machen und Amazon nur als eine andere Ausprägung eines Händlers sehen. Ohne weitere Feinheiten wie im Mittelalter die Fugger, heute Otto-Versand oder meine Hundeleckerli-Versorger Bosch und Vitakraft. Doch dieses Sicht ist nicht nur zu kurz, sie ist falsch. Denn es geht bei diesem Thema nicht allein um den Handel, es geht um die Digitalisierung, die Macht der Algorithmen, über die Methoden und Vorgehensweisen, die diese großen Metaplattformen nutzen, um eine ganz neue Art von Kapitalismus aufzuziehen. Als wenn das nicht schon komplex genug wäre, nimmt einen Staab noch mit in eine historische Analyse des Kapitalismus und warum es geradezu zwangsläufig in diese neue Art des Kapitalismus gehen musste. So dass man bei der nächsten Stehparty galant über den Fordismus und den Postfordimus mansplainen kann.
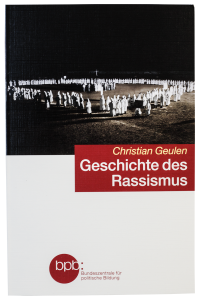 Ein erstes Problem bei dem Begriff Rassismus ist schon seine Definition. Ist Rassismus nur das Einteilen von Menschen in niederwertige und höherwertige Gruppen? Woher stammt überhaupt der Begriff der Rassen auf den Menschen bezogen? Bei Hunden oder Pferden bleibt der Begriff gängig, ein Zwergschnauzer und eine Dogge unterscheiden sich offenbar erheblich. Aber ein Schnauzer ist auch nicht besser oder schlechter als eine Dogge. Wohingegen die genetischen Unterschiede zwischen einem Dänen und einem Italiener größer sein können als zwischen einem Polen und einem Afroamerikaner. Stichwort epigenetische Einflüsse. Doch es geht eben nicht um solche Fragen, deren Antworten heute weitgehend beantwortet sind. Es geht stattdessen um eine historische Sicht, wann Rassismus überhaupt entstanden ist, woran er sich festmachen lässt und wie seine gesellschaftliche und politische Deutung verläuft. So wird klar, dass Christian Geulen eine historische Sicht auf dieses Phänomen als Thema dieses Buches hat. Mit Geulens beruflichem Hintergrund kommt dabei nicht eine populärwissenschaftliche Schrift heraus, die man mal so eben durchliest, sondern ein schon komplexes und vielschichtiges Werk. Geschichte des Rassismus ist, nicht vom Seitenumfang her, jedoch in Inhalt und Darstellung, ein anspruchsvolles Buch. Mit Ecken und Kanten, steuert in dieser Thematik zugleich viele Details und Hintergrundinformationen bei. Zusammengefasst: Nicht ganz einfach zu lesen, aber die Mühe schon wert.
Ein erstes Problem bei dem Begriff Rassismus ist schon seine Definition. Ist Rassismus nur das Einteilen von Menschen in niederwertige und höherwertige Gruppen? Woher stammt überhaupt der Begriff der Rassen auf den Menschen bezogen? Bei Hunden oder Pferden bleibt der Begriff gängig, ein Zwergschnauzer und eine Dogge unterscheiden sich offenbar erheblich. Aber ein Schnauzer ist auch nicht besser oder schlechter als eine Dogge. Wohingegen die genetischen Unterschiede zwischen einem Dänen und einem Italiener größer sein können als zwischen einem Polen und einem Afroamerikaner. Stichwort epigenetische Einflüsse. Doch es geht eben nicht um solche Fragen, deren Antworten heute weitgehend beantwortet sind. Es geht stattdessen um eine historische Sicht, wann Rassismus überhaupt entstanden ist, woran er sich festmachen lässt und wie seine gesellschaftliche und politische Deutung verläuft. So wird klar, dass Christian Geulen eine historische Sicht auf dieses Phänomen als Thema dieses Buches hat. Mit Geulens beruflichem Hintergrund kommt dabei nicht eine populärwissenschaftliche Schrift heraus, die man mal so eben durchliest, sondern ein schon komplexes und vielschichtiges Werk. Geschichte des Rassismus ist, nicht vom Seitenumfang her, jedoch in Inhalt und Darstellung, ein anspruchsvolles Buch. Mit Ecken und Kanten, steuert in dieser Thematik zugleich viele Details und Hintergrundinformationen bei. Zusammengefasst: Nicht ganz einfach zu lesen, aber die Mühe schon wert.
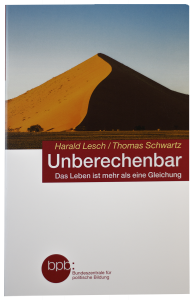 Die Bücher in meinen Regalen sind nach Themen geordnet. Reisen und Sprachen, Philosophie, Psychologie, Journalismus, Politik und Gesellschaft, Fachbücher und so weiter. In welcher Etage ich nun dieses Buch ablegen soll, ist mir ein wenig schleierhaft. Vielleicht eher Philosophie. Oder doch Gesellschaft? Auch wenn man Harald Lesch eher der Naturwissenschaft zuordnen würde, ist ja Thomas Schwartz Coautor, damit kommt die Theologie zum Zug. Sagen wir, das Buch ist ein Essay, in dem beide Welten zum Tragen kommen. Einmal die nüchterne Betrachtung des Wissenschaftlers, zusätzlich eine moralisch-ethische Sicht der Dinge. Es geht, wie könnte es anders sein, mal wieder um den Blick auf die Menschheit, wie sie sich auf diesem Planeten aufführt, was sie Unfassliches mit ihm anstellt und was dabei alles aus dem Blick gerät. Es ist zugleich ein Weckruf. Wie ich schon inzwischen so oft geschrieben habe, an die, die dieses Buch eh nicht lesen und denen die behandelten Themen total schnurzegal sind. Im Grunde ist das Buch also überflüssig. Warum sollte man dieses Buch dann trotzdem lesen? Weil es in drei Betrachtungsrichtungen umreißt, was und warum so viele Dinge im Moment schief laufen, so als Erweiterung des Arsenals an Argumenten im Diskurs. Auch wenn man sich, wie ich, mit den betreffenden Themen schon lange auseinander setzt, muss ich dem Buch zugestehen, dass es dort immer noch neue Elemente liefert. Keine weiteren Zahlen, Daten und Fakten, sondern Interpretationen unseres menschlichen Daseins, die wir gerne ausblenden, nicht wahr haben wollen. Dann vielleicht doch nicht schon ein Dutzend Mal so gelesen.
Die Bücher in meinen Regalen sind nach Themen geordnet. Reisen und Sprachen, Philosophie, Psychologie, Journalismus, Politik und Gesellschaft, Fachbücher und so weiter. In welcher Etage ich nun dieses Buch ablegen soll, ist mir ein wenig schleierhaft. Vielleicht eher Philosophie. Oder doch Gesellschaft? Auch wenn man Harald Lesch eher der Naturwissenschaft zuordnen würde, ist ja Thomas Schwartz Coautor, damit kommt die Theologie zum Zug. Sagen wir, das Buch ist ein Essay, in dem beide Welten zum Tragen kommen. Einmal die nüchterne Betrachtung des Wissenschaftlers, zusätzlich eine moralisch-ethische Sicht der Dinge. Es geht, wie könnte es anders sein, mal wieder um den Blick auf die Menschheit, wie sie sich auf diesem Planeten aufführt, was sie Unfassliches mit ihm anstellt und was dabei alles aus dem Blick gerät. Es ist zugleich ein Weckruf. Wie ich schon inzwischen so oft geschrieben habe, an die, die dieses Buch eh nicht lesen und denen die behandelten Themen total schnurzegal sind. Im Grunde ist das Buch also überflüssig. Warum sollte man dieses Buch dann trotzdem lesen? Weil es in drei Betrachtungsrichtungen umreißt, was und warum so viele Dinge im Moment schief laufen, so als Erweiterung des Arsenals an Argumenten im Diskurs. Auch wenn man sich, wie ich, mit den betreffenden Themen schon lange auseinander setzt, muss ich dem Buch zugestehen, dass es dort immer noch neue Elemente liefert. Keine weiteren Zahlen, Daten und Fakten, sondern Interpretationen unseres menschlichen Daseins, die wir gerne ausblenden, nicht wahr haben wollen. Dann vielleicht doch nicht schon ein Dutzend Mal so gelesen.
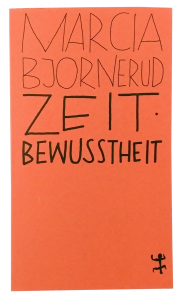 Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Der heutige Mensch tauchte erst von ca. 300.000 Jahren auf. Einem beliebtem Bild nach, wenn man die Zeit der Existenz der Erde als einen Tag betrachtet, erschien Homo in der letzten Sekunde vor Mitternacht. Aber was kommt in diesem Bild eigentlich nach Mitternacht? So widmet sich Marcia Bjornerud, Geologin, gleich mehreren Fragen, von der, wie die Erde kurz nach ihrem Entstehen aussah, wie sie sich in den Milliarden Jahren verändert hat, welche Rolle der Mensch dabei spielt und wie die Geschichte wohl weitergeht. Das Ende ist klar, in ca. drei Milliarden Jahren wird die Sonne immer heißer, dehnt sich aus und verschluckt die meisten Planeten, die sie heute umkreisen. Dazu nimmt Bjornerud den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit aus geologischer Sicht. So weit unserer heutiger Wissensstand dazu ausreicht, denn viele Fragen sind noch lange nicht beantwortet. Warum gab es mindestens fünf große Phasen des Massensterbens auf der Erde, wobei das Sterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit noch das harmloseste war? Auch noch nicht ganz geklärt ist, wieso die Erde mehrmals ihre Atmosphäre gewechselt hat. Die erste enthielt noch gar keinen Sauerstoff, erst Cyanobakterien sorgten für wenige Promille. Trotz vieler unbeantworteter Fragen haben wir heute ein klareres Bild der Erde, wie wir sie jetzt kennen, doch auch das erst mit dem 20 Jahrhundert. Wie entstanden Gebirge? Die Theorie der Plattentektonik entstand erst 1960. Aber Bjornerud geht weiter. Sie blickt genau so aus ökologischen und ökomischen Sichtweisen darauf, dass der Mensch in wenigen Jahrhunderten die Erde stärker verändert hat als die Natur über Jahrmillionen. Also ein geologischer und ein ökologischer Ritt durch die Zeit. Die wir Menschen völlig falsch einschätzen.
Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Der heutige Mensch tauchte erst von ca. 300.000 Jahren auf. Einem beliebtem Bild nach, wenn man die Zeit der Existenz der Erde als einen Tag betrachtet, erschien Homo in der letzten Sekunde vor Mitternacht. Aber was kommt in diesem Bild eigentlich nach Mitternacht? So widmet sich Marcia Bjornerud, Geologin, gleich mehreren Fragen, von der, wie die Erde kurz nach ihrem Entstehen aussah, wie sie sich in den Milliarden Jahren verändert hat, welche Rolle der Mensch dabei spielt und wie die Geschichte wohl weitergeht. Das Ende ist klar, in ca. drei Milliarden Jahren wird die Sonne immer heißer, dehnt sich aus und verschluckt die meisten Planeten, die sie heute umkreisen. Dazu nimmt Bjornerud den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit aus geologischer Sicht. So weit unserer heutiger Wissensstand dazu ausreicht, denn viele Fragen sind noch lange nicht beantwortet. Warum gab es mindestens fünf große Phasen des Massensterbens auf der Erde, wobei das Sterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit noch das harmloseste war? Auch noch nicht ganz geklärt ist, wieso die Erde mehrmals ihre Atmosphäre gewechselt hat. Die erste enthielt noch gar keinen Sauerstoff, erst Cyanobakterien sorgten für wenige Promille. Trotz vieler unbeantworteter Fragen haben wir heute ein klareres Bild der Erde, wie wir sie jetzt kennen, doch auch das erst mit dem 20 Jahrhundert. Wie entstanden Gebirge? Die Theorie der Plattentektonik entstand erst 1960. Aber Bjornerud geht weiter. Sie blickt genau so aus ökologischen und ökomischen Sichtweisen darauf, dass der Mensch in wenigen Jahrhunderten die Erde stärker verändert hat als die Natur über Jahrmillionen. Also ein geologischer und ein ökologischer Ritt durch die Zeit. Die wir Menschen völlig falsch einschätzen.
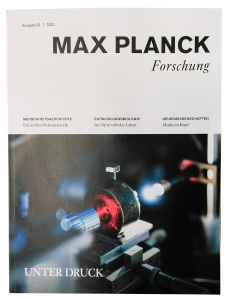 Die Max Planck-Gesellschaft gibt alle drei Monate ein Magazin über aktuelle Forschungen an ihren Instituten und über allgemeine Themen der Forschung und Technik heraus. In der aktuellen Ausgabe 01/2022 geht es um die Zukunft von Öl und Gas, über die Wirkung von Stress auf den menschlichen Körper, wie unsere Knochen aufgebaut sind und was sie so belastbar macht, und viele weitere Themen. Die Beiträge sind zwar wissenschaftlich fundiert, trotzdem leicht verständlich und unterhaltsam. Für alle an Wissenschaft und Forschung Interessierten eine empfehlenswerte Lektüre, zudem kostenlos als Printausgabe oder PDF. Erhältlich unter
Die Max Planck-Gesellschaft gibt alle drei Monate ein Magazin über aktuelle Forschungen an ihren Instituten und über allgemeine Themen der Forschung und Technik heraus. In der aktuellen Ausgabe 01/2022 geht es um die Zukunft von Öl und Gas, über die Wirkung von Stress auf den menschlichen Körper, wie unsere Knochen aufgebaut sind und was sie so belastbar macht, und viele weitere Themen. Die Beiträge sind zwar wissenschaftlich fundiert, trotzdem leicht verständlich und unterhaltsam. Für alle an Wissenschaft und Forschung Interessierten eine empfehlenswerte Lektüre, zudem kostenlos als Printausgabe oder PDF. Erhältlich unter
https://www.mpg.de/maxplanckforschung
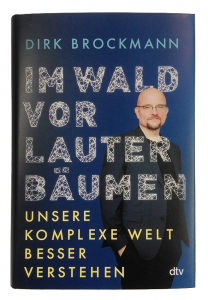 Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?
Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?
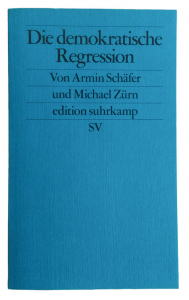 Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wuchs weltweit die Anzahl liberaler Demokratien. Das waren die ehemaligen Staaten der Sowjetunion, aber auch deren Satelliten wie Ungarn und Polen. Seit dem Jahrhundertwechsel schrumpft diese Zahl wieder. In Ungarn und Polen, aber auch in Indien und den USA, kommen populistische, sogar autoritäre Regierungen und Politiker an die Macht. In Deutschland hat die AfD einen stabilen Wählerstamm von ca. 10%. Der Populismus ist also ein weltweites Phänomen, kein deutsches, nicht mal ein europäisches. Für die Erklärung dieser Entwicklungen werden gerne ökonomische oder kulturelle Entwicklungen genutzt. Die Politik als Ursache wird dagegen gerne ignoriert. Die Autoren dieses Buches gehen einem anderen Ansatz nach, der die Politik einbezieht, ja sogar als hauptsächliche Ursache identifiziert. Warum wenden sich Menschen nicht nur von der Politik ab, sondern sogar von der Rationalität, von Fakten und der Wissenschaft, entziehen sich konstruktiven Diskursen unter lautem Gezeter? Die Antwort ist nicht trivial. Aber politisch lehrreich.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wuchs weltweit die Anzahl liberaler Demokratien. Das waren die ehemaligen Staaten der Sowjetunion, aber auch deren Satelliten wie Ungarn und Polen. Seit dem Jahrhundertwechsel schrumpft diese Zahl wieder. In Ungarn und Polen, aber auch in Indien und den USA, kommen populistische, sogar autoritäre Regierungen und Politiker an die Macht. In Deutschland hat die AfD einen stabilen Wählerstamm von ca. 10%. Der Populismus ist also ein weltweites Phänomen, kein deutsches, nicht mal ein europäisches. Für die Erklärung dieser Entwicklungen werden gerne ökonomische oder kulturelle Entwicklungen genutzt. Die Politik als Ursache wird dagegen gerne ignoriert. Die Autoren dieses Buches gehen einem anderen Ansatz nach, der die Politik einbezieht, ja sogar als hauptsächliche Ursache identifiziert. Warum wenden sich Menschen nicht nur von der Politik ab, sondern sogar von der Rationalität, von Fakten und der Wissenschaft, entziehen sich konstruktiven Diskursen unter lautem Gezeter? Die Antwort ist nicht trivial. Aber politisch lehrreich.
