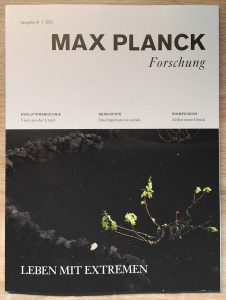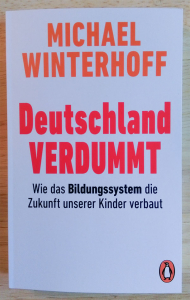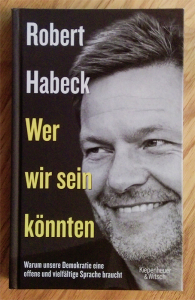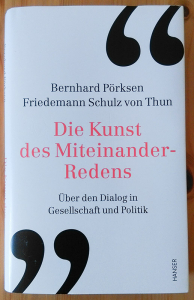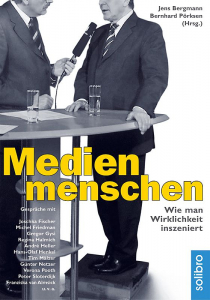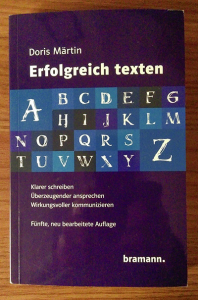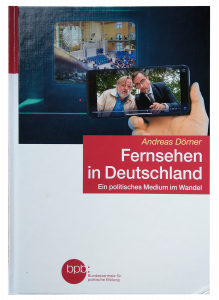 Weder geht es um die Geschichte des Fernsehens, noch um technische Hintergründe. Das Buch von Andreas Dörner beschäftigt sich mit der inhaltlichen, speziell politischen Rolle des Fernsehens. So ist es weniger der allgemeinen Literatur zuzuordnen, sondern eher ein journalistisches Lehrbuch. In meiner journalistischen Ausbildung im Rundfunk-Journalismus hätte mir ein solch tiefgehendes und umfangreiches Buch zum Thema gewünscht. Dörner beginnt mit der Struktur der Sender und ihrer Organisation, sowohl im Innen- wie im Außenverhältnis. Warum wir zwei öffentlich-rechtliche Fernsehsender haben, wie das privatrechtliche Fernsehen dazu kam, wer welchen Ansprüchen gerecht werden muss, wie die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen sind. Quervergleiche zu Sendern in Europa und den USA erweitern das Bild. Danach beschäftigt sich Dörner mit den vielen unterschiedlichen Formaten im Fernsehen, angefangen bei Nachrichten, Reportagen und Magazinen bis hin zu Satire und Kabarett, weiter zu Reality-TV und Casting-Shows. Praktische Beispiele eingeschlossen. Das übergeordnete Thema ist der politische Auftrag und Inhalt des Fernsehens, wie vom Gesetzgeber vorgesehen und dann in der Praxis umgesetzt. Eines macht der Autor in jedem Fall klar: Totgesagte leben länger.
Weder geht es um die Geschichte des Fernsehens, noch um technische Hintergründe. Das Buch von Andreas Dörner beschäftigt sich mit der inhaltlichen, speziell politischen Rolle des Fernsehens. So ist es weniger der allgemeinen Literatur zuzuordnen, sondern eher ein journalistisches Lehrbuch. In meiner journalistischen Ausbildung im Rundfunk-Journalismus hätte mir ein solch tiefgehendes und umfangreiches Buch zum Thema gewünscht. Dörner beginnt mit der Struktur der Sender und ihrer Organisation, sowohl im Innen- wie im Außenverhältnis. Warum wir zwei öffentlich-rechtliche Fernsehsender haben, wie das privatrechtliche Fernsehen dazu kam, wer welchen Ansprüchen gerecht werden muss, wie die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen sind. Quervergleiche zu Sendern in Europa und den USA erweitern das Bild. Danach beschäftigt sich Dörner mit den vielen unterschiedlichen Formaten im Fernsehen, angefangen bei Nachrichten, Reportagen und Magazinen bis hin zu Satire und Kabarett, weiter zu Reality-TV und Casting-Shows. Praktische Beispiele eingeschlossen. Das übergeordnete Thema ist der politische Auftrag und Inhalt des Fernsehens, wie vom Gesetzgeber vorgesehen und dann in der Praxis umgesetzt. Eines macht der Autor in jedem Fall klar: Totgesagte leben länger.
Beiträge
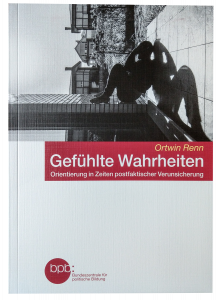 Geht man einmal dreihundert Jahre zurück, sammelten Menschen Erfahrungen und Wissen aus ihrer direkten Umwelt. Was in Haus und Hof funktionierte und was nicht, was stimmte und was nicht. Wir dagegen haben es im Vergleich dazu schwer. Unsere Umwelt ist so komplex und unüberschaubar geworden, dass wir ständig auf die Aussagen und Urteile anderer Leute angewiesen sind. Selbst in den Siebzigern des 20. Jahrhunderts noch interessierte uns im Wesentlichen Deutschland, eventuell noch ein bisschen die USA. Heute landen Vorgänge und Geschehen in Ländern auf der anderen Seite der Welt in Sekundenbruchteilen auf unserem Smartphone. Unmöglich, sich da eine eigene Meinung zu bilden, geschweige denn Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Doch haben nicht wenige Menschen damit ein Problem. Selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, Nachrichten zu überprüfen, wer wollte denn ohne das nötige Fachwissen entscheiden, ob mRNA-Impfstoffe sicher sind, Glyphosat gefährlich oder harmlos, ob sich tatsächlich das Weltklima verändert. Doch wem vertrauen und was bezweifeln? Ortwin Renn kommt aus der Risikoforschung, hat sein Buch in 2022 für die 3. Auflage grundlegend überarbeitet sowie die Erfahrungen mit Corona und Flüchtlingskrise einfließen lassen. Und widmet sich ausgiebig der Frage, warum sich so viele Menschen lieber auf gefühlte Wahrheiten aus sozialen Medien als auf Ergebnisse der Forschung und Ratschläge von Wissenschaftlerinnen und Experten verlassen.
Geht man einmal dreihundert Jahre zurück, sammelten Menschen Erfahrungen und Wissen aus ihrer direkten Umwelt. Was in Haus und Hof funktionierte und was nicht, was stimmte und was nicht. Wir dagegen haben es im Vergleich dazu schwer. Unsere Umwelt ist so komplex und unüberschaubar geworden, dass wir ständig auf die Aussagen und Urteile anderer Leute angewiesen sind. Selbst in den Siebzigern des 20. Jahrhunderts noch interessierte uns im Wesentlichen Deutschland, eventuell noch ein bisschen die USA. Heute landen Vorgänge und Geschehen in Ländern auf der anderen Seite der Welt in Sekundenbruchteilen auf unserem Smartphone. Unmöglich, sich da eine eigene Meinung zu bilden, geschweige denn Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Doch haben nicht wenige Menschen damit ein Problem. Selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, Nachrichten zu überprüfen, wer wollte denn ohne das nötige Fachwissen entscheiden, ob mRNA-Impfstoffe sicher sind, Glyphosat gefährlich oder harmlos, ob sich tatsächlich das Weltklima verändert. Doch wem vertrauen und was bezweifeln? Ortwin Renn kommt aus der Risikoforschung, hat sein Buch in 2022 für die 3. Auflage grundlegend überarbeitet sowie die Erfahrungen mit Corona und Flüchtlingskrise einfließen lassen. Und widmet sich ausgiebig der Frage, warum sich so viele Menschen lieber auf gefühlte Wahrheiten aus sozialen Medien als auf Ergebnisse der Forschung und Ratschläge von Wissenschaftlerinnen und Experten verlassen.
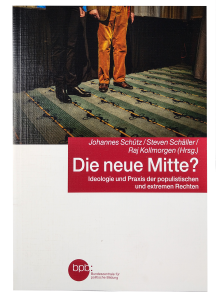 Die Angabe der Herausgeber weist schon darauf hin, dass das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen unterschiedlichster Autoren ist. Genauer handelt es sich um Beiträge, deren Ausgangspunkt in der Tagung «Die neue Mitte? Rechte Ideologien und Bewegungen in Europa» liegt, veranstaltet vom Deutschen Hygiene-Museum in Dresden im September 2018. In diesem Sinne nur eine Übersicht. Erhältlich ist das Buch über die Bundeszentrale für politische Bildung. Es erfasst ein sehr breites Spektrum an Untersuchungen und Analysen zu den vielen Aspekten des Rechtsextremismus, wie Ideen und Ideologien, Akteure, praktische Kritik extrem rechter Milieus, kommunikative Strukturen und Gegenstrategien. Zuerst scheint ein Widerspruch zwischen Titel und Inhalt zu bestehen, doch das täuscht. Die Frage, was und wo denn eigentlich die jeweils politische und gesellschaftliche Mitte in Europa liegt, ist ein zentrales Thema. Praktisch alle Beiträge gehen auf die Frage ein, wie Rechtspopulisten und Rechtsextreme versuchen, sich zu dieser Mitte zu machen, es geht um Verschiebung von Meinungen und dem, was gesagt werden darf, und was nicht. Es geht um Diskurshoheit. Weiterer Fokus liegt auf den Strategien der Neuen Rechten, wie sie schon früh Medien für sich in Anspruch nahmen, sogar schon vor dem World Wide Web das Usenet für ihre Vernetzung nutzten. Es würde zu weit führen, diese vielen Beiträge im Einzelnen darstellen zu wollen. So kann ich eigentlich nur die Lektüre des Buches empfehlen, wenn man an einer wirklich detaillierten Darstellung der vielen Seiten des Rechtextremismus interessiert ist. Auch wenn einzelne Beiträge sehr fachlich orientiert sind. Zum Glück die meisten eben nicht. Wie der über die Situation in der Stadt Bautzen.
Die Angabe der Herausgeber weist schon darauf hin, dass das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen unterschiedlichster Autoren ist. Genauer handelt es sich um Beiträge, deren Ausgangspunkt in der Tagung «Die neue Mitte? Rechte Ideologien und Bewegungen in Europa» liegt, veranstaltet vom Deutschen Hygiene-Museum in Dresden im September 2018. In diesem Sinne nur eine Übersicht. Erhältlich ist das Buch über die Bundeszentrale für politische Bildung. Es erfasst ein sehr breites Spektrum an Untersuchungen und Analysen zu den vielen Aspekten des Rechtsextremismus, wie Ideen und Ideologien, Akteure, praktische Kritik extrem rechter Milieus, kommunikative Strukturen und Gegenstrategien. Zuerst scheint ein Widerspruch zwischen Titel und Inhalt zu bestehen, doch das täuscht. Die Frage, was und wo denn eigentlich die jeweils politische und gesellschaftliche Mitte in Europa liegt, ist ein zentrales Thema. Praktisch alle Beiträge gehen auf die Frage ein, wie Rechtspopulisten und Rechtsextreme versuchen, sich zu dieser Mitte zu machen, es geht um Verschiebung von Meinungen und dem, was gesagt werden darf, und was nicht. Es geht um Diskurshoheit. Weiterer Fokus liegt auf den Strategien der Neuen Rechten, wie sie schon früh Medien für sich in Anspruch nahmen, sogar schon vor dem World Wide Web das Usenet für ihre Vernetzung nutzten. Es würde zu weit führen, diese vielen Beiträge im Einzelnen darstellen zu wollen. So kann ich eigentlich nur die Lektüre des Buches empfehlen, wenn man an einer wirklich detaillierten Darstellung der vielen Seiten des Rechtextremismus interessiert ist. Auch wenn einzelne Beiträge sehr fachlich orientiert sind. Zum Glück die meisten eben nicht. Wie der über die Situation in der Stadt Bautzen.
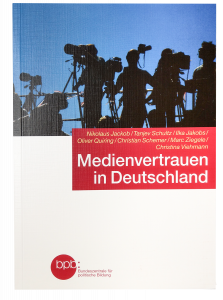 Spätestens seit den PEGIDA-Aufmärschen in Dresden kursiert der Begriff der Lügenpresse wieder. Die Medien und die Politik würden unter einer Decke stecken, als Repräsentanten der "Eliten". Doch was ist dran an den Diskussionen, die Medien würden kein Vertrauen mehr verdienen, seien korrupt und würden die Wahrheit verschweigen? Glaubt tatsächlich eine Mehrheit in Deutschland an diese Zuschreibungen? Die Mainzer Langzeitstudie zu diesen Fragen beschäftigt sich genau mit diesem Thema des Medienvertrauens. Doch wenn man "Medien" sagt, kann man viele Ausprägungen meinen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, etablierte Presse, Boulevard wie BILD und BUNTE, privates Fernsehen bis hin zu Sozialen Medien und den sogenannten Alternativen Medien a'la «Compact» und «KenFM». Welche davon für vertrauenswürdig gehalten werden, hängt von mehreren Faktoren ab, angefangen von der eigenen politischen Position, der privaten wirtschaftlichen Lage, den persönlichen Zukunftsaussichten bis zur jeweiligen Alterskohorte. Doch ist von einer Studie die Rede, nicht von einer redaktionellen Abarbeitung am Thema. Also mal wieder Zahlen und Fakten, Balken- und Liniendiagramme. Doch zum Glück nicht nur.
Spätestens seit den PEGIDA-Aufmärschen in Dresden kursiert der Begriff der Lügenpresse wieder. Die Medien und die Politik würden unter einer Decke stecken, als Repräsentanten der "Eliten". Doch was ist dran an den Diskussionen, die Medien würden kein Vertrauen mehr verdienen, seien korrupt und würden die Wahrheit verschweigen? Glaubt tatsächlich eine Mehrheit in Deutschland an diese Zuschreibungen? Die Mainzer Langzeitstudie zu diesen Fragen beschäftigt sich genau mit diesem Thema des Medienvertrauens. Doch wenn man "Medien" sagt, kann man viele Ausprägungen meinen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, etablierte Presse, Boulevard wie BILD und BUNTE, privates Fernsehen bis hin zu Sozialen Medien und den sogenannten Alternativen Medien a'la «Compact» und «KenFM». Welche davon für vertrauenswürdig gehalten werden, hängt von mehreren Faktoren ab, angefangen von der eigenen politischen Position, der privaten wirtschaftlichen Lage, den persönlichen Zukunftsaussichten bis zur jeweiligen Alterskohorte. Doch ist von einer Studie die Rede, nicht von einer redaktionellen Abarbeitung am Thema. Also mal wieder Zahlen und Fakten, Balken- und Liniendiagramme. Doch zum Glück nicht nur.
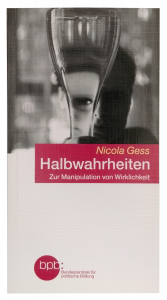 Donald Trump erzählte einmal, der deutsche Golfer Bernhard Langer hätte ihm berichtet, wie er vor einem Wahllokal in den USA 2016 merkwürdige Vorgänge beobachtet habe. Dazu befragt, sagte Langer, dass er Trump niemals persönlich getroffen hätte. Zwar konnte Langer sich daran erinnern, mit Leuten über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Wahlsystems gesprochen zu haben, aber niemals mit Donald Trump. Ein typisches Beispiel für Halbwahrheiten, denen sich Nicola Gess in ihrem Essay widmet. Wie der Name schon sagt, sind Halbwahrheiten keine Lügen. Stattdessen werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, verfälscht oder in einen anderen Kontext gesetzt, so dann uminterpretiert. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch die Wirkung von Halbwahrheiten ist verheerend. Wie im Buch zu lesen, sind Halbwahrheiten gefährlicher als Lügen, weil nicht mehr klar erkennbar ist, was noch Fakt und was Fiktion. Das Thema hat jedoch in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugelegt, weil Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen diese Kommunikationsform ausgiebig nutzen. Weil die Wirkung von Halbwahrheiten umso größer ist, je stärker sie die schon vorhandenen Überzeugungen belegen. Wie auch immer bezeichnet, als Halbwahrheiten, alternative Fakten, oder als Bullshit.
Donald Trump erzählte einmal, der deutsche Golfer Bernhard Langer hätte ihm berichtet, wie er vor einem Wahllokal in den USA 2016 merkwürdige Vorgänge beobachtet habe. Dazu befragt, sagte Langer, dass er Trump niemals persönlich getroffen hätte. Zwar konnte Langer sich daran erinnern, mit Leuten über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Wahlsystems gesprochen zu haben, aber niemals mit Donald Trump. Ein typisches Beispiel für Halbwahrheiten, denen sich Nicola Gess in ihrem Essay widmet. Wie der Name schon sagt, sind Halbwahrheiten keine Lügen. Stattdessen werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, verfälscht oder in einen anderen Kontext gesetzt, so dann uminterpretiert. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch die Wirkung von Halbwahrheiten ist verheerend. Wie im Buch zu lesen, sind Halbwahrheiten gefährlicher als Lügen, weil nicht mehr klar erkennbar ist, was noch Fakt und was Fiktion. Das Thema hat jedoch in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugelegt, weil Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen diese Kommunikationsform ausgiebig nutzen. Weil die Wirkung von Halbwahrheiten umso größer ist, je stärker sie die schon vorhandenen Überzeugungen belegen. Wie auch immer bezeichnet, als Halbwahrheiten, alternative Fakten, oder als Bullshit.
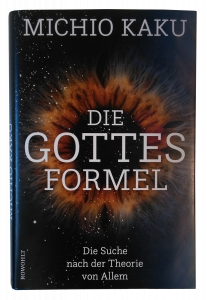 Eigentlich wollte ich Physik studieren, habe mich dann aber für die Informatik entschieden. Was ich oft bereut habe. Wenigstens ist das Interesse für Naturwissenschaften erhalten geblieben. Fabian Scheidler hatte in seinem Buch schon verschiedene physikalische Themen angeschnitten, darunter auch die Stringtheorie. Michio Kaku gilt nun als ausgesprochener Spezialist für dieses Gebiet, hat sie sogar teilweise mitbegründet. Deshalb interessierte mich seine Sicht der Dinge besonders. Auch seine Vita zeichnet ihn als beachtenswerten Wissenschaftler aus. Trotz des anspruchsvollen Titels ist das Buch im Umfang überschaubar geblieben, was mich hoffnungsvoll stimmte. Kernthema ist, ob sich die heute widersprechenden Theorien der großen Dinge, die Allgemeine Relativitätstheorie, und die der ganz kleinen Dinge im atomaren Bereich, die Quantenmechanik, leider widersprechen. Oder eben nicht zusammen bringen lassen. Die Stringtheorie soll das schaffen und ein Gesamtverständnis von atomaren Dingen bis zum Urknall erlauben. Obwohl es schon viele missglückte Versuche gegeben hat, diese Theorien in einer zusammen zu fassen. Am Ende des Buches musste ich mich dem Gebot in der journalistischen Ausbildung anschließen, die da lautet: Schuster, bleib' bei deinen Leisten. Theoretische Wissenschaftler sollten keine populärwissenschaftlichen Bücher schreiben, und Journalisten sollten sich aus der Physik heraus halten.
Eigentlich wollte ich Physik studieren, habe mich dann aber für die Informatik entschieden. Was ich oft bereut habe. Wenigstens ist das Interesse für Naturwissenschaften erhalten geblieben. Fabian Scheidler hatte in seinem Buch schon verschiedene physikalische Themen angeschnitten, darunter auch die Stringtheorie. Michio Kaku gilt nun als ausgesprochener Spezialist für dieses Gebiet, hat sie sogar teilweise mitbegründet. Deshalb interessierte mich seine Sicht der Dinge besonders. Auch seine Vita zeichnet ihn als beachtenswerten Wissenschaftler aus. Trotz des anspruchsvollen Titels ist das Buch im Umfang überschaubar geblieben, was mich hoffnungsvoll stimmte. Kernthema ist, ob sich die heute widersprechenden Theorien der großen Dinge, die Allgemeine Relativitätstheorie, und die der ganz kleinen Dinge im atomaren Bereich, die Quantenmechanik, leider widersprechen. Oder eben nicht zusammen bringen lassen. Die Stringtheorie soll das schaffen und ein Gesamtverständnis von atomaren Dingen bis zum Urknall erlauben. Obwohl es schon viele missglückte Versuche gegeben hat, diese Theorien in einer zusammen zu fassen. Am Ende des Buches musste ich mich dem Gebot in der journalistischen Ausbildung anschließen, die da lautet: Schuster, bleib' bei deinen Leisten. Theoretische Wissenschaftler sollten keine populärwissenschaftlichen Bücher schreiben, und Journalisten sollten sich aus der Physik heraus halten.
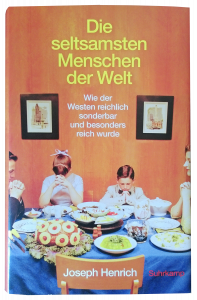 Joseph Henrich und einige Kolleginnen und Kollegen, die darüber forschten, wie sich verschiedene Kulturen selbst sehen und wie sie andere Kulturen sehen, kamen auf die Idee, sich kulturübergreifende Forschung dazu anzusehen. Bei genauerem Analysieren stellten sie erstaunliche Dinge fest. Erstens handelte es sich in den Studien um massiv verzerrte Stichproben, 96% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus Nordeuropa, Nordamerika oder Australien. Zweitens deutete sich an, dass die psychologischen Unterschiede zwischen Bevölkerungen viel größer zu sein schienen, als die Fachliteratur erwarten ließ. Und wenn drittens kulturübergreifende Daten aus mehreren Populationen verfügbar waren, fanden sich die Stichproben der Westler typischerweise am extremen Ende der Verteilung. Mit anderen Worten, westliche Menschen waren psychologisch sonderbar. Doch das waren nicht die einzigen Fragen, mit denen Henrich zu tun hatte. Die anderen waren zum Beispiel, warum gerade die westlichen Kulturen, also Mittel- und Nordeuropa sowie die angloamerikanische Welt, wirtschaftlich so erfolgreich waren oder warum die industrielle Revolution gerade in Europa begann, und nicht irgendwo sonst. Diese Fragen sind durchaus faszinierend, so bestellte ich das Buch, wunderte mich schon etwas über den hohen Preis. Als dann der Buchhändler meines Vertrauens die gut sechs Zentimeter Buch auf den Tresen legte, stöhnte ich kurz auf. Es hat nur ein ähnlich dickes Buch in meinem Leben gegeben. Das war J. F. Coopers Roman »Lederstrumpf«, und auch das habe ich nicht durchgehalten. Dass ich dieses Mal standhaft blieb, liegt nicht nur an meinem fortgeschrittenen Alter, sondern auch am erhellenden Inhalt des Werkes. Wobei erhellend ausgesprochen untertrieben ist.
Joseph Henrich und einige Kolleginnen und Kollegen, die darüber forschten, wie sich verschiedene Kulturen selbst sehen und wie sie andere Kulturen sehen, kamen auf die Idee, sich kulturübergreifende Forschung dazu anzusehen. Bei genauerem Analysieren stellten sie erstaunliche Dinge fest. Erstens handelte es sich in den Studien um massiv verzerrte Stichproben, 96% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus Nordeuropa, Nordamerika oder Australien. Zweitens deutete sich an, dass die psychologischen Unterschiede zwischen Bevölkerungen viel größer zu sein schienen, als die Fachliteratur erwarten ließ. Und wenn drittens kulturübergreifende Daten aus mehreren Populationen verfügbar waren, fanden sich die Stichproben der Westler typischerweise am extremen Ende der Verteilung. Mit anderen Worten, westliche Menschen waren psychologisch sonderbar. Doch das waren nicht die einzigen Fragen, mit denen Henrich zu tun hatte. Die anderen waren zum Beispiel, warum gerade die westlichen Kulturen, also Mittel- und Nordeuropa sowie die angloamerikanische Welt, wirtschaftlich so erfolgreich waren oder warum die industrielle Revolution gerade in Europa begann, und nicht irgendwo sonst. Diese Fragen sind durchaus faszinierend, so bestellte ich das Buch, wunderte mich schon etwas über den hohen Preis. Als dann der Buchhändler meines Vertrauens die gut sechs Zentimeter Buch auf den Tresen legte, stöhnte ich kurz auf. Es hat nur ein ähnlich dickes Buch in meinem Leben gegeben. Das war J. F. Coopers Roman »Lederstrumpf«, und auch das habe ich nicht durchgehalten. Dass ich dieses Mal standhaft blieb, liegt nicht nur an meinem fortgeschrittenen Alter, sondern auch am erhellenden Inhalt des Werkes. Wobei erhellend ausgesprochen untertrieben ist.
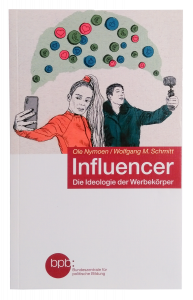 Den einzigen »Influencer«, den ich gelegentlich in YouTube schaue, ist Stephan Wiesner. Der erzählt jedoch weder etwas über Schminken, noch über Bodybuilding oder Reisen, sondern über Fotografie. Er ist also Fachmann für Fotografie, nicht im eigentlichen Sinne Influencer. Auch wenn er Leute beim Kauf von Kameras oder beim Fotografieren beeinflussen mag. Nymoen und Schmitt meinen eine ganz andere Gruppe von Leuten, die ein relativ junges Phänomen sind. Zwar hat auch Wiesner über 180.000 Follower, gegen die Millionen der Kardashians oder Hiltons ist das eher ärmlich. Stattdessen wollen die Autoren analysieren, warum sich so viele Leute bedeutungslose bis unsinnige Videos und Stories in Instagram oder TikTok ansehen, die mit der Realität praktisch nichts mehr zu tun haben. Nicht speziell um die Inhalte geht es, sondern woher diese Protagonisten der digitalen Welt historisch stammen, wie sie arbeiten und welche Konsequenzen ihre Geschichten gesellschaftlich bis politisch haben. Warum sie so viele Leute binden, die früher bei Werbeeinblendungen im Fernsehen oder Radio laut aufgestöhnt haben. Nun sich aber bereitwillig und freiwillig Werbung für Produkte ansehen, die nichts anderes als hohle Versprechen sind. Denn um nichts Anderes geht es am Ende, um Werbung, für die die Großen in diesem Geschäft bis zu fünfstellige Zuwendungen erhalten. Doch die Wirkung dieses Contents, der in Wirklichkeit keiner ist, so Nymoen und Schmitt, zementiert längst überholt geglaubte Stereotypen, entpolitisiert und ist eine weitere unangenehme Version des kapitalistischen Neoliberalismus. Mit Demokratie, Offenheit und Fortschritt haben diese Filmchen nichts zu tun. Im Gegenteil, sie untergraben die Fortschritte, die wir schon vor dem Internet gemacht hatten. Eine streckenweise böse Abrechnung mit der digitalen Gegenwart, die die Autoren auch nicht schön schminken.
Den einzigen »Influencer«, den ich gelegentlich in YouTube schaue, ist Stephan Wiesner. Der erzählt jedoch weder etwas über Schminken, noch über Bodybuilding oder Reisen, sondern über Fotografie. Er ist also Fachmann für Fotografie, nicht im eigentlichen Sinne Influencer. Auch wenn er Leute beim Kauf von Kameras oder beim Fotografieren beeinflussen mag. Nymoen und Schmitt meinen eine ganz andere Gruppe von Leuten, die ein relativ junges Phänomen sind. Zwar hat auch Wiesner über 180.000 Follower, gegen die Millionen der Kardashians oder Hiltons ist das eher ärmlich. Stattdessen wollen die Autoren analysieren, warum sich so viele Leute bedeutungslose bis unsinnige Videos und Stories in Instagram oder TikTok ansehen, die mit der Realität praktisch nichts mehr zu tun haben. Nicht speziell um die Inhalte geht es, sondern woher diese Protagonisten der digitalen Welt historisch stammen, wie sie arbeiten und welche Konsequenzen ihre Geschichten gesellschaftlich bis politisch haben. Warum sie so viele Leute binden, die früher bei Werbeeinblendungen im Fernsehen oder Radio laut aufgestöhnt haben. Nun sich aber bereitwillig und freiwillig Werbung für Produkte ansehen, die nichts anderes als hohle Versprechen sind. Denn um nichts Anderes geht es am Ende, um Werbung, für die die Großen in diesem Geschäft bis zu fünfstellige Zuwendungen erhalten. Doch die Wirkung dieses Contents, der in Wirklichkeit keiner ist, so Nymoen und Schmitt, zementiert längst überholt geglaubte Stereotypen, entpolitisiert und ist eine weitere unangenehme Version des kapitalistischen Neoliberalismus. Mit Demokratie, Offenheit und Fortschritt haben diese Filmchen nichts zu tun. Im Gegenteil, sie untergraben die Fortschritte, die wir schon vor dem Internet gemacht hatten. Eine streckenweise böse Abrechnung mit der digitalen Gegenwart, die die Autoren auch nicht schön schminken.
 Als das Internet sich Anfang der 1980er verbreitete, war es ein Medium der Wissenschaftler und Ingenieure. Der Zugang war beinahe elitär und mühsam. Mitte der 1990er, mit dem World Wide Web, nutzten es zunehmend auch Privatleute, besonders Musiker, Journalisten, Verlage und erste Online-Händler. Kommerziell wurde das WWW erst mit dem Jahrtausendwechsel. Bestand das WWW dort noch aus Abertausenden kleiner und gleichberechtigter Server, wird das Internet im 21. Jahrhundert vor allen Dingen von den großen Plattformen beherrscht, Facebook und Google, Amazon und Instagram, Microsoft und Apple. Der Begriff der Plattform in diesem Sinne ist relativ jung, doch Plattformen im technischen Sinne gibt es schon lange. Technologisch war es zum Beispiel das System /360 von IBM. Zum ersten Mal versprach der Hersteller, dass alle ab jetzt investierte Software und Hardware praktisch unbegrenzt über die weitere Entwicklung hinaus genutzt werden konnte. Andere Plattformen kamen auf, obwohl sie noch nicht so genannt wurden. Der Apple II, der IBM-PC, später Smartphones mit Android und iOS. Was diese Plattformen sind, wie sie ihre Macht in Netz, Gesellschaft, Kultur und Politik gewannen, wie sie funktionieren und warum, stellt Michael Seemann in diesem nicht gerade schmalen Buch vor. Er beginnt mit der aus seiner Sicht ersten disruptiven Netzanwendung: Napster. Napster stellte nicht nur technisch eine Neuerung dar, sondern forderte zum ersten Mal Wirtschaft und Politik heraus. Der MP3-Tauschdienst ging unter, doch er hatte eine riesige Welle ausgelöst, die nicht nur das Netz, sondern auch unser Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert hat. Ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben.
Als das Internet sich Anfang der 1980er verbreitete, war es ein Medium der Wissenschaftler und Ingenieure. Der Zugang war beinahe elitär und mühsam. Mitte der 1990er, mit dem World Wide Web, nutzten es zunehmend auch Privatleute, besonders Musiker, Journalisten, Verlage und erste Online-Händler. Kommerziell wurde das WWW erst mit dem Jahrtausendwechsel. Bestand das WWW dort noch aus Abertausenden kleiner und gleichberechtigter Server, wird das Internet im 21. Jahrhundert vor allen Dingen von den großen Plattformen beherrscht, Facebook und Google, Amazon und Instagram, Microsoft und Apple. Der Begriff der Plattform in diesem Sinne ist relativ jung, doch Plattformen im technischen Sinne gibt es schon lange. Technologisch war es zum Beispiel das System /360 von IBM. Zum ersten Mal versprach der Hersteller, dass alle ab jetzt investierte Software und Hardware praktisch unbegrenzt über die weitere Entwicklung hinaus genutzt werden konnte. Andere Plattformen kamen auf, obwohl sie noch nicht so genannt wurden. Der Apple II, der IBM-PC, später Smartphones mit Android und iOS. Was diese Plattformen sind, wie sie ihre Macht in Netz, Gesellschaft, Kultur und Politik gewannen, wie sie funktionieren und warum, stellt Michael Seemann in diesem nicht gerade schmalen Buch vor. Er beginnt mit der aus seiner Sicht ersten disruptiven Netzanwendung: Napster. Napster stellte nicht nur technisch eine Neuerung dar, sondern forderte zum ersten Mal Wirtschaft und Politik heraus. Der MP3-Tauschdienst ging unter, doch er hatte eine riesige Welle ausgelöst, die nicht nur das Netz, sondern auch unser Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert hat. Ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben.
Mal kein Buch, sondern ein Magazin. Es heißt MaxPlanckForschung, erscheint vier Mal im Jahr und kann kostenlos als gedruckte Version oder als E-Book bezogen werden. Die MaxPlanckForschung ist das kostenlose Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft und berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an ihren Instituten. Es hat den Anspruch, wissenschaftliche Themen verständlich aufzubereiten. Das Magazin wendet sich an interessierte Laien, an Schüler, Lehrer und Journalisten. Das stimmt, wenn man wenigstens gewisse Grundlagen in Physik und Chemie hat. Dann liefert MaxPlanckForschung einen wertvollen Überblick über aktuelle Forschung und deren Ergebnisse, sehr gut geschrieben und verständlich, nicht wie eine wissenschaftliche Arbeit, sondern eher im Stil von GEO. Es ist machmal erstaulich, was es alles kostenlos gibt.
Abonnieren kann man MaxPlanckForschung unter abo.mpg.de.
8. März 2021, die Buchhandlungen öffnen wieder. Also auf nach Salzkotten und die Buchhandlung Meschede mal persönlich in Augenschein nehmen. Leider kaum Sachbücher im Angebot, nur Romane und Reiseliteratur, also werde ich bestellen und abholen müssen. Doch ein Buch fiel mir auf. Leider erinnerte mich der Titel an ein unsägliches Werk eines rechtspopulistischen Autors, doch nachdem ich den Autor dieses Buches und den Untertitel sah, nahm ich das Buch doch mit. Von Michael Winterhoff habe ich schon einige Bücher gelesen, deutscher Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut und Autor. In seinem neusten Buch aus 2021 setzt er sich mit dem deutschen Schulwesen auseinander. Natürlich nicht als eingebildeter Pädagoge, sondern aus seiner Sicht als Psychiater und Psychotherapeut. Hobby-Virologen und eingebildete Wissenschaftler haben wir zur Zeit schon genug. Und er tut das genau so wie in seinen früheren Büchern auf Basis seiner Erfahrungen und seinem Wissen über Kinder und ihre psychische Entwicklung, aus seinen Tätigkeiten als Berater in Politik und Wirtschaft. Zwar bin auch ich kein Pädagoge, aber als Nachhilfelehrer schon mit den Merkwürdigkeiten und Eigenheiten des aktuellen Nachwuchses konfrontiert. In gewisser Weise hat mich Winterhoff beruhigt, dass ich mit meiner Wahrnehmung nicht alleine da stehe. Weniger beruhigt hat mich der Zustand unseres Bildungssystems. Das er treffend und klar analysiert.
Dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck sagt man eine verständliche und klare Sprache nach. Was zu seinen früheren Studienfächern Philosophie, Germanistik und Philologie passt, gerade die Philosophie hat sich lange und intensiv damit auseinander gesetzt, welche Wechselwirkung Sprache und die Welt haben. Wenn nun Politiker Bücher über Sprache schreiben, macht mich das immer neugierig, in diesem Fall ist der Aufwand dazu überschaubar, denn das Buch ist ein schmales Werk. Trotzdem ist der Anspruch aus meiner Sicht groß und wichtig, denn der Untertitel lautet schließlich Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht. Nebenbei wollte ich einfach ein wenig mehr darüber erfahren, wie Robert Habeck so tickt, gilt er doch als einer der bodenständigen Politiker. Das bekommt man tatsächlich mit, seine politischen Positionen sind keine Pose, seine Beiträge kein Image-Getue. Dazu liefert Habeck schon wichtige Gedanken zur politischen Sprache. Und wie Sprache die Wirklichkeit erst schafft.
Beide, Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, und Friedemann Schulz von Thun, einer der wichtigsten Kommunikationspsychologen im deutschsprachigen Raum, gehören zu meinen Lieblings-Autoren. So kam das 2020 erschienene Buch sofort auf die Leseliste. Beide haben in ihren jeweiligen Fachgebieten wesentliche Beiträge geliefert. Pörksen zu den aktuellen, besonders digitalen Medien. Er hat auch den Begriff der Erregungsgesellschaft geprägt, in der heute Menschen nur noch mit digitalen Medien beschäftigt sind, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, der nächsten Empörung und dem nächsten Skandal. Eigentlich etwas konträr dazu hat Friedemann Schulz von Thun die analoge Kommunikation zwischen Menschen untersucht. Dazu hat er mehrere Bücher veröffentlicht, wie zum Beispiel das dreibändige Werk Miteinander reden, in dem er Methoden wie das Vier-Ohren-Modell und das Kommunikations-Quadrat verwendet.
Im Vergleich zu anderen Büchern, gerade in diesem Themenbereich, ist das Buch keine Analyse oder Beschreibung von Erfahrungen, sondern eine Zusammenfassung von Gesprächen zwischen Pörksen und von Thun seit 2014. Initiert hatte die Gespräche Pörksen, mit dem Ziel medienwissenschaftliche und kommunikationspsychologische Perspektiven zusammen zu führen. Um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die jedes einzelne Gebiet eben nicht gewinnen konnte. Das Ergebnis ist eine sehr interessante Sicht auf digitale Medien, die Veränderung von Kommunikation über die Zeit, nicht zuletzt bis hin zu einem Verständnis, warum pöbelnde und lügende Politiker trotzdem so viel Aufmerksamkeit und Zustimmung erhalten.
Das Buch ist schon im Jahre 2004 erschienen, trotzdem hat es nichts an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil, mit Social Media wie Instagram und Facebook ist es noch schlimmer geworden, wie Menschen sich in Szene setzen und eine Wirklichkeit konstruieren, die gar nicht existiert. Auf das Buch bin ich eher zufällig gestoßen, als ich ein anderes Buch des Autors suchte. Professor Dr. Bernhard Pörksen, Jahrgang 1969, studierte Germanistik, Journalistik und Biologie in Hamburg und den USA, volontierte beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt und arbeitet neben Forschung und Lehre seit über zwanzig Jahren als Journalist und Sachbuch-Autor. Seine Analysen der Kommunikation und des Kommunikationsverhaltens fand ich immer wieder faszinierend. Was für dieses Buch dann auch gilt. Junge Journalisten interviewen Menschen, die als Politiker oder Stars im Rampenlicht stehen. So simpel das Konzept erscheint, so verblüffend sind die Ergebnisse.
Noch einmal sehr schön zusammen gefasst von den Profis:
https://www.deutschlandfunk.de/politischer-journalismus-die-kunst-des-guten-interviews.2907.de.html
Ich misstraue kleinen Büchern zu großen Themen. Der Anspruch der Autorin, auf knapp 180 Seiten in DIN A5 jemandem die Grundlagen des Textens zu vermitteln, erschien mir doch etwas groß. Auch ihr Name war mir noch nie untergekommen. Nicht mal der Verlagsname sagte mir etwas. Am Ende musste ich zurück rudern. Natürlich kann man in diesem Format nicht alle Feinheiten des Stils wie bei Wolf Schneider oder eine belastbare Kenntnis über Typographie vermitteln. Das will Doris Märtin auch nicht, an der Stelle ist sie ehrlich und erhebt gerade diesen Anspruch nicht. Sondern liefert eine überschaubare, dabei praxisnahe Einführung ins professionelle Schreiben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Von den vielen Büchern, Artikeln und Beiträgen, die ich in letzter Zeit gehört habe, oder zu den gehörten Podcasts vom DLF, WDR und SPON, habe ich mit dem Buch von Cornelia Koppetsch zum ersten Mal das Gefühl gehabt, eine Ahnung zu bekommen, was zur Zeit los ist. Auch wenn das Buch mühsam war. Aber es gab mehr zu begreifen. Ich musste ebenso meine eigene Rolle und mein eigenes Selbstverständnis in Frage stellen, meine Sicht der Welt relativieren. Genau so habe ich jetzt den Eindruck, dass die Rolle von PEGIDA und AfD eine andere ist, der mit Reden oder Verständnis zeigen wenig beizukommen sein wird. Das Buch Die Gesellschaft des Zorns wird mir im Rückblick auf meine eigene Vergangenheit klarer und verständlicher. Daher ein selbstkritischer Rückblick in meine Geschichte.
Seit vielen Jahren höre ich, bedingt durch meine Autobahnfahrten, im Mittel fünf bis sechs Stunden pro Woche Podcasts. Dank WDR5 und Deutschlandfunk, 4000 Hertz und Spiegel Online bin ich eher überversorgt und kann oft Themen erst einige Wochen nach Ausstrahlung abarbeiten. Manche Sendungen sind informativ und zugleich unterhaltend, wie Alles in Butter mit Helmut Gote, manche üben das Denken und den Verstand, wie Das Philosophische Radio mit Jürgen Wiebicke. Und doch lässt sich dann und wann ein Erkenntnisgewinn verbuchen. Bisher nicht sehr häufig war das beim Spiegel Online-Podcast Der Debatten-Podcast von Sascha Lobo der Fall. Bis dann eine Sendung in meinem Auto ans Laufen kam, die meinen Blick nicht nur auf Soziale Medien, sondern insgesamt auf unsere Gesellschaft nicht unbedingt verändert, aber erklärlicher gemacht hat. Das legt Lobo plausibel und verständlich auf, und das macht die Folge #81 seines Podcastes so bemerkenswert.
 Vor drei Monaten habe ich mich weitgehend bei Facebook verabschiedet. Weitgehend deshalb, weil ich die Social Media-Kanäle des Unternehmens beackere, für das ich broterwebsmäßig unterwegs bin. Ein Résumé über die Zeit nach Facebook. Oder wenigstens der vorsichtige Versuch.
Vor drei Monaten habe ich mich weitgehend bei Facebook verabschiedet. Weitgehend deshalb, weil ich die Social Media-Kanäle des Unternehmens beackere, für das ich broterwebsmäßig unterwegs bin. Ein Résumé über die Zeit nach Facebook. Oder wenigstens der vorsichtige Versuch.
 Es war 1987, als ich meine erste Email-Adresse bekam, sie war nur im Büro verfügbar, und auch nur über einen bestimmten Rechner. Das war eine Targon /35. Sie lautete boettchers.pad@nixdorf.com und hatte auch nur im Umfeld meines Jobs einen Sinn. Nämlich sich mit Kunden und Kollegen weltweit auszutauschen. In dieser Zeit eine Email-Adresse zu haben, machte mich zu einem Mitglied in einem erlauchten Kreis. Es gab keine Milliarden von Email-Adressen damals, vielleicht einige Hundertausende. Auch alle anderen Teilnehmer in diesem frühen Internet waren Ingenieure, Wissenschaftler, vielleicht noch einige Journalisten oder Lehrende. Kommuniziert wurde über Emails oder die Newsgroups. Letztere kennt heute fast niemand mehr, bis zum World Wide Web sollte es noch gut zehn Jahre dauern. Und noch länger bis zum Geschäftsmodell Facebook, das ich nicht mehr länger unterstützen wollte. Nicht wegen Zuckerberg, sondern aus anderen Gründen.
Es war 1987, als ich meine erste Email-Adresse bekam, sie war nur im Büro verfügbar, und auch nur über einen bestimmten Rechner. Das war eine Targon /35. Sie lautete boettchers.pad@nixdorf.com und hatte auch nur im Umfeld meines Jobs einen Sinn. Nämlich sich mit Kunden und Kollegen weltweit auszutauschen. In dieser Zeit eine Email-Adresse zu haben, machte mich zu einem Mitglied in einem erlauchten Kreis. Es gab keine Milliarden von Email-Adressen damals, vielleicht einige Hundertausende. Auch alle anderen Teilnehmer in diesem frühen Internet waren Ingenieure, Wissenschaftler, vielleicht noch einige Journalisten oder Lehrende. Kommuniziert wurde über Emails oder die Newsgroups. Letztere kennt heute fast niemand mehr, bis zum World Wide Web sollte es noch gut zehn Jahre dauern. Und noch länger bis zum Geschäftsmodell Facebook, das ich nicht mehr länger unterstützen wollte. Nicht wegen Zuckerberg, sondern aus anderen Gründen.