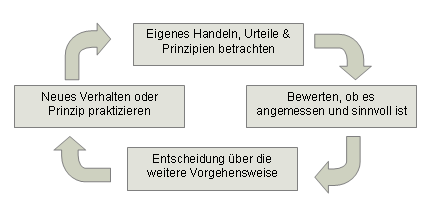Im ersten Artikel zum Thema ging es mehr um technische und organisatorische Voraussetzungen für Webinars. Das ist aber nur die halbe Miete für erfolgreiche Online-Veranstaltungen, denn selbst wenn organisatorisch alles bestens klappt, kann die Durchführung gerade online viel schwieriger werden als in einer Präsenzveranstaltung. Weil …
Im ersten Artikel zum Thema ging es mehr um technische und organisatorische Voraussetzungen für Webinars. Das ist aber nur die halbe Miete für erfolgreiche Online-Veranstaltungen, denn selbst wenn organisatorisch alles bestens klappt, kann die Durchführung gerade online viel schwieriger werden als in einer Präsenzveranstaltung. Weil …
- Es gibt kein Feedback zwischen Vortragendem und Publikum, man sieht nicht, ob Leute einschlafen, sich sperren, Widerspruch nonverbal signalisieren.
- Die Hürden für Fragen, Kommentare oder Einwände sind höher, auch wenn Chat-Kanäle in fast allen Programmen für Online-Meetings zur Verfügung stehen.
- Es fehlt die körperliche Präsenz des Trainers oder Seminarleiters, Online-Seminare können wesentlich schneller ermüden oder langweilen.
Ein Webinar ist definitiv einfacher zu planen, aber wesentlich schwieriger durchzuführen als ein Präsenz-Seminar. Wenn es im Sinne einer Aktivierung der Teilnehmer erfolgreich sein soll, müssen die Botschaften und Inhalte zuverlässig bei den Adressaten ankommen. Daher noch ein paar Tipps und Ratschläge, aus der Theorie und der Praxis.
Präsentation
Die Präsentation, die im Webinar verwendet wird, ist nicht nur Vehikel zum Transport von Botschaften, sie ist der rote Faden, sie macht die Struktur, sie führt und leitet. Jede Investition in die Folien zahlt sich aus, daher sollte man an dieser Stelle nicht sparen. Eine „ordentliche“ Präsentation beginnt mit einer Agenda, einer Übersicht über den Verlauf und die Inhalte, die kommen. Diese Agenda sollte bei jedem Abschnittswechsel wieder auftauchen, damit die Hörer darin eine Leitlinie haben und wissen, wo sie gerade stehen. Auf logische Abfolge achten, sonst geht der führende Charakter der Präsentation schnell verloren. Daran denken, dass die Präsentation der zentrale Aspekt des Webinars ist, erst danach kommt die Stimme des Präsentierenden.
Was in vielen Präsentation in Bullet-Listen, Diagrammen und endlosem Text verloren geht, ist das, was im Vordergrund stehen soll: die Kernbotschaften. Das, was vermittelt werden soll und was hängen bleiben muss. Warum ist dieses neue Produkt so großartig und wichtig? Warum ist es so wichtig und entscheidend, dieses Wissen oder diese Kenntnisse zu haben? Argumentieren ist gefragt, Vorteile und Gewinne darzustellen. Nur das, was uns einen Gewinn, einen Vorteil oder eine positive Veränderung bietet, kommt durch und bleibt hängen. Damit solche Inhalte ankommen, ist nicht nur Klarheit und Struktur wichtig, sondern auch das, was Lernen immer beeinflusst, nämlich Wiederholungen. Kernbotschaften wiederholen und platzieren, wo immer sie passen. Und zu den Kernbotschaften gehört es, dass ein aktives Ziel für die Präsentation definiert wird, was ist das Ziel und was ist der Sinn der Geschichte? Zeigen, nicht erzählen, ein wichtiger journalistischer Grundsatz.
Noch mal zum Thema Inhalte und Layout, schon oft gehört, aber immer wieder gerne vergessen. Die schon angesprochenen Bullet-Listen, Diagramme und Textwüsten vermeiden, sie langweilen, sie haben keine offensichtlichen Botschaften. Stattdessen viel mit Bildern arbeiten, die emotional ansprechen. Botschaften statt Bleiwüsten, Argumente statt Kuchenscheiben, Geschichten erzählen statt Fakten aufzählen. Auch nicht vergessen, in der Präsentation Highlights zu setzen, um immer wieder zu wecken und zu motivieren. Und lieber die Folien übersichtlich und in ihren Aussagen reduziert halten als den Teilnehmer mit Grafiken, Text und Zahlen zu erschlagen. Der Teilnehmer soll uns zuhören, und nicht lesen. Daher sind Bilder viel hilfreicher, sie lenken weniger ab und sprechen oft mehr als Text. Text spricht im Grunde nie, weil über ihn wenig Emotionales zu übermitteln ist.
Dazu noch ein kleines eBook von Anita Hermann-Ruess: Speak limbic.
Jeder Jeck ist anders
Im günstigsten Fall kennt man die Leute, die auf der anderen Seite sind, persönlich. Um ungünstigten Fall sind es völlig Fremde. Der Grund, dass ich speziell darauf eingehe, ist der, dass die Motivation der Teilnehmer grundverschieden sein kann und wird, und damit auch die Wahrnehmung. Ich hole etwas aus, um das Problem zu umreißen.
Unsere Wahrnehmung ist nicht neutral, wir filtern eingehende Informationen nach dem, was uns interessiert oder was unseren Zielen dient. Mein Lieblingsbeispiel: zwei Männer gehen durch eine Stadt, der Architekt sieht nur die Gebäude, der andere nur die jüngere weibliche Bevölkerung. Genauso ist die Wahrnehmung unserer Teilnehmer unterschiedlich. Am einfachsten ist noch der Vertriebler, dem es am wichtigsten ist, möglichst viel Umsatz und persönlichen Gewinn zu machen. Für ihn zählen Begriffe wie Value Proposition, Rendite, Argumentation. Die Frau aus dem Marketing denkt, angenommen, mehr in Bindungsaspekten, sie reagiert eher auf persönliche Ansprache, Zahlen und Fakten beeindrucken sie wenig. Und der Youngster aus dem Produkt-Management ist auf der Suche nach Neuem, Aufregendem und Innovativem. Ihn interessiert weder Bindung noch persönlicher Gewinn, er ist iPhone-Besitzer, er sucht den Kick, das Unbekannte.
Diese drei Teilnehmer haben ihren Interessen und Erwartungen entsprechend unterschiedliche Wahrnehmung. Und man könnte hier noch weitere Wahrnehmungs-Archetypen finden. Mit Zahlenkolonnen und Balkendiagrammen kann man überzeugte Buchhalter ansprechen, den Rest nicht. Unser Ziel muss es sein, alle Teilnehmer zu erreichen, den in Euro denkenden Vertriebler, den Innovations-Sucher und den Bindungs- oder Sicherheitssucher, der gerne hören möchte, dass wir auch dieses Mal alles so machen, wie wir das schon immer gemacht haben. Nur so können wir unsere Botschaften herüber bringen und zu Ergebnissen kommen.
Wie können wir die unterschiedlichen Wahrnehmungstypen erreichen? Indem wir allen etwas bieten, was ihrem Erwartungsprofil entspricht. Dem Vertriebler seine Margen, dem Innovativen seinen Hype. Die Wege dazu sind einfach: Zahlen und Fakten sind hilfreich, doch ansonsten viel mit Bildern und Geschichten arbeiten, reale Beispiele, Erfolgsgeschichten, Botschaften, Ziele. Auf jeden Fall zu vermeiden sind von Text überbordende Folien, die beliebten Bullet-Listen n-ter Verschachtelung. Layout und Inhalte einfach halten und auf die verschiedenen Zielgruppen ausrichten. Struktur und Logik beibehalten, Botschaften und Keymessages inszenieren, Abwechselung bieten und, wenn möglich, Interaktion nutzen. Abstimmungen oder Kommentare über Chat anfordern, den Teilnehmer in der Präsentationen halten und ansprechen, auf möglichst vielen Kanälen und mit den entsprechenden Reizen für die so verschiedenen Wahrnehmungstypen.
Mal anders machen
 Um Webinars angenehmer und interessanter zu machen, sind auch Erweiterungen denkbar, die Farbe und Abwechselung hinein bringen. So nehme ich mir gerne einen Co-Moderator dazu, wie den Entwickler eines Produktes oder einen Spezialisten zu einem speziellen Aspekt des Themas. Vorausgesetzt, dass diese Person für diese Zwecke brauchbar ist, was Sprache und Kommunikations-Fähigkeiten angeht. Hat man den Richtigen an seiner Seite, können das dann so richtig lustige Veranstaltungen werden. Für die Zuhörer kommen nun unterschiedliche Stimmen ins Spiel, und die Fokussierung der Zuhörer steigt. In diesem Fall ist die Technik etwas aufwändiger, meistens kann man nur ein Mikro und Headset an einen PC anschließen, ich verwende daher ein Mischpult und einen kleinen Verstärker, an den man mehrere Kopfhörer anschließen kann. Auch verwende ich nicht das Micro des Headsets, sondern ein Kondensator-Mikro, das wesentlich bessere Audio-Qualität bietet (zwischen den Monitoren zu ahnen).
Um Webinars angenehmer und interessanter zu machen, sind auch Erweiterungen denkbar, die Farbe und Abwechselung hinein bringen. So nehme ich mir gerne einen Co-Moderator dazu, wie den Entwickler eines Produktes oder einen Spezialisten zu einem speziellen Aspekt des Themas. Vorausgesetzt, dass diese Person für diese Zwecke brauchbar ist, was Sprache und Kommunikations-Fähigkeiten angeht. Hat man den Richtigen an seiner Seite, können das dann so richtig lustige Veranstaltungen werden. Für die Zuhörer kommen nun unterschiedliche Stimmen ins Spiel, und die Fokussierung der Zuhörer steigt. In diesem Fall ist die Technik etwas aufwändiger, meistens kann man nur ein Mikro und Headset an einen PC anschließen, ich verwende daher ein Mischpult und einen kleinen Verstärker, an den man mehrere Kopfhörer anschließen kann. Auch verwende ich nicht das Micro des Headsets, sondern ein Kondensator-Mikro, das wesentlich bessere Audio-Qualität bietet (zwischen den Monitoren zu ahnen).
Kleine Geschichten, Comics oder Bilder können ebenso den Verlauf der Präsentation auflockern, es ist aber immer ein Navigieren am Rande der Struktur. Wenn man eine Geschichte hat, und sie passt zum Thema oder verdeutlicht es sogar, spricht nichts dagegen. Videos oder Musik geht über viele Tools für Online-Präsentationen eh nicht, weil die Bandbreite zu gering ist.
Am Ende
Die meisten Präsentationen enden mit einer Dankeschön-Folie, was den Teilnehmer ins Leere laufen lässt und er sich fragt, was er denn nun mit dem Gebotenem machen soll. Ich würde etwas anderes vorschlagen. Zusammenfassung der Inhalte, Anregung zum aktiven Umsetzen der Inhalte, Kernbotschaften ein weiteres Mal wiederholen. Fragen und Kommentare brauche ich nicht explizit einzufordern, wem etwas auf der Seele liegt, wird das auch einbringen, daher ist die Frage nach Kommentaren an sich überflüssig. Und nicht alle Leute da draußen haben Headsets. Manchmal sogar keiner. Bedanken ja, aber mündlich reicht, nicht verwässern, nicht zurück rudern.
Der Anfang und das Ende der Präsentation sind die Punkte, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, also diese Momente auch nutzen, um Botschaften und Appelle unterzubringen und zum Handeln aufzufordern.
Fazit
Die wesentlichen Punkte noch einmal in der Übersicht.
- Kernbotschaften klar definieren und aussprechen, wiederholen und inszenieren.
- Highlights setzen, regelmäßig wecken, Interaktion anregen.
- Die unterschiedlichen Motivationen und damit Wahrnehmungen beachten und respektieren. Möglichst viele Erwartungshaltungen berücksichtigen und befriedigen.
- Die Präsentation frei von Bullet-Listen, Bleiwüsten und Zahlenschlachten halten, stattdessen mit Bildern, Geschichten und nachweisbaren Erfolgen arbeiten. Beispiele greifbar und für jeden nachvollziehbar machen.
- Klare Struktur der Präsentation, Agenda durch die Präsentation verwenden und Orientierung und Leitfaden anbieten.
- Zeigen, nicht erzählen. Früher zählte das Erreichte, heute reicht oft das Erzählte, das ist kein erfolgreicher Weg in einer Präsentation.
- Am Ende Kernbotschaften nochmals wiederholen, zum Handeln auffordern, Ziele definieren.
Für ganz wesentlich halte ich es, neben Zahlen und Fakten die emotionale Wirkung von Bildern und Geschichten von realen Personen zu nutzen. Wir sind heute stark gesellschaftlich dahin gehend geprägt, dass Zahlen und Fakten am wichtigsten seien, dass sie die schlagenden Argumente sind. In der Tat, wie Richard David Precht es formulierte, wedelt meistens der emotionale Hund mit seinem rationalen Schwanz. Entscheidungen werden ganz stark von emotionalen Aspekten beeinflusst. „Fühle“ ich mich mit der Entscheidung wohl? „Schmeckt“ mir das Thema? „Hört“ sich das gut an? Es mag wenige Leute geben, die von Zahlen und Fakten überzeugt werden können. Doch das Gros entscheidet im Bauch. Und dazwischen steht das limbische System mit seiner Filterung der Wahrnehmung. An diesem Wächter müssen wir vorbei, nur dann können wir unsere Botschaften an Mann und Frau bringen.
 Nachdem unsere Unternehmens-Seite bei Facebook schon einige Zeit online war, wurde ihr plötzlich die Veröffentlichung entzogen. Mit dem Hinweis, wir hätten gegen Facebook-Regularien verstoßen. Nur brachte auch genaustes Studieren dieser Regeln keine Erkenntnis, was wir verbrochen hatten. Einige Tage später, nach mehreren Nachrichten an Facebook über unterschiedliche Kanäle, wurde die Seite abends um 23 Uhr wieder veröffentlicht. Alles im Lot, so dachten wir. Jedoch: am nächsten Morgen um 5:37 Uhr wurde die Seite erneut ent-öffentlicht. Wir standen vor einem Rätsel. Bis wir feststellten, dass genau an diesem Morgen, kurz nach der Wiederveröffentlichung der Seite, um 5:36 Uhr automatisch ein geplanter Beitrag eingestellt wurde. Mit einem Werbeposter, in dem wir ein Stockfoto von Fotolia verwenden. Danach wurde es klar. Weiteres Nachforschen zeigte eine gefährliche Falle in Facebook. In die man völlig ahnungslos latscht.
Nachdem unsere Unternehmens-Seite bei Facebook schon einige Zeit online war, wurde ihr plötzlich die Veröffentlichung entzogen. Mit dem Hinweis, wir hätten gegen Facebook-Regularien verstoßen. Nur brachte auch genaustes Studieren dieser Regeln keine Erkenntnis, was wir verbrochen hatten. Einige Tage später, nach mehreren Nachrichten an Facebook über unterschiedliche Kanäle, wurde die Seite abends um 23 Uhr wieder veröffentlicht. Alles im Lot, so dachten wir. Jedoch: am nächsten Morgen um 5:37 Uhr wurde die Seite erneut ent-öffentlicht. Wir standen vor einem Rätsel. Bis wir feststellten, dass genau an diesem Morgen, kurz nach der Wiederveröffentlichung der Seite, um 5:36 Uhr automatisch ein geplanter Beitrag eingestellt wurde. Mit einem Werbeposter, in dem wir ein Stockfoto von Fotolia verwenden. Danach wurde es klar. Weiteres Nachforschen zeigte eine gefährliche Falle in Facebook. In die man völlig ahnungslos latscht.