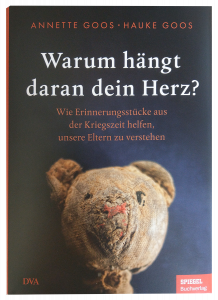Der zweite Weltkrieg ist längst vorbei, seine Spuren und die Dinge, die in dieser Zeit eine Rolle spielten, sind noch da. Dinge wie ein Kleiderbügel, den die Mutter auf der Flucht dabei hatte, ein Trinkbecher, der das Sterben im Krieg verhinderte, oder eine Trillerpfeife und eine Trainingshose, die dem Vater gehörten, der aus dem Krieg nicht zurückkam. Aber auch der Ledermantel eines Nationalsozialisten, der heute als Bekleidung einer Vogelscheuche im Garten dient. Mit ihnen verbindet sich die Erinnerung an Zeiten voller Angst und Leid, für die die Menschen, die sie oft noch als Kind miterlebt haben, zuweilen keine Sprache finden. Es ist nicht nur die Sprachlosigkeit der Kriegskinder, sondern oft auch noch die der Kriegsenkel. Annette und Hauke Goos stellen 36 solcher Erinnerungsstücke vor und lassen ihre Besitzerinnen und Besitzer, darunter Prominente wie die Politiker Björn Engholm und Gerhard Baum, die Schauspielerin Marie-Luise Marjan oder den Autor Paul Maar, von den Dingen erzählen. Zurück geht die Idee für das Buch auf einen Artikel im SPIEGEL in 2019. Herausgekommen ist ein berührendes Buch zu einer Zeit, die weit zurück liegt, aber noch nicht vergangen ist.
Beiträge
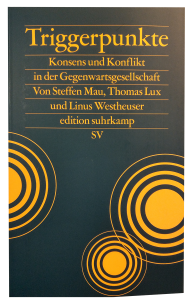 Liest man regelmäßig in den sozialen Medien, aber auch in etablierten Zeitschriften oder schaut man Nachrichten im Fernsehen, könnte man meinen, in unserem Land sei das große Hauen und Stechen ausgebrochen. Ob Migration und Einwanderung, Gendersternchen oder die Ehe für Lesben und Schwule, überall scheint der große Konflikt ausgebrochen. Man dürfe nichts mehr sagen und die Grünen würden eh alles verbieten. Aber stimmt das so überhaupt, dass es in Deutschland nur noch um Streit und extreme Meinungen geht? Der Soziologe Steffen Mau hat sich in einer groß angelegten Studie mit dieser Frage beschäftigt, sowohl in Form von Umfragen als auch in Arbeitsgruppen mit Leuten in mehreren Großstädten. Um die untersuchten Inhalte einzugrenzen und zu wirklich konkreten Aussagen zu kommen, hat er deshalb vier von ihm so genannte Arenen definiert. Die Oben-Unten-Arena, die Innen-Außen-Arena, die Wir-Sie-Arena und die Heute-Morgen-Arena. Während die erste Arena geradezu klassisch ist und es um Umverteilung und soziale Gerechtigkeit geht, sind die weiteren drei Arenen eher Themen der Neuzeit. Es geht im Wesentlichen um Zuwanderung und Migration, um Identität und Zugehörigkeit, zuletzt im Kern um Klimawandel und Ökologie. In allen vier Arenen sollen Ungleichheiten, Diskurse und Konflikte identifiziert werden. Daraus dann abgeleitet, wie gespalten unsere Gesellschaft nun wirklich ist. Die im Vordergrund stehenden Triggerpunkte kommen erst im zweiten Kapitel auf den Tisch. Am Ende mit einem eher wenig überraschenden Ergebnis.
Liest man regelmäßig in den sozialen Medien, aber auch in etablierten Zeitschriften oder schaut man Nachrichten im Fernsehen, könnte man meinen, in unserem Land sei das große Hauen und Stechen ausgebrochen. Ob Migration und Einwanderung, Gendersternchen oder die Ehe für Lesben und Schwule, überall scheint der große Konflikt ausgebrochen. Man dürfe nichts mehr sagen und die Grünen würden eh alles verbieten. Aber stimmt das so überhaupt, dass es in Deutschland nur noch um Streit und extreme Meinungen geht? Der Soziologe Steffen Mau hat sich in einer groß angelegten Studie mit dieser Frage beschäftigt, sowohl in Form von Umfragen als auch in Arbeitsgruppen mit Leuten in mehreren Großstädten. Um die untersuchten Inhalte einzugrenzen und zu wirklich konkreten Aussagen zu kommen, hat er deshalb vier von ihm so genannte Arenen definiert. Die Oben-Unten-Arena, die Innen-Außen-Arena, die Wir-Sie-Arena und die Heute-Morgen-Arena. Während die erste Arena geradezu klassisch ist und es um Umverteilung und soziale Gerechtigkeit geht, sind die weiteren drei Arenen eher Themen der Neuzeit. Es geht im Wesentlichen um Zuwanderung und Migration, um Identität und Zugehörigkeit, zuletzt im Kern um Klimawandel und Ökologie. In allen vier Arenen sollen Ungleichheiten, Diskurse und Konflikte identifiziert werden. Daraus dann abgeleitet, wie gespalten unsere Gesellschaft nun wirklich ist. Die im Vordergrund stehenden Triggerpunkte kommen erst im zweiten Kapitel auf den Tisch. Am Ende mit einem eher wenig überraschenden Ergebnis.
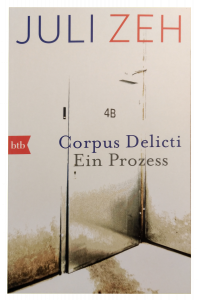 Durch ihren Roman «Über Menschen» war ich zum ersten Mal mit der Autorin Juli Zeh in Kontakt gekommen. Nach einigen schwergewichtigen Sachbüchern konnte ein Roman zwischendurch mal eine willkommene Abwechslung sein, weil mir mein erstes Buch von Juli Zeh doch sehr positiv in Erinnerung geblieben war. Erstmals 2009 erschienen, wird «Corpus Delicti» als eine Art Science Fiction beschrieben. Was meinem allgemeinen Buchgeschmack entgegen kommt. Daran stimmt zwar, dass die Geschichte in der Zukunft spielt, wenn auch nicht in einer fernen Zukunft, doch mit Science Fiktion hat der Roman wenig zu tun. Keine Raumschiffe, keine Außerirdischen und gebeamt wird auch nicht. Es geht um eine politische und gesellschaftliche Zukunft, nicht mehr ganz so fern, irgendwo im 21. Jahrhundert. Ein Deutschland, in dem die höchsten Güter Gesundheit, Hygiene und langes Leben sind. In diesem Deutschland verliert die Protagonistin, Mia Holl, ihren Bruder, der nach falscher Anklage wegen Vergewaltigung und Mord Suizid begeht. Sie glaubt nicht an seine Schuld, macht sich auf die Suche und löst eine politische Lawine aus, die sie am Ende beinahe mit ins Verderben reißt.
Durch ihren Roman «Über Menschen» war ich zum ersten Mal mit der Autorin Juli Zeh in Kontakt gekommen. Nach einigen schwergewichtigen Sachbüchern konnte ein Roman zwischendurch mal eine willkommene Abwechslung sein, weil mir mein erstes Buch von Juli Zeh doch sehr positiv in Erinnerung geblieben war. Erstmals 2009 erschienen, wird «Corpus Delicti» als eine Art Science Fiction beschrieben. Was meinem allgemeinen Buchgeschmack entgegen kommt. Daran stimmt zwar, dass die Geschichte in der Zukunft spielt, wenn auch nicht in einer fernen Zukunft, doch mit Science Fiktion hat der Roman wenig zu tun. Keine Raumschiffe, keine Außerirdischen und gebeamt wird auch nicht. Es geht um eine politische und gesellschaftliche Zukunft, nicht mehr ganz so fern, irgendwo im 21. Jahrhundert. Ein Deutschland, in dem die höchsten Güter Gesundheit, Hygiene und langes Leben sind. In diesem Deutschland verliert die Protagonistin, Mia Holl, ihren Bruder, der nach falscher Anklage wegen Vergewaltigung und Mord Suizid begeht. Sie glaubt nicht an seine Schuld, macht sich auf die Suche und löst eine politische Lawine aus, die sie am Ende beinahe mit ins Verderben reißt.
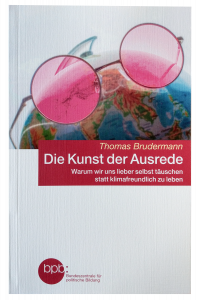 Auf einer Familienfreier kam irgendwann das Thema Klimawandel, Kohlendioxid-Emissionen und Autos. Ein Verwandter meinte dazu im Brustton der Überzeugung: "So lange die Chinesen nix machen, mache ich auch nix!". Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen, dass er einen sehr fleischzentrierten Ernährungsstil pflegt, was an seinem enormen Bauchumfang abzulesen ist. Doch es gibt noch mehr Ausreden. Es sei schon zu spät, der Einzelne könne doch nichts machen, die Erde hätte schon immer Warm- und Kaltzeiten gehabt, oder man sei doch schon klimafreundlich, da komme es mal auf einen einzelnen Flug in den Urlaub doch nicht an. Thomas Brudermann beschäftigt sich mit den Ausredevarianten im Wesentlichen aus Sicht der Verhaltensökonomie und Umweltpsychologie, zwei noch recht jungen Wissenschaftsgebieten. Speziell geht es darum, welche inneren Vorgänge hinter den Ausreden stehen, was die Fakten sind und wie man diesen Ausreden begegnet. In vielen Fällen sind Bequemlichkeit, Verlustängste, Status und schlichtweg Unwissenheit die Hintergründe. Doch es gibt auch einige andere Gründe zum Leugnen des Klimawandels, damit hat mal wieder der Neoliberalismus und der unerschütterliche Glaube an die Märkte zu tun.
Auf einer Familienfreier kam irgendwann das Thema Klimawandel, Kohlendioxid-Emissionen und Autos. Ein Verwandter meinte dazu im Brustton der Überzeugung: "So lange die Chinesen nix machen, mache ich auch nix!". Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen, dass er einen sehr fleischzentrierten Ernährungsstil pflegt, was an seinem enormen Bauchumfang abzulesen ist. Doch es gibt noch mehr Ausreden. Es sei schon zu spät, der Einzelne könne doch nichts machen, die Erde hätte schon immer Warm- und Kaltzeiten gehabt, oder man sei doch schon klimafreundlich, da komme es mal auf einen einzelnen Flug in den Urlaub doch nicht an. Thomas Brudermann beschäftigt sich mit den Ausredevarianten im Wesentlichen aus Sicht der Verhaltensökonomie und Umweltpsychologie, zwei noch recht jungen Wissenschaftsgebieten. Speziell geht es darum, welche inneren Vorgänge hinter den Ausreden stehen, was die Fakten sind und wie man diesen Ausreden begegnet. In vielen Fällen sind Bequemlichkeit, Verlustängste, Status und schlichtweg Unwissenheit die Hintergründe. Doch es gibt auch einige andere Gründe zum Leugnen des Klimawandels, damit hat mal wieder der Neoliberalismus und der unerschütterliche Glaube an die Märkte zu tun.
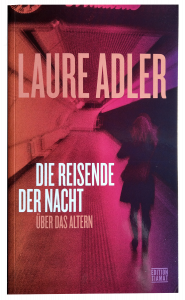 Das Spannende an Büchern ist, dass man nie so genau weiß, was einen erwartet. Erst recht interessant wird es, wenn man selbst vom Thema Betroffener ist. So erwartete ich wegen des Titels erst so etwas wie einen Roman. Doch Laure Adler macht sich in eine andere Richtung auf, ohne sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren. Laure Adler ist einige Jahre älter als ich und widmet sich in Abschnitten, die selten über ein paar Seiten hinaus gehen, dem Alter in all seinen Facetten. Sei es aus eigenen Erfahrungen mit sich selbst und anderen Menschen, in ihrer Familie und bei Freunden, soziale Fragen kommen dazu, selbst politische und philosophische. Kapitel im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Das Bild alter Menschen in der Gesellschaft wird betrachtet, wie es sich in den Epochen verändert hat und wie es in Kulturen so unterschiedlich ist. Wenn man so will, ist das Buch eine umfassende und nachdenkliche Meditation des Zustandes, unter dem die Autorin selbst mal leidet, mal einen Sinn darin zu finden versucht. Der Vorteil der feinen Gliederung ist, dass man darin blättern kann, oder es von hinten nach vorn liest, mal einen langen und mal einen kurzen Abschnitt verfolgt. Wer selbst mit dem Alter konfrontiert ist, wird viele neue Sichtweisen und Gedanken finden, welche Bedeutung das Alter für einen selbst, aber auch für andere Menschen hat. Kein Buch für die Sonnenliege am Pool, eher eines für den Nachttisch. Ein Blumenstrauß philosophischer Gedankensplitter.
Das Spannende an Büchern ist, dass man nie so genau weiß, was einen erwartet. Erst recht interessant wird es, wenn man selbst vom Thema Betroffener ist. So erwartete ich wegen des Titels erst so etwas wie einen Roman. Doch Laure Adler macht sich in eine andere Richtung auf, ohne sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren. Laure Adler ist einige Jahre älter als ich und widmet sich in Abschnitten, die selten über ein paar Seiten hinaus gehen, dem Alter in all seinen Facetten. Sei es aus eigenen Erfahrungen mit sich selbst und anderen Menschen, in ihrer Familie und bei Freunden, soziale Fragen kommen dazu, selbst politische und philosophische. Kapitel im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Das Bild alter Menschen in der Gesellschaft wird betrachtet, wie es sich in den Epochen verändert hat und wie es in Kulturen so unterschiedlich ist. Wenn man so will, ist das Buch eine umfassende und nachdenkliche Meditation des Zustandes, unter dem die Autorin selbst mal leidet, mal einen Sinn darin zu finden versucht. Der Vorteil der feinen Gliederung ist, dass man darin blättern kann, oder es von hinten nach vorn liest, mal einen langen und mal einen kurzen Abschnitt verfolgt. Wer selbst mit dem Alter konfrontiert ist, wird viele neue Sichtweisen und Gedanken finden, welche Bedeutung das Alter für einen selbst, aber auch für andere Menschen hat. Kein Buch für die Sonnenliege am Pool, eher eines für den Nachttisch. Ein Blumenstrauß philosophischer Gedankensplitter.
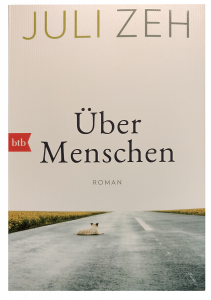 Romane kommen mir eher selten in die Hände. Es sei denn, das Bücherbudget für den Monat ist aufgebraucht, der vierte Band von Precht zur Philosophie ist zu teuer und das örtliche Sortiment zu überschaubar. Obwohl eher zweifelhafte Orientierung, ließ mich dann die Position in der Spiegel-Bestsellerliste zu diesem Buch greifen. Was ich am Ende nicht bereut habe. Es war mein erstes Buch von Juli Zeh, aber es lässt mich in Zukunft vielleicht doch wieder zu dieser Autorin greifen. Der Plot ist eher überschaubar. Die Werbetexterin Dora kauft ein altes Gutshaus in Brandenburg, trennt sich von ihrem Freund Robert in Berlin und lässt sich mit ihrer Hündin Jochen in einem Dorf in der brandenburgischen Einöde nieder. Während sie mit einem riesigen verwilderten Grundstück kämpft, lernt sie nach und nach ihre Nachbarn kennen. Zuerst eine eher unangenehme Figur, den glatzköpfigen Dorf-Nazi Gote, danach Herrn "Heini" Heinrich, der am Anfang R2-D2 heißt. Es folgt das schwule Paar Tom und Steffen. So deutlich die Schubladen, in die sie diese Menschen einsortieren könnte, so undeutlich werden sie im Lauf der Geschichte.
Romane kommen mir eher selten in die Hände. Es sei denn, das Bücherbudget für den Monat ist aufgebraucht, der vierte Band von Precht zur Philosophie ist zu teuer und das örtliche Sortiment zu überschaubar. Obwohl eher zweifelhafte Orientierung, ließ mich dann die Position in der Spiegel-Bestsellerliste zu diesem Buch greifen. Was ich am Ende nicht bereut habe. Es war mein erstes Buch von Juli Zeh, aber es lässt mich in Zukunft vielleicht doch wieder zu dieser Autorin greifen. Der Plot ist eher überschaubar. Die Werbetexterin Dora kauft ein altes Gutshaus in Brandenburg, trennt sich von ihrem Freund Robert in Berlin und lässt sich mit ihrer Hündin Jochen in einem Dorf in der brandenburgischen Einöde nieder. Während sie mit einem riesigen verwilderten Grundstück kämpft, lernt sie nach und nach ihre Nachbarn kennen. Zuerst eine eher unangenehme Figur, den glatzköpfigen Dorf-Nazi Gote, danach Herrn "Heini" Heinrich, der am Anfang R2-D2 heißt. Es folgt das schwule Paar Tom und Steffen. So deutlich die Schubladen, in die sie diese Menschen einsortieren könnte, so undeutlich werden sie im Lauf der Geschichte.
Kaum ein Journalist kann mit dem Namen Wolf Schneider nichts anfangen. In Wikipedia heißt es über ihn:
Von 1995 bis 2012 hielt Wolf Schneider Sprachseminare für Presse und Wirtschaft und war Ausbilder an Journalistenschulen. Er schrieb 28 Sachbücher, darunter Standardwerke wie Deutsch fürs Leben. Was die Schule zu lehren vergaß (1994), Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde (1987), Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil (1982) und Das neue Handbuch des Journalismus. Seit der Ausgabe vom Januar 2012 erscheint Das neue Handbuch des Journalismus unter dem Titel Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus (gemeinsam mit Paul-Josef Raue). Schneider rät zur knappen, aber informationsreichen Schreibweise.
Nun gibt es eine Wolf Schneider KI, die in Schneiders Sinne Texte analysiert oder sogar korrigiert. Ich habe mal einen Absatz aus einer Rezension der KI zur Überprüfung gegeben. So sieht das Ergebnis aus:
| Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen zunehmende Einsamkeit, bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase und eher unerwartet bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Beide Gruppen deshalb, weil bei ihnen starke Veränderung im Lebensverlauf auftreten. Einerseits Eintritt in den Ruhestand, Verlust der Partnerin oder des Partners, Verselbstständigung der Kinder. Dann wieder Studienbeginn, Umzug, Wegbrechen der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden. Das Buch «Einsam in Gesellschaft» mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema Einsamkeit ist zum großen Teil an der TU Dortmund entstanden, durch eine Vortrags- und Diskussionsreihe unter dem Arbeitstitel "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit".
Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz. |
Das Buch "Einsam in Gesellschaft" ist eine Sammlung von Beiträgen zum Thema Einsamkeit, die größtenteils an der TU Dortmund entstanden sind. Es behandelt die zunehmende Einsamkeit bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase sowie bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Diese beiden Gruppen sind besonders betroffen, da sie starke Veränderungen im Lebensverlauf durchmachen. Für ältere Menschen bedeutet dies den Eintritt in den Ruhestand, den Verlust des Partners oder der Partnerin und die Verselbstständigung der Kinder. Für jüngere Menschen wiederum geht es um den Studienbeginn, den Umzug und den Verlust der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden.
Das Buch bietet eine Vielzahl von Beiträgen, die das Thema Einsamkeit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Es reicht von rein wissenschaftlichen Betrachtungen bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Dabei wird deutlich, dass das Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Personen, die mit alleinstehenden oder einsamen Menschen arbeiten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der wissenschaftlichen, insbesondere sozialwissenschaftlichen und psychologischen Betrachtung der Einsamkeit. Dennoch kommen auch praktische Aspekte nicht zu kurz. Insgesamt bietet das Buch eine fundierte und vielseitige Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit. Es liefert sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Einblicke und regt zum Nachdenken an. Die Beiträge sind gut strukturiert und verständlich geschrieben. Die Autoren verwenden klare und präzise Sprache, sodass auch Leser ohne Fachkenntnisse dem Inhalt gut folgen können. Ein positiver Aspekt des Buches ist die Vielfalt der Perspektiven, aus denen das Thema Einsamkeit betrachtet wird. Dies ermöglicht es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Facetten der Einsamkeit zu entwickeln. Die Beiträge sind gut recherchiert und mit konkreten Beispielen untermauert, was ihre Glaubwürdigkeit stärkt. Ein möglicher Kritikpunkt ist, dass das Buch sich hauptsächlich an Fachleute richtet und weniger an Menschen, die selbst von Einsamkeit betroffen sind. Es fehlen konkrete Ratschläge oder Handlungsempfehlungen für Betroffene, die das Buch als Hilfe zur Bewältigung ihrer Einsamkeit nutzen könnten. Insgesamt ist "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit" eine empfehlenswerte Lektüre für Fachleute, die sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen. Es bietet eine fundierte und vielseitige Perspektive auf das Thema und regt zum Nachdenken an. |
Die neue Fassung mag zwar im Sinne von Wolf Schneider lesbarer zu sein, wächst jedoch von 170 Wörtern auf 248 Wörter an. Leider verändert sie auch Sinninhalte.
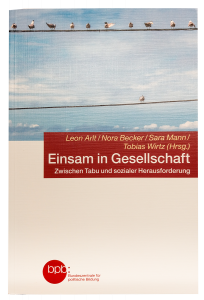 Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen zunehmende Einsamkeit, bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase und eher unerwartet bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Beide Gruppen deshalb, weil bei ihnen starke Veränderung im Lebensverlauf auftreten. Einerseits Eintritt in den Ruhestand, Verlust der Partnerin oder des Partners, Verselbstständigung der Kinder. Dann wieder Studienbeginn, Umzug, Wegbrechen der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden. Das Buch «Einsam in Gesellschaft» mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema Einsamkeit ist zum großen Teil an der TU Dortmund entstanden, durch eine Vortrags- und Diskussionsreihe unter dem Arbeitstitel "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit". Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz.
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen belegen zunehmende Einsamkeit, bei älteren Menschen in der letzten Lebensphase und eher unerwartet bei jüngeren Menschen zwischen 19 und 25 Jahren. Beide Gruppen deshalb, weil bei ihnen starke Veränderung im Lebensverlauf auftreten. Einerseits Eintritt in den Ruhestand, Verlust der Partnerin oder des Partners, Verselbstständigung der Kinder. Dann wieder Studienbeginn, Umzug, Wegbrechen der gewohnten Kontakte zu Familie und Freunden. Das Buch «Einsam in Gesellschaft» mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zum Thema Einsamkeit ist zum großen Teil an der TU Dortmund entstanden, durch eine Vortrags- und Diskussionsreihe unter dem Arbeitstitel "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit". Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz.
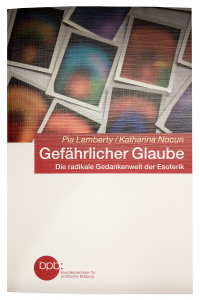 Hat man in Facebook nur gelegentlich auf so etwas reagiert, wenn auch nur aus Neugier, wird man damit überschüttet. Leute, die Terpentin trinken, sich mit ätzenden Desinfektionsmittel einreiben oder abstruse Heilungsmethoden anbieten. Bevorzugt irgendetwas mit Geistern, Astralwesen oder kosmischen Kräften. Der Eindruck, dass Esoterik und Aberglaube gerade wieder groß in Mode sind, täuscht nicht. Leider fast immer verbunden mit Verschwörungsglauben, wenn nicht sogar mit Antisemitismus. Pia Lamberty und Katharina Nocun gehen den vielen Wurzeln dieses Humbugs nach. Tatsächlich ist Esoterik kein Kind der Neuzeit, eine Hochzeit war trotzdem gerade der Zeitraum der Sechziger und Siebziger bis heute. Mit dem Aufkommen der Hippie-Bewegung und des Propagierens eines New Age. Man denke nur an den angeblich endenden Maja-Kalender oder das Zeitalter des Wassermanns. Gefährlich werden solche Konstrukte besonders, wenn sie mit völkischen oder faschistischen Ideologien verbrämt werden. Schaut man genauer dahinter, werden oft die Bezüge zwischen Esoterik und braunem Gedankengut sehr deutlich. Dass Nazis und Esoteriker zusammen auf Demos laufen, dass Impfgegner und Glatzköpfe eine gemeinsame Front bilden, wundert dann nicht mehr. Doch es gibt gerade für Esoteriker und Verschwörungsgläubige eine gemeinsame Basis: Das Gefühl des Kontrollverlustes, Angst vor den galoppierenden Veränderungen und die Abfolge immer neuer Krisen. Das Buch geht auf viele Aspekte und Gefahren ein, zeigt historische Entwicklungen anhand konkreter Personen und Gruppen. Da dürfen natürlich Homöopathie, Rudolf Steiner und seine Lehren, Demeter und Pseudowissenschaften nicht fehlen. Hat man sich mit diesen Themen schon länger beschäftigt, bringt das Buch nicht unbedingt neue Erkenntnisse. Möchte man jedoch einen Einstieg in die schillernde Welt der digitalen Esoterik und der absurdesten Verschwörungstheorien, ist das Buch eine gute Quelle. Zudem es sehr plakativ und erschreckend die Auswirkungen solchen Gedankengutes aufzeigt.
Hat man in Facebook nur gelegentlich auf so etwas reagiert, wenn auch nur aus Neugier, wird man damit überschüttet. Leute, die Terpentin trinken, sich mit ätzenden Desinfektionsmittel einreiben oder abstruse Heilungsmethoden anbieten. Bevorzugt irgendetwas mit Geistern, Astralwesen oder kosmischen Kräften. Der Eindruck, dass Esoterik und Aberglaube gerade wieder groß in Mode sind, täuscht nicht. Leider fast immer verbunden mit Verschwörungsglauben, wenn nicht sogar mit Antisemitismus. Pia Lamberty und Katharina Nocun gehen den vielen Wurzeln dieses Humbugs nach. Tatsächlich ist Esoterik kein Kind der Neuzeit, eine Hochzeit war trotzdem gerade der Zeitraum der Sechziger und Siebziger bis heute. Mit dem Aufkommen der Hippie-Bewegung und des Propagierens eines New Age. Man denke nur an den angeblich endenden Maja-Kalender oder das Zeitalter des Wassermanns. Gefährlich werden solche Konstrukte besonders, wenn sie mit völkischen oder faschistischen Ideologien verbrämt werden. Schaut man genauer dahinter, werden oft die Bezüge zwischen Esoterik und braunem Gedankengut sehr deutlich. Dass Nazis und Esoteriker zusammen auf Demos laufen, dass Impfgegner und Glatzköpfe eine gemeinsame Front bilden, wundert dann nicht mehr. Doch es gibt gerade für Esoteriker und Verschwörungsgläubige eine gemeinsame Basis: Das Gefühl des Kontrollverlustes, Angst vor den galoppierenden Veränderungen und die Abfolge immer neuer Krisen. Das Buch geht auf viele Aspekte und Gefahren ein, zeigt historische Entwicklungen anhand konkreter Personen und Gruppen. Da dürfen natürlich Homöopathie, Rudolf Steiner und seine Lehren, Demeter und Pseudowissenschaften nicht fehlen. Hat man sich mit diesen Themen schon länger beschäftigt, bringt das Buch nicht unbedingt neue Erkenntnisse. Möchte man jedoch einen Einstieg in die schillernde Welt der digitalen Esoterik und der absurdesten Verschwörungstheorien, ist das Buch eine gute Quelle. Zudem es sehr plakativ und erschreckend die Auswirkungen solchen Gedankengutes aufzeigt.
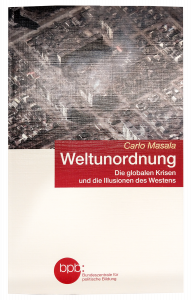 Als 1990 die Berliner Mauer fiel und das Ende der Sowjetunion absehbar war, war es nicht nur das Ende des kalten Krieges zwischen den beiden großen Machtblöcken. Der Westen, also die USA und Europa, hatten sich durchgesetzt. Nicht nur durch militärische, sondern gerade durch ökonomische Überlegenheit. Mit dem Entfall der Bedrohung durch den Osten erwartete man nun, dass sich eine liberale Weltordnung etabliert, mit den wichtigsten Kennzeichen Demokratie und Kapitalismus. Heute, 30 Jahre weiter, ist die Realität eine andere. Nicht nur der Krieg ist zurück in Europa, in der Ukraine, auch der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis eskaliert, europäische Staaten wie Polen und Ungarn, zunehmend die Slowakei und Tschechien, wenden sich von der liberalen Demokratie ab. Die Weltmacht USA hat ihren großen Glanz verloren, China und demnächst Indien sind neue Player auf der Weltbühne. Der Westen, so Masala, sei gleich einer ganzen Reihe von Illusionen aufgesessen. In einem Glauben, die Welt würde sich nun immer weiter demokratisieren, Krisen und Konflikte könnten durch militärische Interventionen gelöst werden. Der peinliche Abzug aus Afghanistan, die verbrannte Erde im Irak und in Somalia erzählen eine andere Geschichte. Die Träume ab 1990 waren Wunschvorstellungen. Carlo Masala fasst die Entwicklungen seit 1990 bis heute zusammen, und zeigt, dass der Westen mit seiner Demokratie und seinen Vorstellungen einer Weltordnung nach seinem Gusto schon lange verloren hat. Die Welt ist in Unordnung geraten, eine neue Ordnung wird lange auf sich warten lassen.
Als 1990 die Berliner Mauer fiel und das Ende der Sowjetunion absehbar war, war es nicht nur das Ende des kalten Krieges zwischen den beiden großen Machtblöcken. Der Westen, also die USA und Europa, hatten sich durchgesetzt. Nicht nur durch militärische, sondern gerade durch ökonomische Überlegenheit. Mit dem Entfall der Bedrohung durch den Osten erwartete man nun, dass sich eine liberale Weltordnung etabliert, mit den wichtigsten Kennzeichen Demokratie und Kapitalismus. Heute, 30 Jahre weiter, ist die Realität eine andere. Nicht nur der Krieg ist zurück in Europa, in der Ukraine, auch der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis eskaliert, europäische Staaten wie Polen und Ungarn, zunehmend die Slowakei und Tschechien, wenden sich von der liberalen Demokratie ab. Die Weltmacht USA hat ihren großen Glanz verloren, China und demnächst Indien sind neue Player auf der Weltbühne. Der Westen, so Masala, sei gleich einer ganzen Reihe von Illusionen aufgesessen. In einem Glauben, die Welt würde sich nun immer weiter demokratisieren, Krisen und Konflikte könnten durch militärische Interventionen gelöst werden. Der peinliche Abzug aus Afghanistan, die verbrannte Erde im Irak und in Somalia erzählen eine andere Geschichte. Die Träume ab 1990 waren Wunschvorstellungen. Carlo Masala fasst die Entwicklungen seit 1990 bis heute zusammen, und zeigt, dass der Westen mit seiner Demokratie und seinen Vorstellungen einer Weltordnung nach seinem Gusto schon lange verloren hat. Die Welt ist in Unordnung geraten, eine neue Ordnung wird lange auf sich warten lassen.
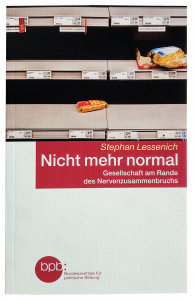 "Deutschland. Aber normal." war eine Wahlparole der AfD in der letzten Bundestagswahl. Was die AfD unter "normal" versteht, ist klar. Eine normale Familie besteht für sie aus Vater, Mutter und Kindern, ein normaler Mann findet nur Frauen sexuell attraktiv, normal ist es, wenn der Titel Doktor selbstverständlich auch Doktorinnen einschließt. Dabei ist der Begriff der Normalität spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts schwer ins Wanken geraten. Eine Norm, von diesem Begriff leitet sich Normalität ab, ist eine willkürliche Definition oder Festlegung, die irgendwann irgendjemand irgendwo mal gemacht hat. Doch für die meisten Menschen heißt normal nur, was die breite Mehrheit richtig, schön oder gut findet. Also genau diese Menschen. Stephan Lessenich hat als Soziologe eine andere Sicht der Dinge. Deshalb widmet er sich in diesem Buch nicht der Frage, was denn nun normal sein soll, sondern warum und wie eigentlich gar nichts mehr normal ist. Mehrere Faktoren haben Normalität inzwischen in Frage gestellt. Minderheiten wie Schwule oder schwarze Deutsche wollen die Zonen der Unsichtbarkeit verlassen, fordern ihren Anteil an sozialer Teilhabe ein. Seit vielen Jahrzehnten fanden es vorwiegend Männer schick, mit dem Auto mit Höchstgeschwindigkeit über bundesdeutsche Autobahnen zu rasen. Der Klimawandel stellt dieses angebliche Recht inzwischen in Frage. Das Aasen mit fossiler Energie hat spätestens ein Ende, nachdem der Möchtegern-Zar in der russischen Hauptstadt kein Öl und Gas mehr liefern darf. Ganz zu schweigen davon, was Corona mit der angeblichen Normalität angestellt hat. Normal ist also so gut wie nichts mehr. Dem Warum geht Stephan Lessenich nach.
"Deutschland. Aber normal." war eine Wahlparole der AfD in der letzten Bundestagswahl. Was die AfD unter "normal" versteht, ist klar. Eine normale Familie besteht für sie aus Vater, Mutter und Kindern, ein normaler Mann findet nur Frauen sexuell attraktiv, normal ist es, wenn der Titel Doktor selbstverständlich auch Doktorinnen einschließt. Dabei ist der Begriff der Normalität spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts schwer ins Wanken geraten. Eine Norm, von diesem Begriff leitet sich Normalität ab, ist eine willkürliche Definition oder Festlegung, die irgendwann irgendjemand irgendwo mal gemacht hat. Doch für die meisten Menschen heißt normal nur, was die breite Mehrheit richtig, schön oder gut findet. Also genau diese Menschen. Stephan Lessenich hat als Soziologe eine andere Sicht der Dinge. Deshalb widmet er sich in diesem Buch nicht der Frage, was denn nun normal sein soll, sondern warum und wie eigentlich gar nichts mehr normal ist. Mehrere Faktoren haben Normalität inzwischen in Frage gestellt. Minderheiten wie Schwule oder schwarze Deutsche wollen die Zonen der Unsichtbarkeit verlassen, fordern ihren Anteil an sozialer Teilhabe ein. Seit vielen Jahrzehnten fanden es vorwiegend Männer schick, mit dem Auto mit Höchstgeschwindigkeit über bundesdeutsche Autobahnen zu rasen. Der Klimawandel stellt dieses angebliche Recht inzwischen in Frage. Das Aasen mit fossiler Energie hat spätestens ein Ende, nachdem der Möchtegern-Zar in der russischen Hauptstadt kein Öl und Gas mehr liefern darf. Ganz zu schweigen davon, was Corona mit der angeblichen Normalität angestellt hat. Normal ist also so gut wie nichts mehr. Dem Warum geht Stephan Lessenich nach.
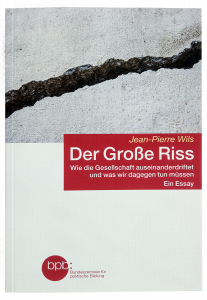 Als Ende März 2020 der erste Lockdown wegen der Covid-19-Pandemie in Kraft trat, war es für einige Menschen beinahe eine Erleichterung. Nämlich für die Leute, die sich von der Schnelllebigkeit und dem Rummel in der westlichen Zivilisation eh überfordert fühlten. Andere Leute verfielen in Sorge um ihr Leben in Panik, trauten sich nicht mehr aus dem Haus. Das Bunkern von Klopapier, Mehl und Nudeln wurde zum Volkssport. Eine weitere Gruppe sah in dem zur Verhängung des Lockdowns am 16. März 2020 notwendigen Parlamentsbeschlusses eine Wiederholung des Ermächtigungsgesetzes, mit dem sich die junge Weimarer Republik quasi selbst entmachtete. Spätestens seit dem Sommer 2020 kursierten die wildesten Verschwörungserzählungen, mal war Bill Gates der böse Bube, mal für die Rechtsextremen die jüdischen Globalisten. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie vulnerabel und instabil unsere Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich sind, wie viele in der jüngeren Vergangenheit falsche Entwicklungen waren. Nun, da aus der Pandemie eine Endemie geworden ist, sollte eigentlich das Leben wieder wie gewohnt weiter gehen. Von den aktuellen Krisen abgesehen. Das Gegenteil ist der Fall. Aus den letzten Jahren sind Querdenker und Verschwörungsgläubige übrig geblieben und suchen sich neue Themen. Dazu zeigt sich eine zunehmende Skepsis gegenüber dem demokratischen Staat und besonders seinen Institutionen. Die Mitte-Studie 2022/23 der Friederich-Ebert-Stiftung zeigt beunruhigende Tendenzen in der deutschen Gesellschaft. Jean-Pierre Wils widmet sich in seinem Essay der Frage, was seit der Pandemie passiert ist, was dazu unsere politische Kultur so verändert hat. Wenig überraschend zeigt er auf, dass dahinter viel ältere Entwicklungen zu finden sind.
Als Ende März 2020 der erste Lockdown wegen der Covid-19-Pandemie in Kraft trat, war es für einige Menschen beinahe eine Erleichterung. Nämlich für die Leute, die sich von der Schnelllebigkeit und dem Rummel in der westlichen Zivilisation eh überfordert fühlten. Andere Leute verfielen in Sorge um ihr Leben in Panik, trauten sich nicht mehr aus dem Haus. Das Bunkern von Klopapier, Mehl und Nudeln wurde zum Volkssport. Eine weitere Gruppe sah in dem zur Verhängung des Lockdowns am 16. März 2020 notwendigen Parlamentsbeschlusses eine Wiederholung des Ermächtigungsgesetzes, mit dem sich die junge Weimarer Republik quasi selbst entmachtete. Spätestens seit dem Sommer 2020 kursierten die wildesten Verschwörungserzählungen, mal war Bill Gates der böse Bube, mal für die Rechtsextremen die jüdischen Globalisten. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie vulnerabel und instabil unsere Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich sind, wie viele in der jüngeren Vergangenheit falsche Entwicklungen waren. Nun, da aus der Pandemie eine Endemie geworden ist, sollte eigentlich das Leben wieder wie gewohnt weiter gehen. Von den aktuellen Krisen abgesehen. Das Gegenteil ist der Fall. Aus den letzten Jahren sind Querdenker und Verschwörungsgläubige übrig geblieben und suchen sich neue Themen. Dazu zeigt sich eine zunehmende Skepsis gegenüber dem demokratischen Staat und besonders seinen Institutionen. Die Mitte-Studie 2022/23 der Friederich-Ebert-Stiftung zeigt beunruhigende Tendenzen in der deutschen Gesellschaft. Jean-Pierre Wils widmet sich in seinem Essay der Frage, was seit der Pandemie passiert ist, was dazu unsere politische Kultur so verändert hat. Wenig überraschend zeigt er auf, dass dahinter viel ältere Entwicklungen zu finden sind.
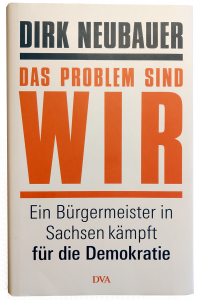 Augustusburg liegt nördlich von Chemnitz. Das überaus nette und gemütliche Örtchen mit dem schönen Schloss habe ich im Mai 2023 kennengelernt, auf meinen üblichen Besuchen im südlichsten Bundesland des deutschen Ostens. Später bekam ich von einer Freundin dieses Buch mit auf den Heimweg. Vom (jetzt) ehemaligen Bürgermeister des Städtchens. Dirk Neubauer war ursprünglich Journalist, hat jedoch 2013 den Sprung in die kommunale Politik gewagt. Er ließ sich zum Bürgermeister wählen, löste so die bisherige Bürgermeisterin der CDU ab. Neubauer selbst trat erst 2017 in die SPD ein, in die Partei, in der die meisten Übereinstimmungen zu seinen Überzeugungen lagen. Als Journalist waren die Voraussetzungen gar nicht mal schlecht. Neubauer hatte sich viel vorgenommen. Er wollte die Politik in seiner Stadt öffnen, wollte Austausch, wollte Bürgerinnen und Bürger beteiligen, wollte Kommunalpolitik transparent machen. Er richtete einen Blog ein, veranstaltete regelmäßige Sprechstunden. So wurde er ein erfolgreicher Bürgermeister, mit Pragmatismus und viel Engagement. In seinem Buch «Das Problem sind wir» berichtet er über diese Zeit, über Erfolge und Hürden, Fehlschläge und Erkenntnisse. Doch wann immer die Rede auf Sachsen oder Thüringen kommt, wird es speziell. Dann geht es um Wahlerfolge der AfD, um Landflucht und die Probleme der ländlichen Regionen, um zerlegte Lebenswege und um den beschwerlichen Weg des Ostens von 1990 in die Gegenwart. Ein Buch aus der Praxis für die Praxis. Mit viel mehr Einsichten, als der Untertitel ahnen lässt.
Augustusburg liegt nördlich von Chemnitz. Das überaus nette und gemütliche Örtchen mit dem schönen Schloss habe ich im Mai 2023 kennengelernt, auf meinen üblichen Besuchen im südlichsten Bundesland des deutschen Ostens. Später bekam ich von einer Freundin dieses Buch mit auf den Heimweg. Vom (jetzt) ehemaligen Bürgermeister des Städtchens. Dirk Neubauer war ursprünglich Journalist, hat jedoch 2013 den Sprung in die kommunale Politik gewagt. Er ließ sich zum Bürgermeister wählen, löste so die bisherige Bürgermeisterin der CDU ab. Neubauer selbst trat erst 2017 in die SPD ein, in die Partei, in der die meisten Übereinstimmungen zu seinen Überzeugungen lagen. Als Journalist waren die Voraussetzungen gar nicht mal schlecht. Neubauer hatte sich viel vorgenommen. Er wollte die Politik in seiner Stadt öffnen, wollte Austausch, wollte Bürgerinnen und Bürger beteiligen, wollte Kommunalpolitik transparent machen. Er richtete einen Blog ein, veranstaltete regelmäßige Sprechstunden. So wurde er ein erfolgreicher Bürgermeister, mit Pragmatismus und viel Engagement. In seinem Buch «Das Problem sind wir» berichtet er über diese Zeit, über Erfolge und Hürden, Fehlschläge und Erkenntnisse. Doch wann immer die Rede auf Sachsen oder Thüringen kommt, wird es speziell. Dann geht es um Wahlerfolge der AfD, um Landflucht und die Probleme der ländlichen Regionen, um zerlegte Lebenswege und um den beschwerlichen Weg des Ostens von 1990 in die Gegenwart. Ein Buch aus der Praxis für die Praxis. Mit viel mehr Einsichten, als der Untertitel ahnen lässt.
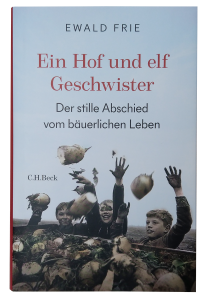 Ewald Frie wurde 1962 im münsterländischen Nottuln geboren. Seine Eltern betrieben einen der Bauernhöfe außerhalb des Dorfes, auf der Horst. Bedingt durch Corona-Krise und deshalb vertagten anderen Projekten begann er, die Geschichte der Familie anhand von Interviews mit seinen Geschwistern und Verwandten nachzuzeichnen. Ergänzt durch Recherchen in Kirchenbüchern, Landesarchiven und Gemeindeverzeichnissen. So entsteht eine umfassende Geschichte des Hofes seit dem Dreißigjährigen Krieg, detaillierter bis in das 20. Jahrhundert. Der eigentliche Sinn des Buches ist aber nicht eine historische Rückschau, sondern zu zeigen, wie sich bäuerliches Leben vom 19. Jahrhundert bis heute gewandelt hat. Mit den großen Veränderungen in den Sechzigern und Siebzigern des letzten Jahrhunderts. Wie drastisch und rapide sich Landwirtschaft in dieser Zeit an den Markt anpassen musste, und wie seine Familie und er selbst diese Anpassungen bewältigten. Überraschend dabei die mal historische Sicht, dann wieder die Sicht auf die Menschen in dieser Zeit und was aus ihnen unter diesen Bedingungen wurde. Das Buch ist historische Arbeit als auch persönliche Reflektion, die eine beeindruckende und faszinierende Geschichte ergeben. Nicht ohne Grund kassierte Frie mit diesem Buch 2023 den Deutschen Sachbuchpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Ewald Frie wurde 1962 im münsterländischen Nottuln geboren. Seine Eltern betrieben einen der Bauernhöfe außerhalb des Dorfes, auf der Horst. Bedingt durch Corona-Krise und deshalb vertagten anderen Projekten begann er, die Geschichte der Familie anhand von Interviews mit seinen Geschwistern und Verwandten nachzuzeichnen. Ergänzt durch Recherchen in Kirchenbüchern, Landesarchiven und Gemeindeverzeichnissen. So entsteht eine umfassende Geschichte des Hofes seit dem Dreißigjährigen Krieg, detaillierter bis in das 20. Jahrhundert. Der eigentliche Sinn des Buches ist aber nicht eine historische Rückschau, sondern zu zeigen, wie sich bäuerliches Leben vom 19. Jahrhundert bis heute gewandelt hat. Mit den großen Veränderungen in den Sechzigern und Siebzigern des letzten Jahrhunderts. Wie drastisch und rapide sich Landwirtschaft in dieser Zeit an den Markt anpassen musste, und wie seine Familie und er selbst diese Anpassungen bewältigten. Überraschend dabei die mal historische Sicht, dann wieder die Sicht auf die Menschen in dieser Zeit und was aus ihnen unter diesen Bedingungen wurde. Das Buch ist historische Arbeit als auch persönliche Reflektion, die eine beeindruckende und faszinierende Geschichte ergeben. Nicht ohne Grund kassierte Frie mit diesem Buch 2023 den Deutschen Sachbuchpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
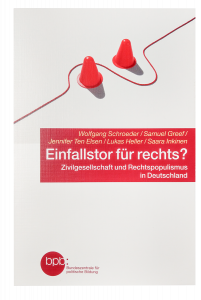 "Die plurale demokratische Zivilgesellschaft ist ein zentrales Element des freiheitlichen Rechtsstaates." So beginnt der Klappentext, doch was ist diese Zivilgesellschaft eigentlich? Einfache Antwort: alle Organisationen und Verbände, in denen sich Bürgerinnen und Bürger zum Nutzen der Gesellschaft oder der Umwelt engagieren. Oder Gleichgesinnte treffen oder Passionen pflegen. Die größten acht sind allen bekannt, nämlich Gewerkschaften und Kirchen, Wohlfahrts- und Naturschutzverbände, Fußball- und Schützenvereine, die freiwillige Feuerwehr und kulturelle Institutionen. Wolfgang Schroeder, Samuel Greef, Jennifer Ten Elsen, Lukas Heller und Saara Inkinen haben sich diese acht zentralen Organisationen in der Hinsicht genauer angesehen, wie weit sie durch rechte Tendenzen und Aktionen beeinflusst oder sogar unterwandert werden sollen. Dazu verwendeten sie einen umfangreichen Fragenkatalog sowie Interviews mit Beteiligten, um herauszufinden, welchen Einfluss Rechtsextreme und Rechtspopulisten dort entfalten. Doch nicht nur als Beobachtung, sondern mit der Frage, wie man menschen- und demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenwirkt. Es ist also wieder eine Facharbeit, die auf Kreis- und Balkendiagrame hinausläuft. Beinahe. Wären da nicht einige interessante Ergebnisse, die man so nicht erwarten würde. Wer meint, dass sexistische oder rassistische Sprüche eher im Schützenverein zu hören wären, oder dass Gewerkschaften doch nur politisch links von Interesse wären, liegt falsch. Vor allen Dingen das Resumé am Ende des Buches zeigt klar und deutlich, wie man rechten Einfluss aus Verbänden fern hält.
"Die plurale demokratische Zivilgesellschaft ist ein zentrales Element des freiheitlichen Rechtsstaates." So beginnt der Klappentext, doch was ist diese Zivilgesellschaft eigentlich? Einfache Antwort: alle Organisationen und Verbände, in denen sich Bürgerinnen und Bürger zum Nutzen der Gesellschaft oder der Umwelt engagieren. Oder Gleichgesinnte treffen oder Passionen pflegen. Die größten acht sind allen bekannt, nämlich Gewerkschaften und Kirchen, Wohlfahrts- und Naturschutzverbände, Fußball- und Schützenvereine, die freiwillige Feuerwehr und kulturelle Institutionen. Wolfgang Schroeder, Samuel Greef, Jennifer Ten Elsen, Lukas Heller und Saara Inkinen haben sich diese acht zentralen Organisationen in der Hinsicht genauer angesehen, wie weit sie durch rechte Tendenzen und Aktionen beeinflusst oder sogar unterwandert werden sollen. Dazu verwendeten sie einen umfangreichen Fragenkatalog sowie Interviews mit Beteiligten, um herauszufinden, welchen Einfluss Rechtsextreme und Rechtspopulisten dort entfalten. Doch nicht nur als Beobachtung, sondern mit der Frage, wie man menschen- und demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenwirkt. Es ist also wieder eine Facharbeit, die auf Kreis- und Balkendiagrame hinausläuft. Beinahe. Wären da nicht einige interessante Ergebnisse, die man so nicht erwarten würde. Wer meint, dass sexistische oder rassistische Sprüche eher im Schützenverein zu hören wären, oder dass Gewerkschaften doch nur politisch links von Interesse wären, liegt falsch. Vor allen Dingen das Resumé am Ende des Buches zeigt klar und deutlich, wie man rechten Einfluss aus Verbänden fern hält.
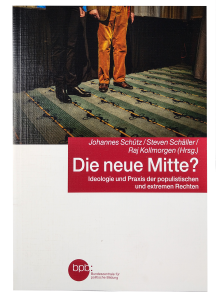 Die Angabe der Herausgeber weist schon darauf hin, dass das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen unterschiedlichster Autoren ist. Genauer handelt es sich um Beiträge, deren Ausgangspunkt in der Tagung «Die neue Mitte? Rechte Ideologien und Bewegungen in Europa» liegt, veranstaltet vom Deutschen Hygiene-Museum in Dresden im September 2018. In diesem Sinne nur eine Übersicht. Erhältlich ist das Buch über die Bundeszentrale für politische Bildung. Es erfasst ein sehr breites Spektrum an Untersuchungen und Analysen zu den vielen Aspekten des Rechtsextremismus, wie Ideen und Ideologien, Akteure, praktische Kritik extrem rechter Milieus, kommunikative Strukturen und Gegenstrategien. Zuerst scheint ein Widerspruch zwischen Titel und Inhalt zu bestehen, doch das täuscht. Die Frage, was und wo denn eigentlich die jeweils politische und gesellschaftliche Mitte in Europa liegt, ist ein zentrales Thema. Praktisch alle Beiträge gehen auf die Frage ein, wie Rechtspopulisten und Rechtsextreme versuchen, sich zu dieser Mitte zu machen, es geht um Verschiebung von Meinungen und dem, was gesagt werden darf, und was nicht. Es geht um Diskurshoheit. Weiterer Fokus liegt auf den Strategien der Neuen Rechten, wie sie schon früh Medien für sich in Anspruch nahmen, sogar schon vor dem World Wide Web das Usenet für ihre Vernetzung nutzten. Es würde zu weit führen, diese vielen Beiträge im Einzelnen darstellen zu wollen. So kann ich eigentlich nur die Lektüre des Buches empfehlen, wenn man an einer wirklich detaillierten Darstellung der vielen Seiten des Rechtextremismus interessiert ist. Auch wenn einzelne Beiträge sehr fachlich orientiert sind. Zum Glück die meisten eben nicht. Wie der über die Situation in der Stadt Bautzen.
Die Angabe der Herausgeber weist schon darauf hin, dass das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen unterschiedlichster Autoren ist. Genauer handelt es sich um Beiträge, deren Ausgangspunkt in der Tagung «Die neue Mitte? Rechte Ideologien und Bewegungen in Europa» liegt, veranstaltet vom Deutschen Hygiene-Museum in Dresden im September 2018. In diesem Sinne nur eine Übersicht. Erhältlich ist das Buch über die Bundeszentrale für politische Bildung. Es erfasst ein sehr breites Spektrum an Untersuchungen und Analysen zu den vielen Aspekten des Rechtsextremismus, wie Ideen und Ideologien, Akteure, praktische Kritik extrem rechter Milieus, kommunikative Strukturen und Gegenstrategien. Zuerst scheint ein Widerspruch zwischen Titel und Inhalt zu bestehen, doch das täuscht. Die Frage, was und wo denn eigentlich die jeweils politische und gesellschaftliche Mitte in Europa liegt, ist ein zentrales Thema. Praktisch alle Beiträge gehen auf die Frage ein, wie Rechtspopulisten und Rechtsextreme versuchen, sich zu dieser Mitte zu machen, es geht um Verschiebung von Meinungen und dem, was gesagt werden darf, und was nicht. Es geht um Diskurshoheit. Weiterer Fokus liegt auf den Strategien der Neuen Rechten, wie sie schon früh Medien für sich in Anspruch nahmen, sogar schon vor dem World Wide Web das Usenet für ihre Vernetzung nutzten. Es würde zu weit führen, diese vielen Beiträge im Einzelnen darstellen zu wollen. So kann ich eigentlich nur die Lektüre des Buches empfehlen, wenn man an einer wirklich detaillierten Darstellung der vielen Seiten des Rechtextremismus interessiert ist. Auch wenn einzelne Beiträge sehr fachlich orientiert sind. Zum Glück die meisten eben nicht. Wie der über die Situation in der Stadt Bautzen.
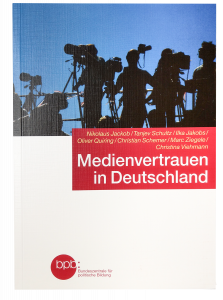 Spätestens seit den PEGIDA-Aufmärschen in Dresden kursiert der Begriff der Lügenpresse wieder. Die Medien und die Politik würden unter einer Decke stecken, als Repräsentanten der "Eliten". Doch was ist dran an den Diskussionen, die Medien würden kein Vertrauen mehr verdienen, seien korrupt und würden die Wahrheit verschweigen? Glaubt tatsächlich eine Mehrheit in Deutschland an diese Zuschreibungen? Die Mainzer Langzeitstudie zu diesen Fragen beschäftigt sich genau mit diesem Thema des Medienvertrauens. Doch wenn man "Medien" sagt, kann man viele Ausprägungen meinen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, etablierte Presse, Boulevard wie BILD und BUNTE, privates Fernsehen bis hin zu Sozialen Medien und den sogenannten Alternativen Medien a'la «Compact» und «KenFM». Welche davon für vertrauenswürdig gehalten werden, hängt von mehreren Faktoren ab, angefangen von der eigenen politischen Position, der privaten wirtschaftlichen Lage, den persönlichen Zukunftsaussichten bis zur jeweiligen Alterskohorte. Doch ist von einer Studie die Rede, nicht von einer redaktionellen Abarbeitung am Thema. Also mal wieder Zahlen und Fakten, Balken- und Liniendiagramme. Doch zum Glück nicht nur.
Spätestens seit den PEGIDA-Aufmärschen in Dresden kursiert der Begriff der Lügenpresse wieder. Die Medien und die Politik würden unter einer Decke stecken, als Repräsentanten der "Eliten". Doch was ist dran an den Diskussionen, die Medien würden kein Vertrauen mehr verdienen, seien korrupt und würden die Wahrheit verschweigen? Glaubt tatsächlich eine Mehrheit in Deutschland an diese Zuschreibungen? Die Mainzer Langzeitstudie zu diesen Fragen beschäftigt sich genau mit diesem Thema des Medienvertrauens. Doch wenn man "Medien" sagt, kann man viele Ausprägungen meinen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, etablierte Presse, Boulevard wie BILD und BUNTE, privates Fernsehen bis hin zu Sozialen Medien und den sogenannten Alternativen Medien a'la «Compact» und «KenFM». Welche davon für vertrauenswürdig gehalten werden, hängt von mehreren Faktoren ab, angefangen von der eigenen politischen Position, der privaten wirtschaftlichen Lage, den persönlichen Zukunftsaussichten bis zur jeweiligen Alterskohorte. Doch ist von einer Studie die Rede, nicht von einer redaktionellen Abarbeitung am Thema. Also mal wieder Zahlen und Fakten, Balken- und Liniendiagramme. Doch zum Glück nicht nur.
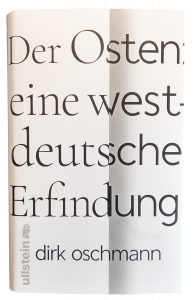 Manchmal gibt es Zufälle, die keine wirklichen Zufälle sind. Dieser Zufall war die Bestellung zweier Bücher in meiner örtlichen Buchhandlung. Beide zusammen führten am Ende zu einem anderen eigenen Bild der west-ost-deutschen Befindlichkeit. Das erste geschrieben von einem Westdeutschen 1990 bis 1991 in Dresden, das andere von einem Ostdeutschen in Ostdeutschland 2023. Ich habe als Untertitel "Eine Streitschrift" gewählt. Denn der Text ist in der Tat zornig, doch Streit sucht der Autor nicht. Dirk Oschmann hatte in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, dass der Westen sich einen Osten nach eigenem Gutdünken zusammen erfindet. Wonach der Osten immer rückständig, unflexibel, faul, demokratieunfähig und undankbar ist. Während Bayern und Rheinländer stolz auf ihren Dialekt sind, gilt Sächsisch als komisch bis nervig. Der Westen sei eben das "Normale", der Osten die Ausnahme. Weshalb der Westen sagen müsse, wo es lang geht und was das Beste für den Osten sei. Diese Sicht ist keine Ausnahme, viele Bücher und Studien, auch eben «Das letzte Jahr» von Martin Gross zeigt, wie der Westen den Osten übernahm. Als Erstes kamen der Einzelhandel und die Baumärkte, dann die westlichen Köpfe der Verwaltungen, der Politik und der Hochschulen. Wie es so schön heißt, der Westen wollte den Osten für den Umsatz und die Gewinne, als billiges Produktionsgebiet bei niedrigen Löhnen. Die Menschen waren nicht erwünscht. Aber was ist das nun eigentlich genauer, "der Osten"?
Manchmal gibt es Zufälle, die keine wirklichen Zufälle sind. Dieser Zufall war die Bestellung zweier Bücher in meiner örtlichen Buchhandlung. Beide zusammen führten am Ende zu einem anderen eigenen Bild der west-ost-deutschen Befindlichkeit. Das erste geschrieben von einem Westdeutschen 1990 bis 1991 in Dresden, das andere von einem Ostdeutschen in Ostdeutschland 2023. Ich habe als Untertitel "Eine Streitschrift" gewählt. Denn der Text ist in der Tat zornig, doch Streit sucht der Autor nicht. Dirk Oschmann hatte in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, dass der Westen sich einen Osten nach eigenem Gutdünken zusammen erfindet. Wonach der Osten immer rückständig, unflexibel, faul, demokratieunfähig und undankbar ist. Während Bayern und Rheinländer stolz auf ihren Dialekt sind, gilt Sächsisch als komisch bis nervig. Der Westen sei eben das "Normale", der Osten die Ausnahme. Weshalb der Westen sagen müsse, wo es lang geht und was das Beste für den Osten sei. Diese Sicht ist keine Ausnahme, viele Bücher und Studien, auch eben «Das letzte Jahr» von Martin Gross zeigt, wie der Westen den Osten übernahm. Als Erstes kamen der Einzelhandel und die Baumärkte, dann die westlichen Köpfe der Verwaltungen, der Politik und der Hochschulen. Wie es so schön heißt, der Westen wollte den Osten für den Umsatz und die Gewinne, als billiges Produktionsgebiet bei niedrigen Löhnen. Die Menschen waren nicht erwünscht. Aber was ist das nun eigentlich genauer, "der Osten"?
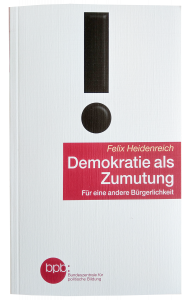 Gehe ich in meinen Erinnerungen 50 oder mehr Jahre zurück, in die Zeit des Wirtschaftswunders und in den Siebzigern in die Modernisierung der Bundesrepublik, tauchen viele Fragen auf. Selbst in der späteren Phase war die Welt um mich herum, im Vergleich zu heute, eher homogen. Zwar wählte mein Vater SPD und ein Onkel CDU, aber vor dem Haus standen ein Kommunist und ein Erzkonservativer noch beieinander und diskutierten. Inzwischen ist die Atmosphäre frostiger geworden, oder, wie man so sagt, die Gesellschaft ist stark ausdifferenziert. Doch auch das Verhältnis der Menschen zum Staat hat sich stark verändert. Behörden, Regierung und Kommunen, leider auch zivile Dienste wie Polizei, Feuerwehr oder sogar Sanitäter, werden nicht selten mit Argwohn betrachtet. Wenn nicht sogar, wie Anfang Januar 2023 in Berlin, angegriffen, beschimpft, verspottet. Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger sehen "den Staat" als einen Lieferanten, der ihnen das Gewünschte und Bestellte zügig liefert, aber ansonsten möglichst keine Ansprüche an sie stellt. Freiheit wird überwiegend als negative Freiheit gesehen, als "Freiheit von". Bloß keine Verbote und Einschränkungen, bloß kein Tempolimit. Heidenreich nennt es die Ökonomisierung des Staates, gepaart mit einer Infantilisierung. Ein wirklich demokratischer Staat muss an seine Mitglieder, auf allen Ebenen, Ansprüche stellen. Dass diese Zumutungen wie Wahlen, Bürgerbeteiligungen bis hin zu Wehrpflicht und Freiwilligem Sozialen Jahr mehr sind als hinderliche Pflichtübungen, gleichzeitig Privilegien sind, ist vergessen. Dabei geht es anders, wie Heidenreich mit Beispielen aus der Schweiz, aus Irland und Kanada zeigt. Wenn wir die Demokratie in Deutschland erhalten wollen, brauchen wir ein anderes Verständnis von Bürgertum. Und müssen wieder mehr Zumutungen wagen.
Gehe ich in meinen Erinnerungen 50 oder mehr Jahre zurück, in die Zeit des Wirtschaftswunders und in den Siebzigern in die Modernisierung der Bundesrepublik, tauchen viele Fragen auf. Selbst in der späteren Phase war die Welt um mich herum, im Vergleich zu heute, eher homogen. Zwar wählte mein Vater SPD und ein Onkel CDU, aber vor dem Haus standen ein Kommunist und ein Erzkonservativer noch beieinander und diskutierten. Inzwischen ist die Atmosphäre frostiger geworden, oder, wie man so sagt, die Gesellschaft ist stark ausdifferenziert. Doch auch das Verhältnis der Menschen zum Staat hat sich stark verändert. Behörden, Regierung und Kommunen, leider auch zivile Dienste wie Polizei, Feuerwehr oder sogar Sanitäter, werden nicht selten mit Argwohn betrachtet. Wenn nicht sogar, wie Anfang Januar 2023 in Berlin, angegriffen, beschimpft, verspottet. Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger sehen "den Staat" als einen Lieferanten, der ihnen das Gewünschte und Bestellte zügig liefert, aber ansonsten möglichst keine Ansprüche an sie stellt. Freiheit wird überwiegend als negative Freiheit gesehen, als "Freiheit von". Bloß keine Verbote und Einschränkungen, bloß kein Tempolimit. Heidenreich nennt es die Ökonomisierung des Staates, gepaart mit einer Infantilisierung. Ein wirklich demokratischer Staat muss an seine Mitglieder, auf allen Ebenen, Ansprüche stellen. Dass diese Zumutungen wie Wahlen, Bürgerbeteiligungen bis hin zu Wehrpflicht und Freiwilligem Sozialen Jahr mehr sind als hinderliche Pflichtübungen, gleichzeitig Privilegien sind, ist vergessen. Dabei geht es anders, wie Heidenreich mit Beispielen aus der Schweiz, aus Irland und Kanada zeigt. Wenn wir die Demokratie in Deutschland erhalten wollen, brauchen wir ein anderes Verständnis von Bürgertum. Und müssen wieder mehr Zumutungen wagen.
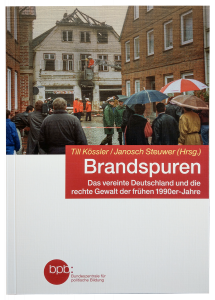 Die Brandanschläge auf Häuser türkischstämmiger Bewohner in Mölln und Solingen, dazu die pogromartigen Überfälle auf ausländische Arbeitskräfte und Flüchtlinge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, sind Teil bundesdeutscher Geschichte. Doch waren diese Geschehnisse nur Highlights rechtsextremen und fremdenfeindlichen Terrors. Die wahren Verhältnisse sind weitgehend vergessen. Zwischen September 1991 und Juli 1993 registrierten die Behörden mehr als 1.200 Brandanschläge auf von Ausländern und Flüchtlingen bewohnte Häuser. Hinzu kamen rund 2.700 schwere Körperverletzungen aus fremdenfeindlichen Motiven. Kaum erfasst wurden die kleinen Tätlichkeiten und Beleidigungen, die für viele Menschen Alltag waren, die nicht "deutsch" aussahen. Seit 1993 ist die Zahl der Brandanschläge und schweren Ausschreitungen deutlich zurück gegangen. Die Zahl der Angriffe auf subjektiv nichtdeutsche Personen stabilisierte sich dagegen auf hohem Niveau. Till Kössler und Janosch Steuwer haben einen Band heraus gegeben, der 22 Beiträge zur rechtextremen bis nationalsozialistischen Geschichte in Deutschland seit Ende des zweiten Weltkrieges bis in die späten Neunziger zusammenfasst. Wie üblich, wenn man hinter die Oberflächlichkeiten alltäglicher Nachrichten schaut, zerlegen die Zahlen und Fakten viele gewohnte Stereotype. Weder ist die rechte Gewalt ein ostdeutsches Phänomen, noch war der Westen in der Zeit nach der Wiedervereinigung und davor ein demokratisches Musterland. Man sollte zum Beispiel nicht vergessen, dass die größten rechten Hetzer der AfD wie Björn Höcke aus Hessen und Andreas Kalbitz aus München stammen. Hat der Westen also den Rechtsextremismus erst in den Osten exportiert?
Die Brandanschläge auf Häuser türkischstämmiger Bewohner in Mölln und Solingen, dazu die pogromartigen Überfälle auf ausländische Arbeitskräfte und Flüchtlinge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, sind Teil bundesdeutscher Geschichte. Doch waren diese Geschehnisse nur Highlights rechtsextremen und fremdenfeindlichen Terrors. Die wahren Verhältnisse sind weitgehend vergessen. Zwischen September 1991 und Juli 1993 registrierten die Behörden mehr als 1.200 Brandanschläge auf von Ausländern und Flüchtlingen bewohnte Häuser. Hinzu kamen rund 2.700 schwere Körperverletzungen aus fremdenfeindlichen Motiven. Kaum erfasst wurden die kleinen Tätlichkeiten und Beleidigungen, die für viele Menschen Alltag waren, die nicht "deutsch" aussahen. Seit 1993 ist die Zahl der Brandanschläge und schweren Ausschreitungen deutlich zurück gegangen. Die Zahl der Angriffe auf subjektiv nichtdeutsche Personen stabilisierte sich dagegen auf hohem Niveau. Till Kössler und Janosch Steuwer haben einen Band heraus gegeben, der 22 Beiträge zur rechtextremen bis nationalsozialistischen Geschichte in Deutschland seit Ende des zweiten Weltkrieges bis in die späten Neunziger zusammenfasst. Wie üblich, wenn man hinter die Oberflächlichkeiten alltäglicher Nachrichten schaut, zerlegen die Zahlen und Fakten viele gewohnte Stereotype. Weder ist die rechte Gewalt ein ostdeutsches Phänomen, noch war der Westen in der Zeit nach der Wiedervereinigung und davor ein demokratisches Musterland. Man sollte zum Beispiel nicht vergessen, dass die größten rechten Hetzer der AfD wie Björn Höcke aus Hessen und Andreas Kalbitz aus München stammen. Hat der Westen also den Rechtsextremismus erst in den Osten exportiert?