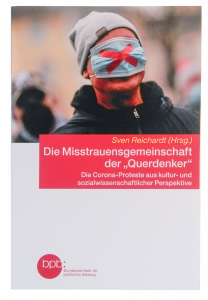 Ich habe eine Zeit lang darüber nachdenken müssen, ob ich zu diesem Buch etwas schreibe. Nicht weil es kein gutes Buch wäre, sondern weil ein Buch mit der Erwartungshaltung übereinstimmen sollte. Schon die Angabe, dass Sven Reichard Herausgeber, nicht Autor des Buches ist, weist darauf hin, dass es eine Sammlung von Artikeln ist. Genauer ist das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen, die sich auf die Querdenker-Demos am 3. und 4. Oktober 2020 am Bodensee und eben in Konstanz beziehen. Beobachtet, anhand von standardisierten Umfragen analysiert und in tiefen Details interpretiert von der Universität Konstanz. So ist das Buch ein Resultat der Zusammenarbeit von Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen der Hochschule. Wenn aber unter solchen Vorbedingungen eine Schrift entsteht, muss man sich darüber klar sein, dass es sehr tief hinein geht, je weiter man im Buch vorstößt. Und so ist es auch, je später die Beiträge, desto feingliedriger werden die Themen. Es beginnt mit den offensichtlichen Wissensparallelwelten der Querdenker, geht weiter über die Konturen einer heterogenen Misstrauensgesellschaft, leistet einen Vergleich der Spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts und der Covid 19-Pandemie in Sachsen bis hin zum Umgang der Protestieren in Habitus und Kommunikation. Wie und mit welchen Methoden digitale Fähigkeiten genutzt werden. Dass die Parolen und Protestformen der Querdenker überwiegend eher Parodien der Realität sind, wird ebenso ausgiebig behandelt. Bliebe am Ende die Frage, ob das Buch überhaupt für Durchschnittsleser interessant ist. Wenn auch mit gewissen Einschränkungen: eindeutig ja.
Ich habe eine Zeit lang darüber nachdenken müssen, ob ich zu diesem Buch etwas schreibe. Nicht weil es kein gutes Buch wäre, sondern weil ein Buch mit der Erwartungshaltung übereinstimmen sollte. Schon die Angabe, dass Sven Reichard Herausgeber, nicht Autor des Buches ist, weist darauf hin, dass es eine Sammlung von Artikeln ist. Genauer ist das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen, die sich auf die Querdenker-Demos am 3. und 4. Oktober 2020 am Bodensee und eben in Konstanz beziehen. Beobachtet, anhand von standardisierten Umfragen analysiert und in tiefen Details interpretiert von der Universität Konstanz. So ist das Buch ein Resultat der Zusammenarbeit von Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen der Hochschule. Wenn aber unter solchen Vorbedingungen eine Schrift entsteht, muss man sich darüber klar sein, dass es sehr tief hinein geht, je weiter man im Buch vorstößt. Und so ist es auch, je später die Beiträge, desto feingliedriger werden die Themen. Es beginnt mit den offensichtlichen Wissensparallelwelten der Querdenker, geht weiter über die Konturen einer heterogenen Misstrauensgesellschaft, leistet einen Vergleich der Spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts und der Covid 19-Pandemie in Sachsen bis hin zum Umgang der Protestieren in Habitus und Kommunikation. Wie und mit welchen Methoden digitale Fähigkeiten genutzt werden. Dass die Parolen und Protestformen der Querdenker überwiegend eher Parodien der Realität sind, wird ebenso ausgiebig behandelt. Bliebe am Ende die Frage, ob das Buch überhaupt für Durchschnittsleser interessant ist. Wenn auch mit gewissen Einschränkungen: eindeutig ja.

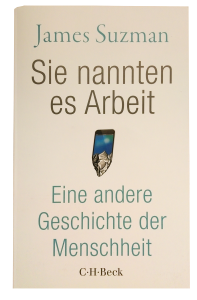
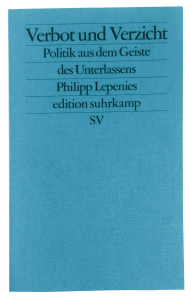
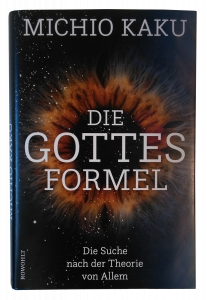
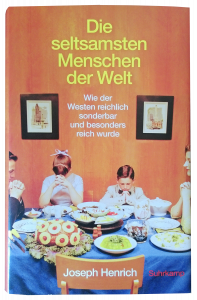
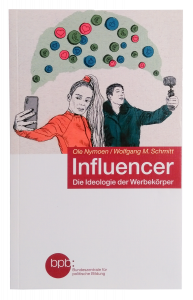

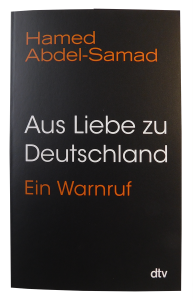
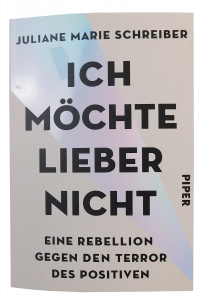
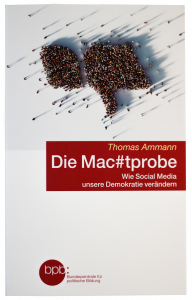
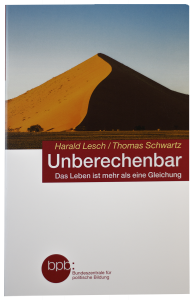
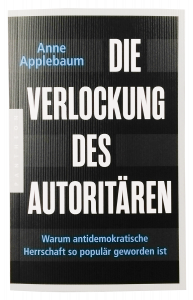
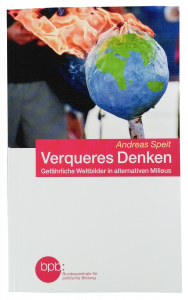
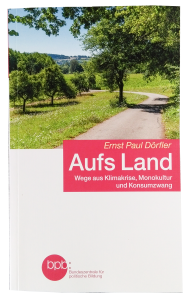
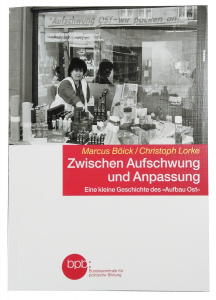
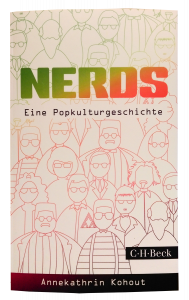
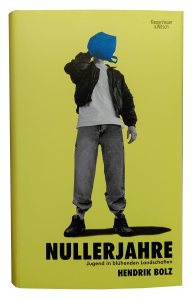

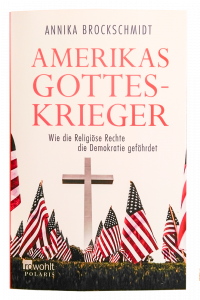
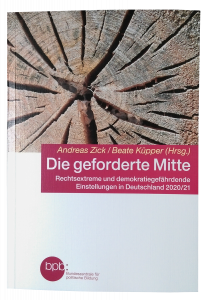 Als im Frühsommer 2021 die
Als im Frühsommer 2021 die