Show, don’t tell
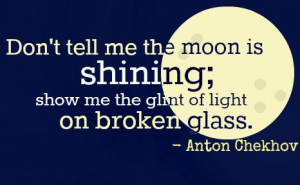 Seit bald sechs Monaten bin ich jetzt in meinem neuen Job, als Redakteur. Nicht wie früher als technischer Redakteur, mit Bedienungsanleitungen und Datenblättern habe ich nichts am Hut. Stattdessen beschäftigen mich Artikel für Fachzeitschriften, Pressemeldungen und Kunden-Newsletter, und nun seit einigen Wochen Online-Texte. In Vollzeit. So zu sagen. Eine komplett neue Website wird für das Unternehmen gebaut, wodurch ich WordPress und das Enfold Theme in aller Härte und im Detail kennen und schätzen lernte. Innerlich hat mich oft etwas Anderes beschäftigt. Ich dachte, dass ich seit dem Studium an der FJS und dem Lesen vieler schlauer Bücher so manche Frage hinter mir gelassen hätte. So kommt man zu neuen Erkenntnissen. Gerade mit diesem nicht gerade kleinen Online-Projekt habe ich einige Dinge besser verstanden, an einigen Stellen neu durchdenken müssen. Die Grundfrage bleibt: wie schreibt man gut lesbare, interessante und ansprechende Texte? Ich könnte nun auf so einige Bücher verweisen, dort würde es drin stehen. Doch ich folge Sol Stein und einem seiner entscheidenden Themen, manifestiert in einer alten Schreiber-Regel, oft zitiert, selten umgesetzt.
Seit bald sechs Monaten bin ich jetzt in meinem neuen Job, als Redakteur. Nicht wie früher als technischer Redakteur, mit Bedienungsanleitungen und Datenblättern habe ich nichts am Hut. Stattdessen beschäftigen mich Artikel für Fachzeitschriften, Pressemeldungen und Kunden-Newsletter, und nun seit einigen Wochen Online-Texte. In Vollzeit. So zu sagen. Eine komplett neue Website wird für das Unternehmen gebaut, wodurch ich WordPress und das Enfold Theme in aller Härte und im Detail kennen und schätzen lernte. Innerlich hat mich oft etwas Anderes beschäftigt. Ich dachte, dass ich seit dem Studium an der FJS und dem Lesen vieler schlauer Bücher so manche Frage hinter mir gelassen hätte. So kommt man zu neuen Erkenntnissen. Gerade mit diesem nicht gerade kleinen Online-Projekt habe ich einige Dinge besser verstanden, an einigen Stellen neu durchdenken müssen. Die Grundfrage bleibt: wie schreibt man gut lesbare, interessante und ansprechende Texte? Ich könnte nun auf so einige Bücher verweisen, dort würde es drin stehen. Doch ich folge Sol Stein und einem seiner entscheidenden Themen, manifestiert in einer alten Schreiber-Regel, oft zitiert, selten umgesetzt.
Show, don’t tell – Zeige es, sage es nicht nur
Mit dieser Regel habe ich mich lange schwer getan, weil ich sie nicht verstand. Erst Sol Stein hat es mir zum ersten Mal verständlich vermittelt. Es geht in dieser Regel darum, nicht Aussagen zu treffen oder Begriffe in den Raum zu werfen, sondern die Natur des Menschen zu berücksichtigen. Der Mensch ist ein emotionales Wesen und zum großen Teil durch Emotionen gesteuert, nicht durch Vernunft. So oft wir auch beteuern, wir wären doch so von der Vernunft gesteuert, so sachlich und konkret. Doch wenn ich etwas darstellen will, muss ich es dem Leser spürbar übermitteln, er muss es nachfühlen können. Nur wenn ein Text, auch ein sachlich technischer, einen emotionalen Inhalt hat, bekommt er Bedeutung und Aufmerksamkeit. Das ist das, was Schulz von Thun im Hamburger Verständlichkeitskonzept mit den anregenden Zusätzen meinte. Oder ein Teil davon. Gemeint ist diese Emotionalität nicht in der Form, den Leser emotional zu berühren, das ist Schnulzenmusik und Schundromanen vorbehalten. Mehr ist das Ziel, dem Leser Situationen zu geben, in denen er sich wiedererkennt.
Ein praktisches Beispiel, zuerst in der nüchternen technischen Form.
Im Tagesverlauf wird an den gleichen Stellen unterschiedliches Licht benötigt oder gewünscht. Dabei sind unterschiedlichste Ausleuchtungsvarianten zu berücksichtigen, zum Beispiel für handwerkliche Arbeiten oder in reinen Wohnszenarien. So können für nur einen Raum ein Dutzend verschiedene Ausleuchtungen sinnvoll sein.
Verständlich, was gemeint ist, aber es ist trocken und langweilig. Anderer Vorschlag:
Im Tagesverlauf wird oft an den gleichen Stellen ganz unterschiedliches Licht benötigt oder gewünscht. Beim Kochen und bei der Hausarbeit soll die Küche hell sein, mit eher kühlem, bläulichem Licht. Beim Abendessen darf es weniger Licht sein, wärmer mit etwas mehr Rotanteilen. Im Wohnzimmer, bei der Arbeit an der Steuererklärung am Schreibtisch, wird genau dort viel Licht gebraucht. Eine Stunde später, beim Fernsehen oder beim Plausch mit Gästen, wird eine ganz andere Beleuchtung gewünscht. Beim Fernsehen oder beim Entspannen mit Bach oder Beatles ähnlich, aber dann doch wieder anders. So können für nur einen Raum ein Dutzend verschiedene Ausleuchtungen sinnvoll sein.
Indem ich die Situationen direkt benenne, rufe ich beim Leser eigene Erinnerungen ab, so lange ich davon ausgehe, dass mindestens 90% der Leser sie kennen. Die Wohnbeispiele haben einen gefühlsmäßigen Anteil und gehen über eine reine Sachinformation hinaus. Noch ein technisches Beispiel:
Sicherheitsprobleme entstehen vielfach durch Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit. Eine Außer-Haus-Taste an der Haustür schließt alle Fenster, schaltet alle Lichter aus, ebenso die Steckdosen in der Küche. Der Alarm-Modus im Haus wird aktiviert. Die Räume werden mit Bewegungs- und Wärme-Sensoren überwacht, ebenso Fenster und Türen mit Schließkontakten und Glasbruchmeldern.
Verstanden. Mit nur zwei zusätzlichen Sätzen rufe ich eigene Erfahrungen des Lesers ab und mache den Text persönlicher:
Viele Sicherheitslücken entstehen durch Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit. Indem Sicherheit automatisiert wird, spielen momentane Einflüsse wie das wartende Taxi oder der verschlafene Kundentermin keine Rolle mehr. Eine Außer-Haus-Taste an der Haustür schließt alle Fenster, schaltet alle Lichter aus, ebenso die Steckdosen für Kaffeemaschine und Wasserboiler in der Küche. Der Alarm-Modus wird aktiviert. Die Räume werden mit Bewegungs- und Wärme-Sensoren überwacht, ebenso Fenster und Türen mit Schließkontakten und Glasbruchmeldern. Die spätere bange Frage, ob der Herd denn wirklich ausgeschaltet ist, kann man sich nun sparen.
Natürlich wird der Text deutlich länger, er gewinnt aber diesen minimal emotionalen Inhalt, der ihn für den Leser nachvollziehbarer macht, er fühlt sich in seinen eigenen Erfahrungen angesprochen. Es geht nicht nur um sachliche Argumente und Fakten, sondern den Leser in seinem eigenen Leben zu spiegeln.
Verallgemeinert hieße das
Ein Text gewinnt Farbe durch Details. So kann ich in einer Reportage oder in einem Interview nur schildern, dass eine Person einen bestimmten Gesichtsausdruck aufsetzt, nehmen wir Erstaunen. Ich kann aber auch stattdessen seine Körperhaltung wiedergeben, was er mit seinen Händen macht, wie seine Augen aussehen. Je mehr Details ich einfüge, desto greifbarer wird das Geschilderte.
Unser Alltag ist stark visuell bestimmt, tatsächlich verfügen wir über weit aus mehr Sinne wie Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören. Ich kann sagen, dass ein Glas Bier auf dem Tisch steht. Ich kann aber auch beschreiben, wie sich Kondenswasser wie kleine Regentropfen am Glas abschlägt, wie die winzigen Kohlenstoffbläschen aufsteigen, wie der Schaum aussieht, den hopfigen, leicht muffigen Geruch des Bieres beschreiben oder wie es sich anhört, wenn der Schaum prickelnd in sich zusammenfällt.
Ein weiterer Punkt ist das Spezifische. Ich kann sagen, das da drüben sei ein Auto. Ich kann aber auch sagen, das es ein Volvo sei, der schon lange die besten Jahre hinter sich hat, mit den trüben Fenstern vom Zigarettenrauch und dem zersplitterten Scheinwerferglas, mit der ausgeblichenen Motorhaube und den Spuren von Einkaufswagen an den Türen. Je genauer und spezifischer ich das Bild in den Kopf des Lesers male, desto mehr ziehe ich ihn in den Text hinein.
Zahlen sind abstrakt, mache sie greifbar
Das schönste Beispiel, das mir in der letzten Zeit dazu untergekommen ist, stammt von Bill Bryson. Es ging um das Kambrium, ein Erdzeitalter, in dem urplötzlich sehr viele neue Tierarten entstanden. Um klar zu machen, wie lange dieses Erdzeitalter her ist, wählt Bryson diese Darstellung:
Wenn wir in jeder vergehenden Sekunde ein Jahr weiter in die Vergangenheit zurück gehen könnten, wäre wir nach einer guten halben Stunde bei Jesu Geburt. Bis wir im Kambrium ankämen, würde es noch mehr als zwanzig Jahre dauern.
Wenn Zahlen und Daten sich der normalen Alltagserfahrung entziehen, muss ich sie auf eine vorstellbare Weise darstellen. Das gleiche Prinzip gilt im Prinzip für viele Fälle, in denen reine Zahlen in einen Erfahrungswert umgesetzt werden. Das beginnt schon in der Schreibweise: ein Drittel statt 33%, die Hälfte statt 50%, eine knappe halbe Stunde statt 25 Minuten. Dazu sollte man wissen, dass wir beim Lesen einmal in einem assoziativen Modus sind, wo wir nicht jeden Buchstaben lesen, sondern das Wort als ganzes erkennen. Stoßen wir auf Ziffern, müssen wir umschalten und die Zahl tatsächlich rational „entziffern“. Das bricht den Lesefluss.

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!