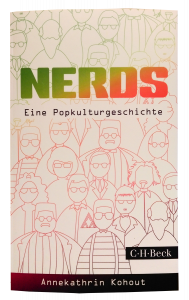 Wenn man von einem Nerd spricht, ist damit meistens der Computer-Nerd gemeint. Man stellt sich einen jungen Mann mit dicken Brillengläsern vor, unattraktiv, sozial unverträglich, etwas seltsam gekleidet, der sich überwiegend von Tiefkühlpizza und Coca Cola ernährt. Am Arbeitstisch, weil er den geliebten Mittelpunkt seines Lebens, seinen Computer, nicht einmal zur Nahrungsaufnahme verlassen will. Gleichzeitig ist er ein Wissender, ein Spezialist, der so viel weiß über Computer wie nur wenige. Sei es als „Coder“ oder als „Gamer“. Diese Sozialfigur, die bei uns in den Achtzigern und Neunzigern bekannt wurde, existiert tatsächlich nicht mehr. Computer sind keine Angelegenheit für wenige Experten mehr, die Beschäftigung mit ihnen findet nicht mehr in muffigen Kellern oder ausgedienten Dachzimmern statt. Trotzdem hält sich dieses Bild. Was aber dieses Bild repräsentiert, wie es entstanden ist und wie es sich verändert hat, untersucht Annekathrin Kohout in diesem Buch sehr eingehend. Wie so viele Sozialfiguren entstand der Nerd, lange bevor der Begriff in Europa gängig wurde, in den USA. Doch die Vorläufer des Nerds waren Stereotypen, die sich weit vor dem Auftauchen des Personal Computers ausbildeten. Was später der Nerd wurde, war zuvor in den USA der Square, ein Spießer, Unflexibler, Vorgestriger. So wäre das Buch ziemlich uninteressant, wenn es nur um diesen Computer-Freak ginge. Stattdessen untersucht Kohout weitere Aspekte soziokultureller Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Wie sich Rollenbilder überhaupt entwickelten, wie sich Zuschreibungen veränderten, wie sich Technologie vom Expertenwissen zum Alltagswissen veränderte. Erst mit dieser erweiterten Interpretation bekommt das Buch einen Reiz. Wenn man sich für Kulturwissenschaften interessiert.
Wenn man von einem Nerd spricht, ist damit meistens der Computer-Nerd gemeint. Man stellt sich einen jungen Mann mit dicken Brillengläsern vor, unattraktiv, sozial unverträglich, etwas seltsam gekleidet, der sich überwiegend von Tiefkühlpizza und Coca Cola ernährt. Am Arbeitstisch, weil er den geliebten Mittelpunkt seines Lebens, seinen Computer, nicht einmal zur Nahrungsaufnahme verlassen will. Gleichzeitig ist er ein Wissender, ein Spezialist, der so viel weiß über Computer wie nur wenige. Sei es als „Coder“ oder als „Gamer“. Diese Sozialfigur, die bei uns in den Achtzigern und Neunzigern bekannt wurde, existiert tatsächlich nicht mehr. Computer sind keine Angelegenheit für wenige Experten mehr, die Beschäftigung mit ihnen findet nicht mehr in muffigen Kellern oder ausgedienten Dachzimmern statt. Trotzdem hält sich dieses Bild. Was aber dieses Bild repräsentiert, wie es entstanden ist und wie es sich verändert hat, untersucht Annekathrin Kohout in diesem Buch sehr eingehend. Wie so viele Sozialfiguren entstand der Nerd, lange bevor der Begriff in Europa gängig wurde, in den USA. Doch die Vorläufer des Nerds waren Stereotypen, die sich weit vor dem Auftauchen des Personal Computers ausbildeten. Was später der Nerd wurde, war zuvor in den USA der Square, ein Spießer, Unflexibler, Vorgestriger. So wäre das Buch ziemlich uninteressant, wenn es nur um diesen Computer-Freak ginge. Stattdessen untersucht Kohout weitere Aspekte soziokultureller Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Wie sich Rollenbilder überhaupt entwickelten, wie sich Zuschreibungen veränderten, wie sich Technologie vom Expertenwissen zum Alltagswissen veränderte. Erst mit dieser erweiterten Interpretation bekommt das Buch einen Reiz. Wenn man sich für Kulturwissenschaften interessiert.
Archiv für das Monat: März, 2022
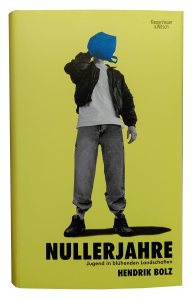 Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch: „Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht bewusst dafür entschieden hat.“ Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen, waren Bolz‘ Welt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben, kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rowdytum faselte als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt. Wenn man eben nicht gewaltaffin ist.
Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch: „Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht bewusst dafür entschieden hat.“ Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen, waren Bolz‘ Welt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben, kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rowdytum faselte als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt. Wenn man eben nicht gewaltaffin ist.
 Den britischen Autor George Orwell kennen die meisten Leute wohl von seinen beiden dystopischen Romanen Animal Farm und 1984. Zwischen März und November 1945 jedoch folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Von dort schrieb er Berichte für Zeitungen wie The Observer, Manchester Evening News oder Tribune. Diese Artikel sind nun erstmals vollständig übersetzt in Deutsch erschienen, mit einem Nachwort des Historikers Volker Ullrich. Nun könnte man meinen, dass diese Zeit doch schon genug dokumentiert, betrachtet und analysiert sei. Orwell fügt jedoch noch einmal eine neue Perspektive hinzu, seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, eher mit einer erstaunlichen Nüchternheit, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat.
Den britischen Autor George Orwell kennen die meisten Leute wohl von seinen beiden dystopischen Romanen Animal Farm und 1984. Zwischen März und November 1945 jedoch folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Von dort schrieb er Berichte für Zeitungen wie The Observer, Manchester Evening News oder Tribune. Diese Artikel sind nun erstmals vollständig übersetzt in Deutsch erschienen, mit einem Nachwort des Historikers Volker Ullrich. Nun könnte man meinen, dass diese Zeit doch schon genug dokumentiert, betrachtet und analysiert sei. Orwell fügt jedoch noch einmal eine neue Perspektive hinzu, seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, eher mit einer erstaunlichen Nüchternheit, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat.
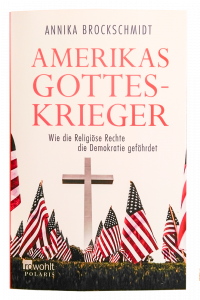 Waren die US-Amerikaner lange ein Vorbild gerade für Deutschland, sind sie uns seit 2016 zu einem Rätsel geworden. Wie konnte eine Nation, die sich als demokratisches und liberales Vorbild in der Welt versteht, einen Menschen wie Donald Trump zum Präsidenten wählen? Was sind das für Leute, die man Evangelikale nennt, die die Bibel wörtlich interpretieren und für die Darwins Erkenntnisse barer Unsinn sind? Für die der Staat ein Feind ist, der "Deep State", der zu entmachten ist und dem jede Kompetenz zur Führung abgesprochen wird. Annika Brockschmidt schildert in ihrem Buch eine ganze Reihe von religiösen Gruppen in den USA, angefangen von den christlichen Nationalisten, über evangelikale Fundamentalisten, religiöse Rechte bis hin zu den zahllosen Splittergruppen. Scheinbar gründet in USA ständig irgendjemand ein Komitee, eine Vereinigung oder eine sonstige Gruppe, die jedoch Wesentliches gemeinsam haben: Die Überzeugung, die USA sei das von Gott erwählte Land, dass Religion und Politik nicht zu trennen sind und dass die USA eine christliche Führung haben sollen, keine weltliche. Alle säkularen, liberalen oder eben nicht gläubigen Menschen sind Feinde, von schwarzen Menschen, Einwanderern und Muslimen ganz zu schweigen. Diese Überzeugungen, auf die Brockschmidt im Detail eingeht und was ihre Ziele sind, lassen einen Europäer manchmal sprach- und verständnislos zurück. Nun könnte man diese Leute als Spinner und Verwirrte abtun und ignorieren. Jedoch haben sie inzwischen die amerikanische Gesellschaft, speziell die Politik, erschreckend durchdrungen, was von dieser Seite des Atlantiks nicht wirklich sichtbar ist. Und werden, nach Jahrzehnte langer Vorarbeit, zu einer Gefahr für die Demokratie in den USA.
Waren die US-Amerikaner lange ein Vorbild gerade für Deutschland, sind sie uns seit 2016 zu einem Rätsel geworden. Wie konnte eine Nation, die sich als demokratisches und liberales Vorbild in der Welt versteht, einen Menschen wie Donald Trump zum Präsidenten wählen? Was sind das für Leute, die man Evangelikale nennt, die die Bibel wörtlich interpretieren und für die Darwins Erkenntnisse barer Unsinn sind? Für die der Staat ein Feind ist, der "Deep State", der zu entmachten ist und dem jede Kompetenz zur Führung abgesprochen wird. Annika Brockschmidt schildert in ihrem Buch eine ganze Reihe von religiösen Gruppen in den USA, angefangen von den christlichen Nationalisten, über evangelikale Fundamentalisten, religiöse Rechte bis hin zu den zahllosen Splittergruppen. Scheinbar gründet in USA ständig irgendjemand ein Komitee, eine Vereinigung oder eine sonstige Gruppe, die jedoch Wesentliches gemeinsam haben: Die Überzeugung, die USA sei das von Gott erwählte Land, dass Religion und Politik nicht zu trennen sind und dass die USA eine christliche Führung haben sollen, keine weltliche. Alle säkularen, liberalen oder eben nicht gläubigen Menschen sind Feinde, von schwarzen Menschen, Einwanderern und Muslimen ganz zu schweigen. Diese Überzeugungen, auf die Brockschmidt im Detail eingeht und was ihre Ziele sind, lassen einen Europäer manchmal sprach- und verständnislos zurück. Nun könnte man diese Leute als Spinner und Verwirrte abtun und ignorieren. Jedoch haben sie inzwischen die amerikanische Gesellschaft, speziell die Politik, erschreckend durchdrungen, was von dieser Seite des Atlantiks nicht wirklich sichtbar ist. Und werden, nach Jahrzehnte langer Vorarbeit, zu einer Gefahr für die Demokratie in den USA.
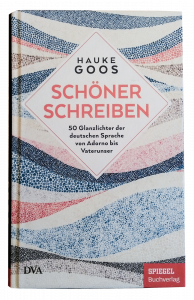 Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres. Aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim SPIEGEL eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze. In denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er. Die Hintergründe, die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist als Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte, von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern und sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Goos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung eine langsam aussterbende Gattung. Leider.
Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres. Aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim SPIEGEL eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze. In denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er. Die Hintergründe, die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist als Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte, von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern und sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Goos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung eine langsam aussterbende Gattung. Leider.
Nach einem Geschichtsstudium besuchte Hauke Goos die Henri-Nannen-Schule. Anschließend war er Reporter für das Magazin Akte bei Sat.1. Ab 1999 war er beim Monatsmagazin SPIEGELreporter, das nach der Einstellung 2001 als Gesellschaftsressort in das Magazin DER SPIEGEL integriert wurde. Seitdem schreibt er für den SPIEGEL und veröffentlicht eigene Bücher. Nach langer Tätigkeit im Gesellschaftsressort wechselte Hauke Goos 2017 für kurze Zeit ins Wirtschaftsressort, bevor er 2018 zum Gesellschaftsressort zurückkehrte. Im Zusammenhang mit der Relotius-Affäre wurde das Gesellschaftsressort umstrukturiert und Goos stellvertretender Leiter des in „Reporter“ umbenannten Ressorts. Hauke Goos erhielt den Henri Nannen Preis in den Jahren 2009, 2011 und 2012 sowie den Deutschen Reporterpreis 2009.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Hauke Goos aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Hauke Goos aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
