Peter Longerich: Antisemitismus
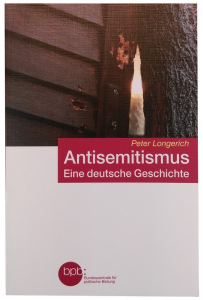 Nachdem ich die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/shop/) als neue Quelle für politische Bücher zu Kampfpreisen entdeckt hatte, orderte ich testweise zwei Ausgaben. Die erste, über den Populismus, gab ich nach einem Drittel wieder auf. Weil sehr schwer verständlich. So wertvoll vielleicht wissenschaftlich, so unleserlich für den Alltagsleser. Das zweite Buch motivierte mich mit einer Dicke von 4,5 Zentimetern nicht so direkt zum Aufschlagen, aber ich fing aus Interesse trotzdem an zu lesen. Dieses Buch habe ich ordentlich zu Ende gelesen. Hat halt etwas Zeit gekostet. Erleichternd sollte ich erwähnen, dass 1,5 Zentimeter Papier allein Anmerkungen und Bibliografie geschuldet sind. Auch wenn ich dem Thema des Buches, der Geschichte des Antisemitismus, nicht direkt nahe stand, ist es eine selten so gesehene detaillierte und zugleich lesenswerte Darstellung. Nicht nur historisch genau in Einzelheiten und Zusammenhängen, sondern sogar aktuell bis in die Neuzeit. Wer sich für die neuere deutsche Geschichte in diesem Bereich interessiert, sollte die 4,50 Euro plus Versandkosten ab einem Kilogramm Buch springen lassen. Für das Wissen um die deutsche Geschichte eine lohnenswerte Investition. Denn es geht um mehr als nur um das Thema auf dem Buchdeckel. Es geht um die deutsche Geschichte.
Nachdem ich die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/shop/) als neue Quelle für politische Bücher zu Kampfpreisen entdeckt hatte, orderte ich testweise zwei Ausgaben. Die erste, über den Populismus, gab ich nach einem Drittel wieder auf. Weil sehr schwer verständlich. So wertvoll vielleicht wissenschaftlich, so unleserlich für den Alltagsleser. Das zweite Buch motivierte mich mit einer Dicke von 4,5 Zentimetern nicht so direkt zum Aufschlagen, aber ich fing aus Interesse trotzdem an zu lesen. Dieses Buch habe ich ordentlich zu Ende gelesen. Hat halt etwas Zeit gekostet. Erleichternd sollte ich erwähnen, dass 1,5 Zentimeter Papier allein Anmerkungen und Bibliografie geschuldet sind. Auch wenn ich dem Thema des Buches, der Geschichte des Antisemitismus, nicht direkt nahe stand, ist es eine selten so gesehene detaillierte und zugleich lesenswerte Darstellung. Nicht nur historisch genau in Einzelheiten und Zusammenhängen, sondern sogar aktuell bis in die Neuzeit. Wer sich für die neuere deutsche Geschichte in diesem Bereich interessiert, sollte die 4,50 Euro plus Versandkosten ab einem Kilogramm Buch springen lassen. Für das Wissen um die deutsche Geschichte eine lohnenswerte Investition. Denn es geht um mehr als nur um das Thema auf dem Buchdeckel. Es geht um die deutsche Geschichte.
Schon Martin Luther war als Judenfeind bekannt, verfasste mehrere Schriften über sie, weil sie sich nicht bekehren lassen wollten. War der Hass auf Juden lange Zeit religiös motiviert, galten sie als Gottesmörder, verschlagen und unehrlich, wandelte sich das Bild im 19. Jahrhundert. Auch bedingt durch wirtschaftliche Veränderungen überhaupt. Juden waren in der Hauptsache im Handel und im Geldwesen aktiv, seltener im Handwerk, fast nie in der Agrarwirtschaft. Sie wurden Schacherjuden oder Mauscheljuden genannt, als Hinweis auf ihre angebliche Verschlagenheit und Geldgier. Mit der aufkommenden Industrialisierung spielten die Juden auch als Unternehmer, dazu in den aufkommenden Medien und Verlagen eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig veränderte sich die Ablehnung gegen sie von einer religiös motivierten in eine rassistisch-ethnische. Juden wurden schon immer als ein Staat im Staat betrachtet, mit einer anderen Kultur, lange Zeit auch mit einer anderen Sprache. Sie galten als Fremde in der deutschen Gesellschaft. Zwar bekamen die Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts nun doch Bürgerrechte zugesprochen, doch die Mehrheit der Deutschen empfand sie als Fremdkörper. Der Zugang zu höheren Ämtern wie in der Justiz oder beim Militär blieb ihnen verwehrt. Mit der rassistischen Sichtweise nahm die Ausgrenzung noch zu, ihre Erfolge in der Wirtschaft wurden ihnen angekreidet. Mit dem beginnenden 20. Jahrhundert und dem Erstarken völkischer Gruppen und Organisationen wurde Antisemitismus als Haltung und als Begriff salonfähig. Es galt im Bürgertum fast als selbstverständlich, antisemitisch zu sein. Von einigen Ausnahmen bei Sozialdemokraten, Liberalen und Intellektuellen abgesehen. Auch der Einsatz der Juden als deutsche Soldaten an den Fronten im ersten Weltkrieg änderte nichts daran, stattdessen wurden sie als Kriegsgewinnler, Drückeberger und Parasiten disqualifiziert. Sozialdemokraten, Kommunisten und Freidenker galten als jüdisch unterwandert, von Juden gesteuert. Wie die Oktober-Revolution in Russland. Selbst die nicht selten ungeliebte Weimarer Republik galt als Werk der Juden. Die Zeit vor der Nazi-Diktatur war eine Eskalation, als immer mehr völkische und rechtextreme Parteien und Verbände auf den Plan traten. Manche offen gewaltbereit, andere eher argumentativ scheinheilig, wie die neu entstandene NSDAP.
Erstaunlich ist, dass sich der Antisemitismus gerade in der stabilen Phase der ersten deutschen Demokratie verstärkte. Ab 1933 steigerte sich die Haltung gegenüber Juden sehr rasch von Ablehnung in blanken Hass, sie wurden immer mehr ausgegrenzt und drangsaliert. Doch die realen Vernichtungspläne begannen erst mit dem zweiten Weltkrieg, fanden ab 1941/1942 nach der organisierten Tötung von Behinderten und Kranken im Holocaust ihren Höhepunkt. Der Glaube, dass sich der Antisemitismus mit dem Ende der Naziherrschaft erledigt haben sollte, war falsch. Gerade in den 1950er Jahren wurden den Juden wieder Falschheit und Berechnung zugeschrieben, dazu, sie würden aus dem Holocaust für sich Vorteile ziehen und die Deutschen unterdrücken. Erst in den 1970er und 1980er Jahren wurde es etwas ruhiger um das Thema. Doch seit der Jahrhundertwende nehmen antisemitische Propaganda und unverhohlene Feindschaft wieder zu, wie sich in Umfragen zeigt. Hinzu kommen das Verweben von Israelkritik und sekundärem Antisemitismus, die Verbreitung über soziale Medien und wieder das Codieren von Antisemitismus über bestimmte Begriffe, wie schon in der Weimarer Republik. Im Epilog geht Longerich bis zu den Entwicklungen bei Neurechten und Rechtspopulisten darauf ein, wie aktuell Antisemitismus noch heute nicht nur in Deutschland ist.
Durch die Detailtiefe und breitbandige Betrachtung ist das Buch nicht nur im schieren Umfang ein Brecher, sondern auch inhaltlich. Zugute halten muss man Longerich die neutrale und aufmerksame Analyse der historischen Vorgänge. An dieser Stelle ist das Buch wohl eine sehr gute Quelle aus historischer Sicht. Mehr Leser würde das Buch aber durch weniger Details finden. Trotzdem habe ich das Buch wegen der guten Lesbarkeit und der interessanten, oft unbekannten Einzelheiten und der historischen Entwicklungen nicht aus der Hand legen wollen. Denn im Gegensatz zum Untertitel ist es eben nicht nur die Sicht auf Deutschland, sondern eine europäische Betrachtung. Die über alles, was man im Geschichtsunterricht lernt, um Potenzen hinaus geht. Interessant für Leser, die tief in die Geschichte einsteigen wollen und die Muße für so einen Wälzer haben.
Der Klappentext:
Unverändert scheint das Amalgam der Motive für den die deutsche Geschichte durchziehenden Antisemitismus: Er speist sich aus Zuschreibungen und Neid, zudem aus der Suche nach Schuldigen, mit dem Ziel ihrer mehr oder minder manifesten Exklusion aus der Mehrheitsgesellschaft. Peter Longerich entzieht der These den Boden, eine ursprünglich religiös motivierte Judenfeindschaft habe sich erst im Zuge der Nationwerdung Deutschlands zum politisch-gesellschaftlichen Antisemitismus gewandelt. Vielmehr habe sich dieser einer Palette jahrhundertelang verfestigter Muster bedient und sich dergestalt als anschlussfähig an politisch-ökonomische Großwetterlagen aller Art erwiesen. Longerich destilliert aus der Programmatik der maßgeblichen Akteure und Strömungen seit der Aufklärung das mentale Gerüst, das in wechselnder Akzentuierung Juden ihre Integration, ihre Rechte und ihre Emanzipationsleistungen absprach, ihre Assimilation, Auswanderung oder Tötung forderte und schließlich im Holocaust mündete. Für die Gegenwart konstatiert Longerich den Fortbestand einer historisch tradierten antisemitischen Grundströmung. Sie finde in den medialen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts neue, teils schwer zu erfassende Verbreitungsformen für die zahlreichen Facetten offener und subtiler Judenfeindlichkeit.


Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!