Anja Röhl: Das Elend der Verschickungskinder
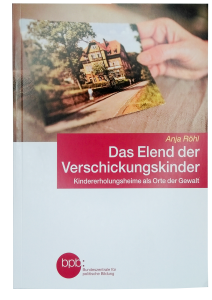 Von November bis Dezember 1972 kam ich für sechs Wochen zur Kinderkur nach Borkum. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind eher angenehm, freundliche und zugewandte Menschen, Bastelnachmittage, Ausflüge an den Strand und Aufhacken des steinhart gefrorenen Sandes in den Dünen. Nur wenig Heimweh, keine Sterneküche, aber auch kein schlechtes Essen. Nachmittags gab es Kakao und Kuchen. Ich hatte Glück gehabt. Viele andere Kinder nicht. Anja Röhl hatte selbst schlechte Erfahrungen als Verschickungskind gemacht. Sie entdeckte 2019 das Trauma der Verschickungskinder und machte es in der Öffentlichkeit sichtbar. So gründete sie als Betroffene im September 2019 einen Verein: «Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.», dazu gibt es auch eine Website zur Vernetzung. In ihrem Buch geht es um die Geschehnisse in den Heimen von der Nordsee bis Berchtesgarden. Von denen sie erfuhr, als sie eine Website öffnete, wo sich Betroffene melden und ihre Geschichten erzählen konnten, die ihnen auf diesen Verschickungen passierten. Es geht um Misshandlungen, Prügel, Demütigungen, sexuellen Missbrauch bis hin zum Tod von Kindern. Wenn man diese Geschichten liest, denkt man, dass so etwas eigentlich undenkbar ist, doch es sind persönliche und authentische Schilderungen. Doch es ist nicht nur das Ziel öffentlich zu machen, was da im Namen von Gesundheit und Erholung den Kindern zustieß. Anja Röhl zeigt auch, dass die Folgen der NS-Ideologie und -Pädagogik noch lange über das Ende des zweiten Weltkrieges hinaus wirksam waren.
Von November bis Dezember 1972 kam ich für sechs Wochen zur Kinderkur nach Borkum. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind eher angenehm, freundliche und zugewandte Menschen, Bastelnachmittage, Ausflüge an den Strand und Aufhacken des steinhart gefrorenen Sandes in den Dünen. Nur wenig Heimweh, keine Sterneküche, aber auch kein schlechtes Essen. Nachmittags gab es Kakao und Kuchen. Ich hatte Glück gehabt. Viele andere Kinder nicht. Anja Röhl hatte selbst schlechte Erfahrungen als Verschickungskind gemacht. Sie entdeckte 2019 das Trauma der Verschickungskinder und machte es in der Öffentlichkeit sichtbar. So gründete sie als Betroffene im September 2019 einen Verein: «Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.», dazu gibt es auch eine Website zur Vernetzung. In ihrem Buch geht es um die Geschehnisse in den Heimen von der Nordsee bis Berchtesgarden. Von denen sie erfuhr, als sie eine Website öffnete, wo sich Betroffene melden und ihre Geschichten erzählen konnten, die ihnen auf diesen Verschickungen passierten. Es geht um Misshandlungen, Prügel, Demütigungen, sexuellen Missbrauch bis hin zum Tod von Kindern. Wenn man diese Geschichten liest, denkt man, dass so etwas eigentlich undenkbar ist, doch es sind persönliche und authentische Schilderungen. Doch es ist nicht nur das Ziel öffentlich zu machen, was da im Namen von Gesundheit und Erholung den Kindern zustieß. Anja Röhl zeigt auch, dass die Folgen der NS-Ideologie und -Pädagogik noch lange über das Ende des zweiten Weltkrieges hinaus wirksam waren.
So bilden die Schilderungen der ehemaligen Verschickungskinder den zentralen Teil des Buches. Dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, zeigt schon die schiere Zahl an Zuschriften, die Anja Röhl in recht kurzer Zeit bekommen hatte. Es waren auch nicht einzelne Regionen, sondern die betroffenen Heime finden sich im gesamten damaligen Bundesgebiet, aus der DDR liegen noch keine Auswertungen vor. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass die „Strafen“ nicht wegen bewusster Regelverletzungen oder wegen Missverhaltens erfolgten, sondern aufgrund von nicht steuerbarem Verhalten der Kinder wie Weinen wegen starken Heimwehs, Angst, Einnässen bei Verboten, auf die Toilette zu gehen und vielen seelisch bedingten Auswirkungen. Es wurden ja schon Kinder von zwei oder drei Jahren verschickt und für sie völlig unverständlich aus ihrer vertrauten Umgebung heraus gerissen. Die betreuenden Menschen, in fast allen Fällen Frauen, hatten selten pädagogische, geschweige denn psychologische Vorbildung. Kleine Kinder nachts nackt auf dem kalten Flur stehen zu lassen, sie in Abstellkammern zu sperren, ihnen Essen und Wasser zu entziehen und was noch sonst alles geschah, geht einem schon manchmal ziemlich nahe. Erst recht, wenn man selbst Kinder hat. Am Anfang vorgeschaltet ist eine Historie der Kinderverschickung bis zurück in die Weimarer Zeit. Die Verschickungen endeten in den Achtziger Jahren, als die Kinderverschickung durch Mutter-Kind-Kuren abgelöst wurde. Diese Historie zeigt aber auch, dass das Betreiben der Heime ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor in den Kurorten war, besonders in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als kaum jemand Urlaub machte.
Im letzten Teil, aber schon angedeutet im ersten, sucht Anja Röhl nach den persönlichen und strukturellen Gründen für diese Misshandlungen von Kindern. Sie zeigt sehr plausibel, dass die Behandlung von Kindern von den Fünfzigern bis in die Achtziger eine nicht aufgearbeitete Fortsetzung genau der Methoden war, die spätestens das Dritte Reich predigte. Das Kaiserreich war da nicht besser, die Weimarer Republik bis 1928 jedoch ein Hort der Reformpädagogik. Doch mit der Nazi-Herrschaft änderte sich diese Haltung gegenüber Kindern sehr schnell. Kinder zu absolutem Gehorsam erziehen, Weiches, Zärtliches und Kreatives abtöten. Schon in frühen Büchern des 20. Jahrhunderts beschrieben Ärzte, nicht Pädagogen, wie die Erziehung von Kindern zu erfolgen habe. „Affenliebe“ der Mutter wäre schädlich für die Sozialisierung der Säuglinge und Kinder, Hochnehmen bei Weinen unangebracht. Die Grundlagen der schwarzen Pädagogik. Bis eben zu den Vorstellungen der Nazis, die Kinder seien Eigentum des Führers, sollten zu Härte, Hass und Mitleidlosigkeit erzogen werden. Wie in der Hitlerjugend und im BDM. Viele der Leitungen in den Heimen der Nachkriegszeit waren unter solchen Vorstellungen und Erfahrungen aus der Nazi-Zeit in die Nachkriegs-Zeit gegangen. Und diese Geschichte zeigt, wie punktuell und selektiv das Dritte Reich in der jungen BRD aufgearbeitet wurde. Zurück blieben Kindern, die unter diesem Mangel leiden mussten, traumatisiert, geschädigt. Die dann noch von ihren Eltern hören mussten, die Kinder hätten das Treiben in den Heimen erfunden oder zusammen phantasiert.
Anja Röhls Buch ist dennoch keine wissenschaftliche Darstellung, sondern eine mehr historische und persönliche. Sie möchte diesen misshandelten Kindern heute eine Stimme geben. Röhl bezieht sich darin schon auf wissenschaftliche Arbeiten anderer Leute, zitiert Statistiken und weitere Untersuchungen. Stellt aber immer wieder fest, dass in den Selbstdarstellungen von Kinderheimen und Kurorten bestimmte zeitliche Abschnitte ausgeblendet werden. Als wenn es diese Misshandlungen nie gegeben hätte. Das Buch ist also in Abschnitten keine objektive Betrachtung, sondern gibt den Opfern viel Raum. Und in der Tat fragt man sich nach dem Abklingen einer Betroffenheit, wie viele immer noch ungehörte Stimmen es in unserer Gesellschaft gibt.


Ich war 3 mal in den 50er und 60er Jahren in Haiger, Onstmettingen und Sylt.
Ich kann jedoch keine negativen Erlebnisse schildern.
Hallo Ludwig,
das war bei mir selbst auf Borkum ja auch so. Ich erinnere mich eher gerne daran. Aber einige Leute haben wohl andere Erfahrungen gemacht.
Grüße
Rainer