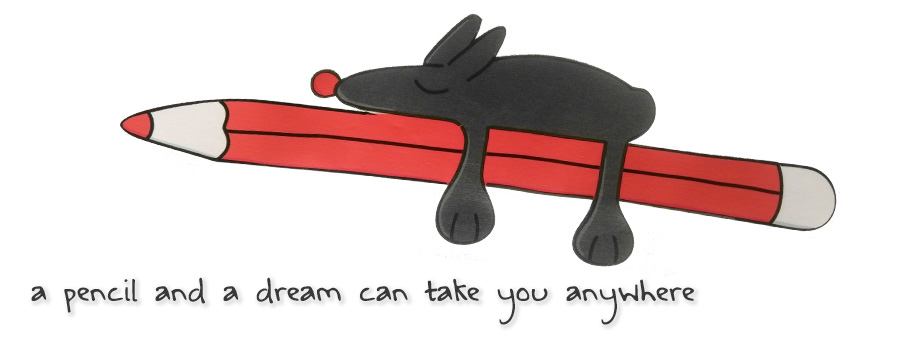
Wir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.
Google Webfont Einstellungen:
Google Maps Einstellungen:
Google reCaptcha Einstellungen:
Vimeo und YouTube Einstellungen:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.
Datenschutzerklärung
T. C. Boyle: Sind wir nicht Menschen
(Auch in dieser Rezension hat das Lektorat dramatisch versagt)
Also mal versuchen, als Abwechselung zwischen Sachbüchern über Geschichte, Politik oder Philosophie. Schon die erste Geschichte ließ mich ratlos zurück. Also versuchte ich die zweite. Nach der eher ertragenen dritten Geschichte beschloss ich, das Buch als Fall für die blaue Tonne einzuordnen. Die Geschichten in diesem Band haben weder eine Botschaft, noch eine Essenz, noch bieten sie irgendeine Form von Erkenntnis oder Verstehen. Das einzig Auffällige an den Geschichten war das aneinander Reihen von mehrwürdigen Sprachbildern („Die Rücklichter der Autos bluteten in die Nacht“) sowie weder logisch noch zeitlich passende Sprünge. Mir wurde nicht einmal klar, worum es in der jeweiligen Geschichte ging. Es sind Geschichten, die anscheinend nur um des Erzählens willen erzählt werden. Oder um Knete zu machen. Warum die Leserschar an Boyles Lippen hängt, ist mir in keiner Hinsicht verständlich. Aber es gibt ja bekanntlich nicht wenige Leute, die gerne Maggi-Tütensuppen essen. 13 verschwendete Euros.
David Graeber/David Wengrow: Anfänge
Ganzer Beitrag …
Ortwin Renn: Gefühlte Wahrheiten
Ganzer Beitrag ...
Juli Zeh: Über Menschen
Ganzer Beitrag ...
Arlt/Becker/Mann/Wirtz: Einsam in Gesellschaft (Wolf Schneider KI)
Kaum ein Journalist kann mit dem Namen Wolf Schneider nichts anfangen. In Wikipedia heißt es über ihn:
Nun gibt es eine Wolf Schneider KI, die in Schneiders Sinne Texte analysiert oder sogar korrigiert. Ich habe mal einen Absatz aus einer Rezension der KI zur Überprüfung gegeben. So sieht das Ergebnis aus:
Die Beiträge reichen von rein wissenschaftlichen Sichten auf das komplexe und nicht immer leicht zu fassende Thema, bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Damit wird klar, dass dieses Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Leute in der Beschäftigung mit alleinstehenden oder einsamen Menschen. Eindeutiger Schwerpunkt ist die Betrachtung der Einsamkeit aus wissenschaftlichem, speziell sozialwissenschaftlichem und psychologischem Blickwinkel. Trotzdem kommt die Praxis nicht zu kurz.
Das Buch bietet eine Vielzahl von Beiträgen, die das Thema Einsamkeit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Es reicht von rein wissenschaftlichen Betrachtungen bis hin zu Praxisberichten aus der Bahnhofsmission oder Hospizarbeit. Dabei wird deutlich, dass das Buch nicht als Ratgeber für Menschen mit Einsamkeitsgefühlen gedacht ist, sondern eher für professionell betraute Personen, die mit alleinstehenden oder einsamen Menschen arbeiten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der wissenschaftlichen, insbesondere sozialwissenschaftlichen und psychologischen Betrachtung der Einsamkeit. Dennoch kommen auch praktische Aspekte nicht zu kurz.
Insgesamt bietet das Buch eine fundierte und vielseitige Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit. Es liefert sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Einblicke und regt zum Nachdenken an. Die Beiträge sind gut strukturiert und verständlich geschrieben. Die Autoren verwenden klare und präzise Sprache, sodass auch Leser ohne Fachkenntnisse dem Inhalt gut folgen können. Ein positiver Aspekt des Buches ist die Vielfalt der Perspektiven, aus denen das Thema Einsamkeit betrachtet wird. Dies ermöglicht es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Facetten der Einsamkeit zu entwickeln. Die Beiträge sind gut recherchiert und mit konkreten Beispielen untermauert, was ihre Glaubwürdigkeit stärkt.
Ein möglicher Kritikpunkt ist, dass das Buch sich hauptsächlich an Fachleute richtet und weniger an Menschen, die selbst von Einsamkeit betroffen sind. Es fehlen konkrete Ratschläge oder Handlungsempfehlungen für Betroffene, die das Buch als Hilfe zur Bewältigung ihrer Einsamkeit nutzen könnten. Insgesamt ist "Lonely Lectures: Perspektiven auf Einsamkeit" eine empfehlenswerte Lektüre für Fachleute, die sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen. Es bietet eine fundierte und vielseitige Perspektive auf das Thema und regt zum Nachdenken an.
Die neue Fassung mag zwar im Sinne von Wolf Schneider lesbarer zu sein, wächst jedoch von 170 Wörtern auf 248 Wörter an. Leider verändert sie auch Sinninhalte.
Ralf Zerback: Triumpf der Gewalt
Ganzer Beitrag ...
Arlt/Becker/Mann/Wirtz: Einsam in Gesellschaft
Ganzer Beitrag ...
Pia Lamberty & Katharina Nocun: Gefährlicher Glaube
Ganzer Beitrag ...
Carlo Masala: Weltunordnung
Ganzer Beitrag ...
MaxPlanckForschung
Benjamin Lahusen: Der Dienstbetrieb ist nicht gestört
Ganzer Beitrag ...
Stephan Lessenich: Nicht mehr normal
Ganzer Beitrag ...