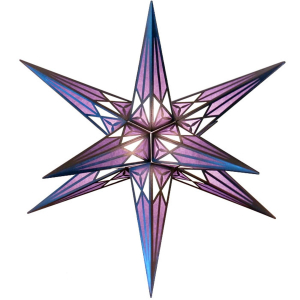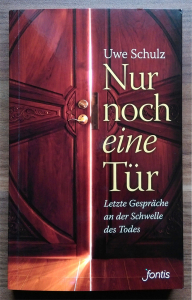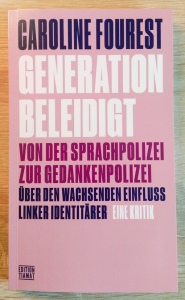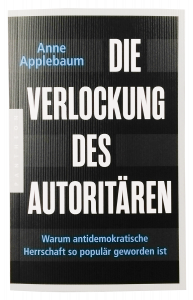 Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.
Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.
Beiträge
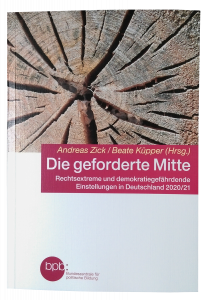 Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die „Mitte“ ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.
Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die „Mitte“ ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.
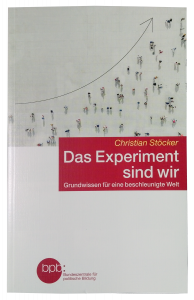 Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:
Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:
Nur 18% der Studenten lieferten spontan die richtige Antwort, von den anderen 82% meinte die große Mehrheit, das sei nach 24 Tagen der Fall gewesen. Was zeigt, dass Menschen, auch die mit einer höheren Bildung, mit exponentiellen Funktionen nicht umgehen können. So waren auch Politiker und sogar Wissenschaftler von der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus überrascht. Ich war ob des Themas von einer gewissen Skepsis beim Beginn des Buches befangen, musste aber schnell feststellen, dass Stöcker mit seiner These völlig recht hat. Dieser eingebaute Mangel an Verständnis für Mathematik hat Konsequenzen. Unsere Entscheidungsblindheit und unsere Neigung zu unlogischen Annahmen hat schon Daniel Kahneman bewiesen, der in diesem Buch oft zitiert wird. Die eigentliche Frage ist daher, was diese Einschränkung bewirkt, in einer Welt, die von exponentiellen Entwicklungen geprägt ist. Sei es in der Technik und der Wissenschaft, in gesellschaftlichen und politischen Tendenzen, in der weltweiten Bevölkerungszahl oder beim Klimawandel. Doch ist das das nicht das einzige Thema, nicht einmal das zentrale, sondern Stöcker ist in der Forschung der künstlichen Intelligenz beteiligt. Auch die entwickelt sich exponentiell, nicht nur wegen immer leistungsfähigerer Hardware, sondern auch wegen ganz neuer Wege und Methoden in der Software. KI greift schon dort immer mehr in unser Leben ein als gedacht, wo wir sie direkt gar nicht sehen: in den sozialen Medien. Mit weitreichenden Folgen, die immer gefährlicher werden. Also ist es nicht ein Buch über menschliche Fehlannahmen, sondern mehr über künstliche Intelligenz.
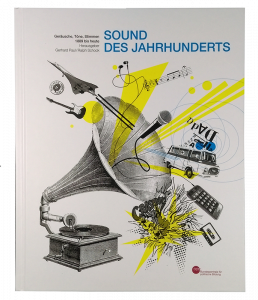 Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.
Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.
Begleitet werden die 100 Beiträge unterschiedlichster Autoren vieler Wissensbereiche von einer DVD mit mehr als 80 akustischen Dokumenten, die von historischen Klängen bis zu politischen Reden und einfach Geräuschen die Texte ergänzen. Ein Brecher von Buch mit vielen Bildern und Illustrationen. Für ein Buch dieses Umfangs und dieser Tiefe zu einem unfassbar fairen Preis bei der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de). Für alle an der Akustik technisch, kulturell und historisch Interessierten eine tolle Lektüre, die einen lange beschäftigt.
Der Klappentext:
Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute
Wie klingt eigentlich Geschichte? Das zwanzigste Jahrhundert erlebte akustische Zäsuren wie keine Zeit zuvor. Was war der charakteristische Sound der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen? Welche Kraft hatten bestimmte Schallereignisse? Wie ist das Verhältnis von Sound und Macht? Wie sehr präg(t)en akustische Welt und Hörsinn den menschlichen Alltag und das historische Geschehen? Schriftliche und bildliche Quellen werden schon lange untersucht, aber in diesem Dossier stehen Geräusche, Töne und Stimmen im Fokus. Die interdisziplinär ausgelegten Beiträge erhellen die sozialen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen oder geschlechterspezifischen Aspekte einzelner Klanggeschichten.
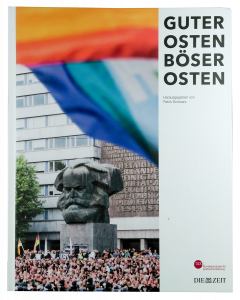 Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg 'gemacht'. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der "ZEIT im Osten". Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,-- Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.
Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg 'gemacht'. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der "ZEIT im Osten". Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,-- Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.
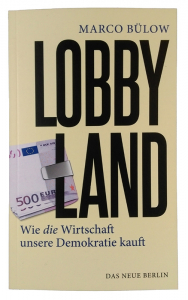 Ein Mitglied der SPD aus Dortmund kommt 2002 mit gerade mal 31 Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag. Er ist voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein, hat hehre Vorstellungen von Politik, will verändern und progressive linke Politik machen. Doch kaum ist er in Berlin angekommen, wird er ausgebremst und diszipliniert. Von Parteitaktik und Fraktionszwang, von den ungeschriebenen Regeln. Kritiker der Großen Koalition während der Regierungsbildung 2017/2018, stimmt er im März 2018 gegen Angela Merkel. Seine Progressive Plattform verfolgt zwei Ziele: In einem linken Bündnis die SPD zu erneuern und gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland anzugehen. 5.000 Menschen unterschrieben seinen Aufruf, rund die Hälfte SPD-Mitglieder, die andere Hälfte Mitglieder in anderen Parteien oder parteilos. Doch er scheitert. 2018 tritt er aus der SPD aus. In seinem Buch Lobbyland erzählt er seine Geschichte, von seinen Erlebnissen in der Politik und erklärt seine Sicht auf den deutschen Politikbetrieb. Da ich bisher nicht gehört habe, dass jemand gegen diese Aussagen geklagt hätte, ist unsere Demokratie wohl viel weniger von der AfD oder von Verschwörungserzählern bedroht, sondern eher durch das Treiben unter der großen gläsernen Kuppel am Platz der Republik 1.
Ein Mitglied der SPD aus Dortmund kommt 2002 mit gerade mal 31 Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag. Er ist voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein, hat hehre Vorstellungen von Politik, will verändern und progressive linke Politik machen. Doch kaum ist er in Berlin angekommen, wird er ausgebremst und diszipliniert. Von Parteitaktik und Fraktionszwang, von den ungeschriebenen Regeln. Kritiker der Großen Koalition während der Regierungsbildung 2017/2018, stimmt er im März 2018 gegen Angela Merkel. Seine Progressive Plattform verfolgt zwei Ziele: In einem linken Bündnis die SPD zu erneuern und gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland anzugehen. 5.000 Menschen unterschrieben seinen Aufruf, rund die Hälfte SPD-Mitglieder, die andere Hälfte Mitglieder in anderen Parteien oder parteilos. Doch er scheitert. 2018 tritt er aus der SPD aus. In seinem Buch Lobbyland erzählt er seine Geschichte, von seinen Erlebnissen in der Politik und erklärt seine Sicht auf den deutschen Politikbetrieb. Da ich bisher nicht gehört habe, dass jemand gegen diese Aussagen geklagt hätte, ist unsere Demokratie wohl viel weniger von der AfD oder von Verschwörungserzählern bedroht, sondern eher durch das Treiben unter der großen gläsernen Kuppel am Platz der Republik 1.
Lange genug habe ich Bögen um dieses Buch gemacht. Dabei ist der Autor eine meiner liebsten Stimmen im WDR. Uwe Schulz, Journalist, Autor, Moderator, Trainer, seit 1993 war er bei Eins Live, dem WDR-Fernsehen, WDR 2 und in der WM-Redaktion 2006 des ARD-Hörfunks beschäftigt. Aktuell hört man ihn oft in WDR 5, vom Morgenecho über Alles in Butter bis zur Medienschelte in Töne, Texte, Bilder. Eine Zeit lang war er stellvertretender Studioleiter in Bielefeld und hatte eine Korrespondenten-Vertretung im ARD-Studio in London. Sein Buch Nur noch eine Tür behandelt ein Thema, mit dem die Beschäftigung mit 30 noch leicht fällt, aber um so schwerer, wenn man wie ich die 60 schon länger hinter sich gelassen hat. Dabei ist es weder eine philosophische, noch eine wissenschaftliche, noch eine theoretische Betrachtung. Es ist eine Art Reflektion über diesen letzten Weg, diese letzte Tür, durch die wir alle irgendwann gehen müssen. Uwe Schulz leuchtet aus, was der Tod in unserem Alltag bedeutet, mit Menschen, bei denen eben diese letzte Tür zum Alltag oder sogar zu ihrem Beruf gehört. Oder die selbst das Ende ihres irdischen Daseins vor Augen haben. Denn mal mutig ans Werk. Spoileralarm: es lohnt sich.
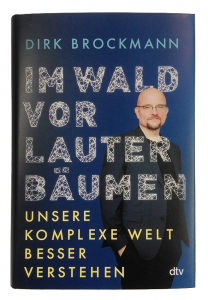 Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?
Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?
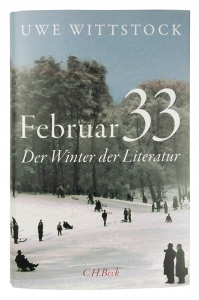 Wer noch etwas mit Namen wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Carl von Ossietzky, Heinrich von Brentano, Berthold Brecht und sogar Gustav Kiepenheuer anfangen kann, für den ist das Buch das richtige. Allen gemein ist, dass sie von den Nazis nach der Machtübernahme mit der Vereidigung Adolf Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933 vertrieben, verhaftet oder wenigstens mundtot gemacht wurden. Künstler, Schauspieler, Journalisten und Theaterleute bis hin zu Verlegern und natürlich auch Politiker. Es geht jedoch in diesem Buch nicht um Politiker, die spielen eher eine Nebenrolle, als historische Fakten, Taktgeber oder Zeitgenossen. Wie das verbrecherische Regime ab der Machtübernahme die deutsche Kulturszene umkrempelte, als nur noch den Nazis wohlgefällige oder dienstbare Geister oder besser gleich Parteimitglieder einen völkischen, antisemitischen und stramm rechten Kurs durchsetzten. Der Februar 1933 war in diesem Trauerspiel ein zentraler Monat, nach den Notverordnungen der Beginn der Horrorjahre bis 1945. Aber Februar 33 ist kein Geschichtsbuch, keine Auflistung von Daten und Geschehnissen, sondern ein Roman. Es geht um die Zeit, als man im Januar Deutschland als demokratische Republik verließ und im März in eine Diktatur zurückkehrte.
Wer noch etwas mit Namen wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Carl von Ossietzky, Heinrich von Brentano, Berthold Brecht und sogar Gustav Kiepenheuer anfangen kann, für den ist das Buch das richtige. Allen gemein ist, dass sie von den Nazis nach der Machtübernahme mit der Vereidigung Adolf Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933 vertrieben, verhaftet oder wenigstens mundtot gemacht wurden. Künstler, Schauspieler, Journalisten und Theaterleute bis hin zu Verlegern und natürlich auch Politiker. Es geht jedoch in diesem Buch nicht um Politiker, die spielen eher eine Nebenrolle, als historische Fakten, Taktgeber oder Zeitgenossen. Wie das verbrecherische Regime ab der Machtübernahme die deutsche Kulturszene umkrempelte, als nur noch den Nazis wohlgefällige oder dienstbare Geister oder besser gleich Parteimitglieder einen völkischen, antisemitischen und stramm rechten Kurs durchsetzten. Der Februar 1933 war in diesem Trauerspiel ein zentraler Monat, nach den Notverordnungen der Beginn der Horrorjahre bis 1945. Aber Februar 33 ist kein Geschichtsbuch, keine Auflistung von Daten und Geschehnissen, sondern ein Roman. Es geht um die Zeit, als man im Januar Deutschland als demokratische Republik verließ und im März in eine Diktatur zurückkehrte.
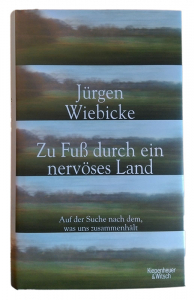 Jürgen Wiebicke ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, durch Deutschland zu Fuß zu reisen. Und doch macht er es anders. Kein sportlicher Hintergrund, sondern ein politisch-philosophischer. Nicht durch ganz Deutschland, oder quer durch Deutschland, sondern nur von Köln an den Niederrhein, durch das Münsterland bis nach Ostwestfalen. Er will herausfinden, was dieses Land noch zusammen hält, im so spektakulären Jahr 2015. Dazu erwischt er einen der heißesten Sommer im schweißtreibenden Juli. Das Buch erschien schon 2016, gelesen in einer Neuauflage in 2019. So macht er sich auf den Weg, schaut sich im Land um, spricht Leute an, die ihm auf seinem Weg begegnen, hat jedoch zusätzlich feste Termine, wie mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, einer Philosophin, einer Künstlerin, einem Pater in einem Kloster, mit einem Museumsleiter in Herne. Es ist keine so ungewöhnliche Reise, ungewöhnlich ist, wie ein Philosoph auf die Dinge schaut. Auf die Dinge, die das Jahr 2015 prägen, die vielen Flüchtlinge, die Krise in Griechenland, die die Eurozone zu sprengen droht, der Aufstieg der AfD, überhaupt die Nervosität in Deutschland. Und wie man es von Jürgen Wiebicke erwarten würde, sind es nicht die Ereignisse auf dieser Reise, die den wirklichen Inhalt des Buches ausmachen. Sondern seine Gedanken dazu, wie es wohl Aristoteles, Marc Aurel oder Sokrates sehen würde. Oder eben Jürgen Wiebicke.
Jürgen Wiebicke ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, durch Deutschland zu Fuß zu reisen. Und doch macht er es anders. Kein sportlicher Hintergrund, sondern ein politisch-philosophischer. Nicht durch ganz Deutschland, oder quer durch Deutschland, sondern nur von Köln an den Niederrhein, durch das Münsterland bis nach Ostwestfalen. Er will herausfinden, was dieses Land noch zusammen hält, im so spektakulären Jahr 2015. Dazu erwischt er einen der heißesten Sommer im schweißtreibenden Juli. Das Buch erschien schon 2016, gelesen in einer Neuauflage in 2019. So macht er sich auf den Weg, schaut sich im Land um, spricht Leute an, die ihm auf seinem Weg begegnen, hat jedoch zusätzlich feste Termine, wie mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, einer Philosophin, einer Künstlerin, einem Pater in einem Kloster, mit einem Museumsleiter in Herne. Es ist keine so ungewöhnliche Reise, ungewöhnlich ist, wie ein Philosoph auf die Dinge schaut. Auf die Dinge, die das Jahr 2015 prägen, die vielen Flüchtlinge, die Krise in Griechenland, die die Eurozone zu sprengen droht, der Aufstieg der AfD, überhaupt die Nervosität in Deutschland. Und wie man es von Jürgen Wiebicke erwarten würde, sind es nicht die Ereignisse auf dieser Reise, die den wirklichen Inhalt des Buches ausmachen. Sondern seine Gedanken dazu, wie es wohl Aristoteles, Marc Aurel oder Sokrates sehen würde. Oder eben Jürgen Wiebicke.
 Die Veränderung des Klimas auf der Erde, das Steigen der Jahres-Durchschnittstemperaturen, all das sind keine Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts. Schon in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts fielen diese rapiden Veränderungen Wissenschaftlern auf. Nicht umsonst warnte schon 1992 der Club of Rome in seinem Bericht Neue Grenzen des Wachstums vor den Auswirkungen der zunehmend freigesetzten Treibhausgase. Seitdem gibt es tausende von Berichten und Analysen, die die Erderwärmung nicht nur erklären, sondern auch beweisen. Was bisher fehlte, jedenfalls in der deutschen Literatur, war eine Art Meta-Betrachtung all dieser Daten. Das holen Nick Reimer und Toralf Staud in diesem Buch nach. Bezogen auf das Wissen, das wir heute über die Erderwärmung haben, wie sieht demnach im Jahre 2050 die Lage in Deutschland aus? Was sind die Auswirkungen für Deutschland, auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität? Die Grundlage für das Buch sind Zahlen, Daten und Fakten. Natürlich sind es letztendlich Projektionen und Prognosen. Wer aber im Physik- und Chemieunterricht in der Schule halbwegs wach war, kann die Schlüsse und Folgerungen der Autoren mühelos nachvollziehen. Das Ergebnis müsste eigentlich mindestens alle Politiker und Wirtschaftsmenschen in helle Panik versetzen. Den normalen Bürger genau so. Warum das eben nicht so ist, versucht ein Interview als letztes Kapitel zu klären. Danach kann ich am Ende nur so zusammen fassen: Es sieht übel aus.
Die Veränderung des Klimas auf der Erde, das Steigen der Jahres-Durchschnittstemperaturen, all das sind keine Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts. Schon in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts fielen diese rapiden Veränderungen Wissenschaftlern auf. Nicht umsonst warnte schon 1992 der Club of Rome in seinem Bericht Neue Grenzen des Wachstums vor den Auswirkungen der zunehmend freigesetzten Treibhausgase. Seitdem gibt es tausende von Berichten und Analysen, die die Erderwärmung nicht nur erklären, sondern auch beweisen. Was bisher fehlte, jedenfalls in der deutschen Literatur, war eine Art Meta-Betrachtung all dieser Daten. Das holen Nick Reimer und Toralf Staud in diesem Buch nach. Bezogen auf das Wissen, das wir heute über die Erderwärmung haben, wie sieht demnach im Jahre 2050 die Lage in Deutschland aus? Was sind die Auswirkungen für Deutschland, auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität? Die Grundlage für das Buch sind Zahlen, Daten und Fakten. Natürlich sind es letztendlich Projektionen und Prognosen. Wer aber im Physik- und Chemieunterricht in der Schule halbwegs wach war, kann die Schlüsse und Folgerungen der Autoren mühelos nachvollziehen. Das Ergebnis müsste eigentlich mindestens alle Politiker und Wirtschaftsmenschen in helle Panik versetzen. Den normalen Bürger genau so. Warum das eben nicht so ist, versucht ein Interview als letztes Kapitel zu klären. Danach kann ich am Ende nur so zusammen fassen: Es sieht übel aus.
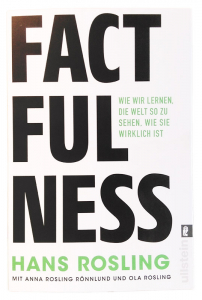 Wahrscheinlich ist es eher selten, dass ich mit Bill Gates und Barack Obama einer Meinung bin. Was dieses Buch angeht dann aber schon. Beide bezeichnen es als ein sehr lesenswertes und inspirierendes Buch. Es geht um unser Denken und unsere Vorstellung der Wirklichkeit. Wobei das Thema an sich für mich nicht ganz so neu war, denn auch die Bücher von Gerd Gigerenzer und Daniel Kahneman beschäftigen sich mit der Frage, warum wir mit unseren Bauchgefühlen und Intuitionen so oft falsch liegen. Rosling beweist das nicht nur besonders anschaulich, sondern zeigt unsere Fehleinschätzungen der Realität besonders plakativ und überraschend zugleich. Dabei war Rosling nicht Psychologe oder Soziologe oder gar Philosoph, sondern kam aus der Medizin. Genau dort stieß er jedoch auf Hinweise, dass wir mit unseren Einschätzungen und Urteilen weit unter Zufallsergebnissen liegen. Und sogar schlechter in Fragenkatalogen zu medizinischen, politischen und sozialen Themen abschneiden als eine Horde Schimpansen. Das führt er auf einige, wie er sie nennt, Instinkte in unserem Denken zurück. Wie der Instinkt der Dringlichkeit. Deshalb dieses Buch lesen! Sofort! Ehe es zu spät ist!!!
Wahrscheinlich ist es eher selten, dass ich mit Bill Gates und Barack Obama einer Meinung bin. Was dieses Buch angeht dann aber schon. Beide bezeichnen es als ein sehr lesenswertes und inspirierendes Buch. Es geht um unser Denken und unsere Vorstellung der Wirklichkeit. Wobei das Thema an sich für mich nicht ganz so neu war, denn auch die Bücher von Gerd Gigerenzer und Daniel Kahneman beschäftigen sich mit der Frage, warum wir mit unseren Bauchgefühlen und Intuitionen so oft falsch liegen. Rosling beweist das nicht nur besonders anschaulich, sondern zeigt unsere Fehleinschätzungen der Realität besonders plakativ und überraschend zugleich. Dabei war Rosling nicht Psychologe oder Soziologe oder gar Philosoph, sondern kam aus der Medizin. Genau dort stieß er jedoch auf Hinweise, dass wir mit unseren Einschätzungen und Urteilen weit unter Zufallsergebnissen liegen. Und sogar schlechter in Fragenkatalogen zu medizinischen, politischen und sozialen Themen abschneiden als eine Horde Schimpansen. Das führt er auf einige, wie er sie nennt, Instinkte in unserem Denken zurück. Wie der Instinkt der Dringlichkeit. Deshalb dieses Buch lesen! Sofort! Ehe es zu spät ist!!!
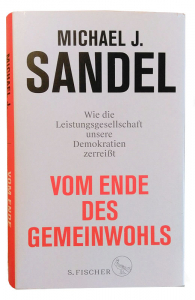 Mit ins Deutsche übersetzten Büchern amerikanischer Autoren tue ich mich manchmal schwer. Es sei denn, es geht um Musiktheorie oder Physik. Zu unterschiedlich sind, trotz aller politischen und wirtschaftlichen Parallelen, Werte und soziale Normen in Deutschland und den USA. Auch Michael J. Sandels Buch über das Ende des Gemeinwohls fußt auf amerikanischen Verhältnissen und der amerikanischen Geschichte. Besonders in diesem Fall den Verhältnissen an Universitäten und der Gesellschaft jenseits des Atlantiks. So konzentriert sich Sandel auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Machtverhältnisse und wirtschaftlichen Lage in seinem Land. Also zuerst gesehen fern der bundesdeutschen Realität, könnte man meinen. Doch es täuscht. Sandel liefert eine gelegentlich etwas abgehobene, detailverliebte und dann wieder sehr feinsinnige Analyse, warum Brexit, Donald Trump und Rechtpopulismus weltweit solche Siegeszüge antreten konnten. Oder wie der Spruch lautet, dass die Entwicklungen in Deutschland denen in den USA nur um zehn Jahre hinterher hinken. Da ist etwas dran.
Mit ins Deutsche übersetzten Büchern amerikanischer Autoren tue ich mich manchmal schwer. Es sei denn, es geht um Musiktheorie oder Physik. Zu unterschiedlich sind, trotz aller politischen und wirtschaftlichen Parallelen, Werte und soziale Normen in Deutschland und den USA. Auch Michael J. Sandels Buch über das Ende des Gemeinwohls fußt auf amerikanischen Verhältnissen und der amerikanischen Geschichte. Besonders in diesem Fall den Verhältnissen an Universitäten und der Gesellschaft jenseits des Atlantiks. So konzentriert sich Sandel auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Machtverhältnisse und wirtschaftlichen Lage in seinem Land. Also zuerst gesehen fern der bundesdeutschen Realität, könnte man meinen. Doch es täuscht. Sandel liefert eine gelegentlich etwas abgehobene, detailverliebte und dann wieder sehr feinsinnige Analyse, warum Brexit, Donald Trump und Rechtpopulismus weltweit solche Siegeszüge antreten konnten. Oder wie der Spruch lautet, dass die Entwicklungen in Deutschland denen in den USA nur um zehn Jahre hinterher hinken. Da ist etwas dran.
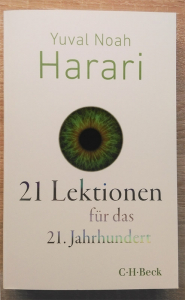 Der Mittelteil seiner Trilogie Eine kurze Geschichte der Menschheit, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. Während der erste Teil auf die Entstehung des Homo Sapiens zurückblickt und der letzte in die ferne Zukunft unserer Spezies voraus, geht Harari hier in die nahe Zukunft des Menschen. Wie er das tut, ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht revolutionär. Er nimmt sich 21 Stichwörter in fünf Bereichen oder Kapiteln und, nun ja, philosophiert darüber. Wofür stehen Menschen bei diesen Begriffen und was wird daraus in der nächsten Zeit werden? Welche Rolle spielen sie aktuell und welche in der nahen Zukunft? Das sind Begriffe wie Desillusionierung, Gleichheit, Religion, Demut oder Postfaktisch. In diesem Sinne tendiert das Buch eher in eine philosophische Richtung als in eine historische, anstatt Sachbuch oder Analyse zu sein. So steht eine Prognose im Vordergrund, noch mehr eine Reflektion, trotz des Blicks in die Zukunft. Mal wieder ein sperriges Buch von Harari, nix für die Sonnenliege auf Malle. Trotzdem klug, faszinierend und erhellend. Ein Buch, dem es gelingt, einen auf eigene Gedanken zu bringen.
Der Mittelteil seiner Trilogie Eine kurze Geschichte der Menschheit, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. Während der erste Teil auf die Entstehung des Homo Sapiens zurückblickt und der letzte in die ferne Zukunft unserer Spezies voraus, geht Harari hier in die nahe Zukunft des Menschen. Wie er das tut, ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht revolutionär. Er nimmt sich 21 Stichwörter in fünf Bereichen oder Kapiteln und, nun ja, philosophiert darüber. Wofür stehen Menschen bei diesen Begriffen und was wird daraus in der nächsten Zeit werden? Welche Rolle spielen sie aktuell und welche in der nahen Zukunft? Das sind Begriffe wie Desillusionierung, Gleichheit, Religion, Demut oder Postfaktisch. In diesem Sinne tendiert das Buch eher in eine philosophische Richtung als in eine historische, anstatt Sachbuch oder Analyse zu sein. So steht eine Prognose im Vordergrund, noch mehr eine Reflektion, trotz des Blicks in die Zukunft. Mal wieder ein sperriges Buch von Harari, nix für die Sonnenliege auf Malle. Trotzdem klug, faszinierend und erhellend. Ein Buch, dem es gelingt, einen auf eigene Gedanken zu bringen.
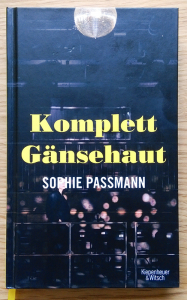 Als ich 27 war, wohnte ich noch in der gleichen Stadt, in der ich geboren wurde. In der ich die Volksschule und die Fachoberschule besuchte. Und doch waren die drei Welten ganz verschiedene. Sogar das heutige Berlin hat mit meinem Berlin aus den Achtzigern nicht mehr viel zu tun. Selbst Kreuzberg nicht. Aber so ist es einmal eine andere Welt, wenn man 38 Jahre älter ist als Sophie Passmann. Ich weiß nicht einmal genau, wie ich an dieses Buch gekommen bin, könnte eine Leseempfehlung in der Psychologie Heute gewesen sein. Solche Bücher lese ich, wenn ich mehr über sie weiß, meistens nicht. Meistens. In diesem Fall war ich froh, das Buch in der Buchhandlung meines Vertrauens geordert zu haben, die nicht mit A anfängt, sondern mit M.
Als ich 27 war, wohnte ich noch in der gleichen Stadt, in der ich geboren wurde. In der ich die Volksschule und die Fachoberschule besuchte. Und doch waren die drei Welten ganz verschiedene. Sogar das heutige Berlin hat mit meinem Berlin aus den Achtzigern nicht mehr viel zu tun. Selbst Kreuzberg nicht. Aber so ist es einmal eine andere Welt, wenn man 38 Jahre älter ist als Sophie Passmann. Ich weiß nicht einmal genau, wie ich an dieses Buch gekommen bin, könnte eine Leseempfehlung in der Psychologie Heute gewesen sein. Solche Bücher lese ich, wenn ich mehr über sie weiß, meistens nicht. Meistens. In diesem Fall war ich froh, das Buch in der Buchhandlung meines Vertrauens geordert zu haben, die nicht mit A anfängt, sondern mit M.
Das Buch ist kein Sachbuch, es ist kein Roman, nicht mal ein Essay. Es ist ein Buch, in dem die Autorin in ihrer neuen schönen Wohnung sitzt und sich fragt, was sie und ihre Generation denn wohl besser gemacht haben als Eltern. Von Großeltern ganz abgesehen. Ob sie wirklich die ihr angedachten Chancen genutzt, die Digitalisierung gewinnbringend eingesetzt haben und überhaupt klüger waren, als sie es ihren Eltern zustanden. So gesehen ist es eine niedergeschriebene Reflektion, öffentlich zugänglich gemacht. Das klingt nach nicht viel. Aber manchmal ist weniger mehr.
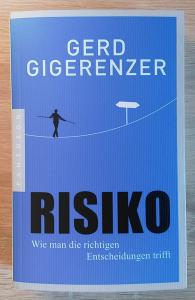 Bestimmt haben Sie auf Ihrem Smartphone auch eine Wetter-App. Neben der Wetterprognose wird dort eine sogenannte Regenwahrscheinlichkeit angegeben, nämlich in Prozent. Aber was sagt die Zahl 40% aus? Dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen wird? Oder dass die Meteorologen zu 40% mit ihren Voraussagen richtig lagen? In Wikipedia liest sich das so: "Eine prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit für den 1. November von 100 % für die Stadt Wuppertal bedeutet, dass es bei vergleichbaren Wetterlagen (Luftdruck, Windrichtung, Luftmassen usw.) in der Vergangenheit immer irgendwo in Wuppertal geregnet hat, so dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch am 1. November im Stadtgebiet regnen wird. Daraus lässt sich demnach nicht ableiten, dass es den ganzen Tag (100 % des Zeitraumes) regnen wird oder dass es überall in Wuppertal regnen wird (100 % des Vorhersagegebietes).". Heißt, dass die Voraussage für Bielefeld in Paderborn wenig hilft. Selbst in Bielefeld ist sie schwer zu verstehen. Damit eigentlich nutzlos.
Bestimmt haben Sie auf Ihrem Smartphone auch eine Wetter-App. Neben der Wetterprognose wird dort eine sogenannte Regenwahrscheinlichkeit angegeben, nämlich in Prozent. Aber was sagt die Zahl 40% aus? Dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen wird? Oder dass die Meteorologen zu 40% mit ihren Voraussagen richtig lagen? In Wikipedia liest sich das so: "Eine prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit für den 1. November von 100 % für die Stadt Wuppertal bedeutet, dass es bei vergleichbaren Wetterlagen (Luftdruck, Windrichtung, Luftmassen usw.) in der Vergangenheit immer irgendwo in Wuppertal geregnet hat, so dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch am 1. November im Stadtgebiet regnen wird. Daraus lässt sich demnach nicht ableiten, dass es den ganzen Tag (100 % des Zeitraumes) regnen wird oder dass es überall in Wuppertal regnen wird (100 % des Vorhersagegebietes).". Heißt, dass die Voraussage für Bielefeld in Paderborn wenig hilft. Selbst in Bielefeld ist sie schwer zu verstehen. Damit eigentlich nutzlos.
Anderes Beispiel für die Verwirrung durch Zahlen. Als in Großbritannien die dritte Generation der Antibabypille eingeführt wurde, berichtete der britische Gesundheitsdienst, dass sich mit diesem neuen Medikament die Zahl der Thrombosefälle gegenüber der Vorversion verdoppelt habe. Genauer um 100% gestiegen sei sie. In absoluten Zahlen gab es zuvor bei 1.000 Frauen, die sie nahmen, einen Thrombosefall. Mit der dritten Pillengeneration waren es nun zwei. Bei wieder 1.000 Frauen. Dafür stieg in Großbritannien zu dieser Zeit die Zahl an Abtreibungen und ungewollten Schwangerschaften erheblich. Weil viele Frauen durch die genannten Zahlen abgeschreckt wurden. Gegen dieses Unwissen über und Unverständnis für tatsächliche oder vermutete Risiken schreibt Gerd Gigerenzer an. Und liefert damit ein faszinierendes Buch.
Obwohl ich Jürgen Wiebickes Buch nun schon länger abgeschlossen habe, wirkt die Geschichte in mir nach. Einmal, weil es viele Parallelen gibt, Wiebicke ist Jahrgang 1962, ich bin Jahrgang 1956. Auch meine Mutter ist die vorletzte Person in meiner Familie, die noch den letzten Krieg selbst erlebt hat, zu meiner Tante, Witwe des Bruders meiner Mutter, habe ich keinen Kontakt mehr. So wie Wiebicke seinen tief roten, sozialdemokratischen Opa hatte, der trotzdem für aus seiner Sicht schlechte Menschen den Begriff "Jüd" verwendete, gab es bei mir Onkel Heini, Bruder meiner Großmutter, der noch bis zu seinem Tod in den Achtzigern den überzeugten Nazi heraushängen ließ. Seine Tochter schwärmte von den tollen Zeiten im BDM (Bund deutscher Mädchen), Jude und Neger waren noch übliche Schmähungen in dieser Zeit. Das, was Wiebicke als Nazigift bezeichnet, war genau so in meine Familie tief eingedrungen, war ein Teil der DNA geworden. Dazwischen ich, die Pubertät gerade hinter mir, politisch weit links und bereits Teil der beginnenden Globalisierung. Nicht mehr lange und ich sollte in den USA, in Australien und England arbeiten und leben, wenigstens einige Zeit. So wie Wiebicke rücke ich beim Ableben meiner Mutter, 1933 geboren, ein Kästchen weiter nach vorn. Dann bin ich der Älteste in der Familie. Und der Letzte, der wenigstens noch von Zeitzeugen unmittelbar etwas über den Krieg gehört hat. Die Welt mit seiner Mutter, die Erzählungen über Bombenangriffe, Bunkernächte und die unbesiegbare Angst, kenne ich wie Wiebicke von seiner Mutter gut. Und doch ist es nicht das allein, was nachwirkt.
 Das Attribut 'berührend' verwende ich für Bücher nur sehr spärlich. Das einzige Buch, dem ich es nach meiner Erinnerung zugestanden habe, war das Buch «Nur noch eine Tür» von Uwe Schulz. Nun ist ein weiteres Buch dazu gekommen. Es stammt von Jürgen Wiebicke, freier Journalist, Autor, Philosoph, Moderator bei WDR5 für Das Philosophische Radio, aber auch das Tagesgespräch oder Neugier genügt. Dazu am philosophischen Festival phil.COLOGNE beteiligt. Nun könnte man annehmen, dass das Thema Sterben und Tod immer irgendwie berührend sei, schon wegen der Unumgänglichkeit für uns selbst. Aber das ist es nicht, der reale Tod nimmt hier nur in der Vergangenheit einen Platz ein, beim Tod des Vaters oder des Großvaters. Es geht ihm um etwas Anderes. Als Wiebicke klar wird, dass seine Mutter nicht mehr lange zu leben hat, beginnt er zu dokumentieren, was die Erlebnisse, Erfahrungen und Geheimnisse dieser Kriegsgeneration sind, von der seine Mutter in seiner Familie die vorletzte Vertreterin ist. Woher das häufige Schweigen kommt, über diese Zeit, welche Dinge nicht in die Öffentlichkeit sollten, was von den Geschehnissen der Zeit ab 1933 bis 1945 übrig blieb. Herausgekommen ist ein Buch, das um so nachdenklicher stimmt, je enger der zeitliche Horizont des Lesers ist. Oder, wie Wiebicke es formuliert, dass man selbst mit dem Tod der Eltern ein Kästchen weiter nach vorne rückt.
Das Attribut 'berührend' verwende ich für Bücher nur sehr spärlich. Das einzige Buch, dem ich es nach meiner Erinnerung zugestanden habe, war das Buch «Nur noch eine Tür» von Uwe Schulz. Nun ist ein weiteres Buch dazu gekommen. Es stammt von Jürgen Wiebicke, freier Journalist, Autor, Philosoph, Moderator bei WDR5 für Das Philosophische Radio, aber auch das Tagesgespräch oder Neugier genügt. Dazu am philosophischen Festival phil.COLOGNE beteiligt. Nun könnte man annehmen, dass das Thema Sterben und Tod immer irgendwie berührend sei, schon wegen der Unumgänglichkeit für uns selbst. Aber das ist es nicht, der reale Tod nimmt hier nur in der Vergangenheit einen Platz ein, beim Tod des Vaters oder des Großvaters. Es geht ihm um etwas Anderes. Als Wiebicke klar wird, dass seine Mutter nicht mehr lange zu leben hat, beginnt er zu dokumentieren, was die Erlebnisse, Erfahrungen und Geheimnisse dieser Kriegsgeneration sind, von der seine Mutter in seiner Familie die vorletzte Vertreterin ist. Woher das häufige Schweigen kommt, über diese Zeit, welche Dinge nicht in die Öffentlichkeit sollten, was von den Geschehnissen der Zeit ab 1933 bis 1945 übrig blieb. Herausgekommen ist ein Buch, das um so nachdenklicher stimmt, je enger der zeitliche Horizont des Lesers ist. Oder, wie Wiebicke es formuliert, dass man selbst mit dem Tod der Eltern ein Kästchen weiter nach vorne rückt.
Die Sicht der Autorin ist eine spezielle. Caroline Fourest ist eine französische feministische Schriftstellerin und Journalistin. Daher öffnet sich ihr Blick auf ihr Thema aus einer künstlerischen Sicht, auf Theater und Film, Literatur und Weltgeschehen. Da gibt es ein Mordsgezeter, weil eine weiße, niederländische Frau ein Gedicht der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten übersetzen soll. Das Original von einer schwarzen Frau geschrieben. Das ginge nicht, weil die Niederländerin ja eben nicht schwarz, sondern weiß sei. Scarlett Johansson wurde abgesprochen, in einem Film eine transsexuelle Person zu spielen, weil sie eben nicht transsexuell sei und weil ihr deshalb das Thema nicht zustehe. Ein weißer Pop-Musiker erntet einen riesigen Shitstorm, weil er zu einer Preisverleihung in einem dem indonesischen Raum zugeordneten Kleidungsstück erscheint. Genauer: einer Hose. Parallel zu den Tiraden vom rechten Rand des politischen Spektrums macht sich eine merkwürdige Identitätspolitik von links breit. Die sich von dem Gerede über Heimat und Identität kaum unterscheidet. Es folgen eine ganze Reihe von konkreten Beispielen, wo jemandem angeblich Dinge nicht zustehen, weil er nicht zu dieser Identität gehört. Eine Uni-Mensa muss vietnamesische Gerichte von der Karte nehmen, weil sie nicht das Original seien. Als wenn nur jemand eine Pizza zubereiten dürfte, wenn er gebürtiger Italiener sei. Der Wahnsinn scheint geradezu Methode zu haben. Doch er weist auf beunruhigende Entwicklungen hin.