 «Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier …». So steht es in der Bibel in Genesis 1, 28. Leichter gesagt als getan. Aber das mit den Fischen ist ein guter Einstieg. Da bauten nämlich Ende des 19. Jahrhundert die Leute in Chicago den Sanitary and Ship Canal, um die Abwasser aus Chicago statt in den Lake Michigan in den Chicago River und Mississippi zu leiten. Dazu musste die Fließrichtung des Chicago River ab einer bestimmten Stelle umgeleitet werden. Womit sich in einem großen Teil der USA die Wasserversorgung drastisch veränderte. Doch es kam noch schlimmer. Unterhalb des Chicago River hausten vier asiatische Barscharten, die man ausgesetzt hatte, um Algen in den Griff zu bekommen. Leider gerieten die Barsche außer Kontrolle und vermehrten sich explosionsartig. Diese vier Barscharten in Kombination fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Durch den neuen Kanal konnten die Barsche in die großen Seen im Norden einwandern, welche sie ratzekahl leer gefressen hätten. So bekam das United States Army Corps of Engineers den Auftrag, einen Elektrozaun im Chicago River zu bauen, um die Barsche fernzuhalten. Doch damit war die Kette an Problemen, die man sich eingebrockt hatte, noch lange nicht zu Ende. Also kein Buch über Theorien, sondern ganz praktische Beispiele, wie die Krone der Schöpfung die Kontrolle verlor.
«Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier …». So steht es in der Bibel in Genesis 1, 28. Leichter gesagt als getan. Aber das mit den Fischen ist ein guter Einstieg. Da bauten nämlich Ende des 19. Jahrhundert die Leute in Chicago den Sanitary and Ship Canal, um die Abwasser aus Chicago statt in den Lake Michigan in den Chicago River und Mississippi zu leiten. Dazu musste die Fließrichtung des Chicago River ab einer bestimmten Stelle umgeleitet werden. Womit sich in einem großen Teil der USA die Wasserversorgung drastisch veränderte. Doch es kam noch schlimmer. Unterhalb des Chicago River hausten vier asiatische Barscharten, die man ausgesetzt hatte, um Algen in den Griff zu bekommen. Leider gerieten die Barsche außer Kontrolle und vermehrten sich explosionsartig. Diese vier Barscharten in Kombination fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Durch den neuen Kanal konnten die Barsche in die großen Seen im Norden einwandern, welche sie ratzekahl leer gefressen hätten. So bekam das United States Army Corps of Engineers den Auftrag, einen Elektrozaun im Chicago River zu bauen, um die Barsche fernzuhalten. Doch damit war die Kette an Problemen, die man sich eingebrockt hatte, noch lange nicht zu Ende. Also kein Buch über Theorien, sondern ganz praktische Beispiele, wie die Krone der Schöpfung die Kontrolle verlor.
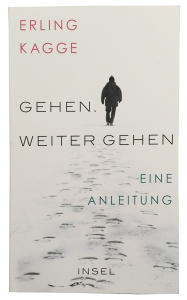 Nach einer im «The Guardian» veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, den Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum das Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken, die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet. Wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die Bipedie, ist jedoch nicht seine Erfindung, schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo Sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kagge viel mehr als Bequemlichkeit, es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurück kommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen, das ist es, was Kagge antreibt. Und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut. Wenn ich an meine Wanderungen in Snowdonia und im Lake District zurück denke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern.
Nach einer im «The Guardian» veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, den Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum das Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken, die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet. Wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die Bipedie, ist jedoch nicht seine Erfindung, schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo Sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kagge viel mehr als Bequemlichkeit, es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurück kommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen, das ist es, was Kagge antreibt. Und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut. Wenn ich an meine Wanderungen in Snowdonia und im Lake District zurück denke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Erling Kagge aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Erling Kagge aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
[/av_promobox]
 Dass man Geschichte durchaus interessant, sogar spannend und unterhaltend darstellen kann, hatten schon Bücher wie «Acht Tage im Mai» oder «Februar 33» bewiesen. Nicht ohne Grund bezieht sich Michael Wildt in seinem Vorwort auf «Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts» vom Historiker und Erzähler Golo Mann, immer noch ein Highlight der historischen Literatur. Nicht als Vergleich, sondern um eine neue, oder weitere Art der Darstellung der unruhigen und unrühmlichen Zeit in diesem unserem Lande zu eröffnen. Vergleichen kann sich Wildt mit Mann allerdings in einem Fall, nämlich was den Umfang des Buches angeht. Ein ziemlich heftiges Bündel Papier, was der Preis bei der BPB gar nicht vermuten lässt. Mit solchen Schinken tue ich mich immer zuerst etwas schwer. Weil sie doch eine lange Konzentration abverlangen und den Weg zu weiteren Büchern eine Zeit lang blockieren. So musste ich einen ordentlichen Anlauf nehmen, bevor ich die ersten Seiten aufschlug. Schon im Vorwort kündigt Wildt jedoch an, ein anderes Herangehen an die Erzählung der Geschichte wählen zu wollen als andere Autoren. Vereinfacht gesagt, einmal eher gröber, andererseits detaillierter. Und in der Tat entpuppt sich Wildts Art der Annäherung an diese vielschichtige und spannende Zeit als hervorragendes Rezept. So dass das Buch gerne immer wieder nach leider notwendigen Pausen in die Hand genommen wird. Um beim Begriff Rezept zu bleiben: es mundet ausgesprochen gut.
Dass man Geschichte durchaus interessant, sogar spannend und unterhaltend darstellen kann, hatten schon Bücher wie «Acht Tage im Mai» oder «Februar 33» bewiesen. Nicht ohne Grund bezieht sich Michael Wildt in seinem Vorwort auf «Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts» vom Historiker und Erzähler Golo Mann, immer noch ein Highlight der historischen Literatur. Nicht als Vergleich, sondern um eine neue, oder weitere Art der Darstellung der unruhigen und unrühmlichen Zeit in diesem unserem Lande zu eröffnen. Vergleichen kann sich Wildt mit Mann allerdings in einem Fall, nämlich was den Umfang des Buches angeht. Ein ziemlich heftiges Bündel Papier, was der Preis bei der BPB gar nicht vermuten lässt. Mit solchen Schinken tue ich mich immer zuerst etwas schwer. Weil sie doch eine lange Konzentration abverlangen und den Weg zu weiteren Büchern eine Zeit lang blockieren. So musste ich einen ordentlichen Anlauf nehmen, bevor ich die ersten Seiten aufschlug. Schon im Vorwort kündigt Wildt jedoch an, ein anderes Herangehen an die Erzählung der Geschichte wählen zu wollen als andere Autoren. Vereinfacht gesagt, einmal eher gröber, andererseits detaillierter. Und in der Tat entpuppt sich Wildts Art der Annäherung an diese vielschichtige und spannende Zeit als hervorragendes Rezept. So dass das Buch gerne immer wieder nach leider notwendigen Pausen in die Hand genommen wird. Um beim Begriff Rezept zu bleiben: es mundet ausgesprochen gut.
 »Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 Meter.« So begann am 29. Oktober 1923 die Zeit eines damals ganz neuen Mediums. Inzwischen hat das Radio, genauer der Hörfunk, viele Etappen hinter sich bringen müssen. Argwöhnisch beäugt in der Weimarer Republik und wie selbstverständlich staatsdienend, als Propagandainstrument in den Händen der Nazis, auferstanden aus Ruinen nach 1945, im Westen runderneuert am Beispiel der BBC, bevor die Alliierten ihn in die Hände des neuen deutschen Staates gaben. Auf der anderen Seite des Zaunes blieb das Radio Instrument des Staates, mit ihm sollte im real existierenden Sozialismus der neue Mensch gebildet, erzogen und informiert werden. Auch diese Phase fand 1989 ihr Ende. Seitdem gibt es wieder den MDR und der NDR hat neue Sendegebiete hinzu bekommen. Deutschland, einig Radioland. Zum runden Geburtstag hat nun die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Deutschen Rundfunkarchiv diesen Sonderband heraus gegeben. Für mich als Radiofreak seit meiner Kindheit, Fan von WDR 5 und Deutschlandfunk, ein Muss. Dabei als Hardcover im Großformat für nur sieben Euro ein tolles Geschenk für alle, die immer noch Radio hören, lieben und nicht darauf verzichten möchten.
»Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 Meter.« So begann am 29. Oktober 1923 die Zeit eines damals ganz neuen Mediums. Inzwischen hat das Radio, genauer der Hörfunk, viele Etappen hinter sich bringen müssen. Argwöhnisch beäugt in der Weimarer Republik und wie selbstverständlich staatsdienend, als Propagandainstrument in den Händen der Nazis, auferstanden aus Ruinen nach 1945, im Westen runderneuert am Beispiel der BBC, bevor die Alliierten ihn in die Hände des neuen deutschen Staates gaben. Auf der anderen Seite des Zaunes blieb das Radio Instrument des Staates, mit ihm sollte im real existierenden Sozialismus der neue Mensch gebildet, erzogen und informiert werden. Auch diese Phase fand 1989 ihr Ende. Seitdem gibt es wieder den MDR und der NDR hat neue Sendegebiete hinzu bekommen. Deutschland, einig Radioland. Zum runden Geburtstag hat nun die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Deutschen Rundfunkarchiv diesen Sonderband heraus gegeben. Für mich als Radiofreak seit meiner Kindheit, Fan von WDR 5 und Deutschlandfunk, ein Muss. Dabei als Hardcover im Großformat für nur sieben Euro ein tolles Geschenk für alle, die immer noch Radio hören, lieben und nicht darauf verzichten möchten.
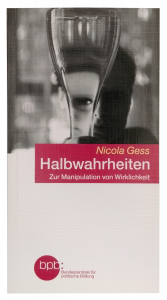 Donald Trump erzählte einmal, der deutsche Golfer Bernhard Langer hätte ihm berichtet, wie er vor einem Wahllokal in den USA 2016 merkwürdige Vorgänge beobachtet habe. Dazu befragt, sagte Langer, dass er Trump niemals persönlich getroffen hätte. Zwar konnte Langer sich daran erinnern, mit Leuten über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Wahlsystems gesprochen zu haben, aber niemals mit Donald Trump. Ein typisches Beispiel für Halbwahrheiten, denen sich Nicola Gess in ihrem Essay widmet. Wie der Name schon sagt, sind Halbwahrheiten keine Lügen. Stattdessen werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, verfälscht oder in einen anderen Kontext gesetzt, so dann uminterpretiert. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch die Wirkung von Halbwahrheiten ist verheerend. Wie im Buch zu lesen, sind Halbwahrheiten gefährlicher als Lügen, weil nicht mehr klar erkennbar ist, was noch Fakt und was Fiktion. Das Thema hat jedoch in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugelegt, weil Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen diese Kommunikationsform ausgiebig nutzen. Weil die Wirkung von Halbwahrheiten umso größer ist, je stärker sie die schon vorhandenen Überzeugungen belegen. Wie auch immer bezeichnet, als Halbwahrheiten, alternative Fakten, oder als Bullshit.
Donald Trump erzählte einmal, der deutsche Golfer Bernhard Langer hätte ihm berichtet, wie er vor einem Wahllokal in den USA 2016 merkwürdige Vorgänge beobachtet habe. Dazu befragt, sagte Langer, dass er Trump niemals persönlich getroffen hätte. Zwar konnte Langer sich daran erinnern, mit Leuten über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Wahlsystems gesprochen zu haben, aber niemals mit Donald Trump. Ein typisches Beispiel für Halbwahrheiten, denen sich Nicola Gess in ihrem Essay widmet. Wie der Name schon sagt, sind Halbwahrheiten keine Lügen. Stattdessen werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, verfälscht oder in einen anderen Kontext gesetzt, so dann uminterpretiert. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch die Wirkung von Halbwahrheiten ist verheerend. Wie im Buch zu lesen, sind Halbwahrheiten gefährlicher als Lügen, weil nicht mehr klar erkennbar ist, was noch Fakt und was Fiktion. Das Thema hat jedoch in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugelegt, weil Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen diese Kommunikationsform ausgiebig nutzen. Weil die Wirkung von Halbwahrheiten umso größer ist, je stärker sie die schon vorhandenen Überzeugungen belegen. Wie auch immer bezeichnet, als Halbwahrheiten, alternative Fakten, oder als Bullshit.
 Ich habe einen Moment nachdenken müssen, warum mir der Titel des Buches so bekannt vorkam. Es ist der verballhornte Name des Monty Python-Films »Die wunderbare Welt der Schwerkraft«. Mit Sketchen oder Satire hat das Buch jedoch nichts zu tun. Es erhebt nämlich den Anspruch, auch physikalisch und mathematisch wenig vorbelasteten Lesern den Wirkungskreis der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie vorzustellen. Es geht um Neutronensterne, Schwarze Löcher und weitere Phänomene wie Gravitationswellen. Kompetenz kann man Luciano Rezzolla bestimmt nicht absprechen. Der in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker gehörte zu den Ersten, denen es gelang, fotografische Bilder eines supermassiven Schwarzen Lochs zu erstellen. Wie das ging, ist im Buch ausführlich beschrieben. Nun hat Charlie Chaplin bei einem Pressetermin zu Albert Einstein gesagt, die Menschen liebten ihn, weil alle verstehen, was er macht. Während sie Einstein liebten, weil sie nichts von dem verstehen, was er macht. An diesem Punkt war ich auch, wollte aber immer gerne wissen, was Ereignishorizont, Raumzeit und Gravitation eigentlich sind. So war ich gespannt, ob das Buch hält, was der Autor verspricht.
Ich habe einen Moment nachdenken müssen, warum mir der Titel des Buches so bekannt vorkam. Es ist der verballhornte Name des Monty Python-Films »Die wunderbare Welt der Schwerkraft«. Mit Sketchen oder Satire hat das Buch jedoch nichts zu tun. Es erhebt nämlich den Anspruch, auch physikalisch und mathematisch wenig vorbelasteten Lesern den Wirkungskreis der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie vorzustellen. Es geht um Neutronensterne, Schwarze Löcher und weitere Phänomene wie Gravitationswellen. Kompetenz kann man Luciano Rezzolla bestimmt nicht absprechen. Der in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker gehörte zu den Ersten, denen es gelang, fotografische Bilder eines supermassiven Schwarzen Lochs zu erstellen. Wie das ging, ist im Buch ausführlich beschrieben. Nun hat Charlie Chaplin bei einem Pressetermin zu Albert Einstein gesagt, die Menschen liebten ihn, weil alle verstehen, was er macht. Während sie Einstein liebten, weil sie nichts von dem verstehen, was er macht. An diesem Punkt war ich auch, wollte aber immer gerne wissen, was Ereignishorizont, Raumzeit und Gravitation eigentlich sind. So war ich gespannt, ob das Buch hält, was der Autor verspricht.
 Was mich bei Querdenkern, Impfgegnern und anderen Schwurblern am meisten auf die Palme bringt, ist das völlige naturwissenschaftliche und technische Unwissen. Da passen elektronische Schaltkreise mit mehreren Millimetern Kantenlänge durch Injektionsnadeln, die außen weniger als einen halben Millimeter dick sind. Ganz zu schweigen davon, wo die Schaltungen im Blut ihre Stromversorgung herbekommen. mRNA-Impfstoffe verändern angeblich die Erbanlagen. Wenn man eine flache Scheibe im Weltall platzieren würde, wäre davon nach absehbarer Zeit eh nur noch eine Kugel da, weil physikalische Kräfte wie die Gravitation nun mal so wirken. Erst recht stutzig machte mich die Feststellung, dass mir Querdenker in Großbritannien oder den Niederlanden nicht aufgefallen sind. Also ein deutsches Phänomen? In gewisser Weise ja, sagt Ernst Peter Fischer in seinem aktuellen Buch. Die naturwissenschaftliche Bildung eines großen Teils der deutschsprachigen Gesellschaft sei praktisch nicht vorhanden, damit kann auch technisches Wissen nicht funktionieren. Millionen Leute wischen auf ihren Smartphones herum, ohne nur eine Spur von Ahnung darüber, was in der Schachtel passiert, und wie und warum. Je komplexer Technik wird, umso mehr erscheint sie als Mysterium. Auf dieser Grundlage grassieren dann Verschwörungstheorien, Mythen und Unsinn wie Schimmelpilze. Aber woher stammt diese Wissenschaftsfeindlichkeit, geradezu das Verlangen nach Unwissen und Inkompetenz, besonders in den Naturwissenschaften? Da muss man dann mit Fischer mal einige Jahrzehnte in die Vergangenheit schauen.
Was mich bei Querdenkern, Impfgegnern und anderen Schwurblern am meisten auf die Palme bringt, ist das völlige naturwissenschaftliche und technische Unwissen. Da passen elektronische Schaltkreise mit mehreren Millimetern Kantenlänge durch Injektionsnadeln, die außen weniger als einen halben Millimeter dick sind. Ganz zu schweigen davon, wo die Schaltungen im Blut ihre Stromversorgung herbekommen. mRNA-Impfstoffe verändern angeblich die Erbanlagen. Wenn man eine flache Scheibe im Weltall platzieren würde, wäre davon nach absehbarer Zeit eh nur noch eine Kugel da, weil physikalische Kräfte wie die Gravitation nun mal so wirken. Erst recht stutzig machte mich die Feststellung, dass mir Querdenker in Großbritannien oder den Niederlanden nicht aufgefallen sind. Also ein deutsches Phänomen? In gewisser Weise ja, sagt Ernst Peter Fischer in seinem aktuellen Buch. Die naturwissenschaftliche Bildung eines großen Teils der deutschsprachigen Gesellschaft sei praktisch nicht vorhanden, damit kann auch technisches Wissen nicht funktionieren. Millionen Leute wischen auf ihren Smartphones herum, ohne nur eine Spur von Ahnung darüber, was in der Schachtel passiert, und wie und warum. Je komplexer Technik wird, umso mehr erscheint sie als Mysterium. Auf dieser Grundlage grassieren dann Verschwörungstheorien, Mythen und Unsinn wie Schimmelpilze. Aber woher stammt diese Wissenschaftsfeindlichkeit, geradezu das Verlangen nach Unwissen und Inkompetenz, besonders in den Naturwissenschaften? Da muss man dann mit Fischer mal einige Jahrzehnte in die Vergangenheit schauen.
 Die bestellten Bücher sind noch nicht in der Buchhandlung angekommen, also zur Überbrückung ein E-Book. Offen gestanden, kannte ich die beiden Autoren bisher gar nicht, was wohl an meinem homöopathischen Fernsehkonsum liegt. Inzwischen weiß ich, dass sie im Hauptberuf Kabarettistin sowie Journalist und Kabarettist sind, was mir im Nachhinein das Buch erklärt. Es ist also mehr Satire als Sachbuch. Nun darf Satire landläufig so ziemlich alles, also auch über ZeitgenossInnen herziehen, Geschichten überinterpretieren und Fakten zur Unterhaltung ein wenig verdrehen. Die Ziele sind nun jedoch mal nicht vorrangig Prominente oder Politiker, sondern die Menschen und Ereignisse unseres Alltags. Die merkwürdigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen, Raucher, Autofahrer, Fleischesser, Jutta Ditfurth und Muslime, und weitere Entwicklungen der Neuzeit wie Influencer. Über all diese wird nun ein gewisser Hohn und Spott ausgekübelt. So stellte sich mir die Frage, was der Sinn darin sein könnte, was sich Gruber und Hock wohl dabei gedacht haben, außer Unterhaltung zu liefern. Wie bei Satire üblich, bewegt man sich als Satiriker wie auch als Kabarettist auf einer schmalen Linie, wenn nicht gleich auf mehreren. Zwischen Klamauk und Humor, Sinn und Unsinn, zwischen Gesellschaftskritik und Besserwisserei. Was das Buch zu einem wechselhaften Genuss macht. Und doch, manche Fehlentwicklungen sind nicht zu leugnen.
Die bestellten Bücher sind noch nicht in der Buchhandlung angekommen, also zur Überbrückung ein E-Book. Offen gestanden, kannte ich die beiden Autoren bisher gar nicht, was wohl an meinem homöopathischen Fernsehkonsum liegt. Inzwischen weiß ich, dass sie im Hauptberuf Kabarettistin sowie Journalist und Kabarettist sind, was mir im Nachhinein das Buch erklärt. Es ist also mehr Satire als Sachbuch. Nun darf Satire landläufig so ziemlich alles, also auch über ZeitgenossInnen herziehen, Geschichten überinterpretieren und Fakten zur Unterhaltung ein wenig verdrehen. Die Ziele sind nun jedoch mal nicht vorrangig Prominente oder Politiker, sondern die Menschen und Ereignisse unseres Alltags. Die merkwürdigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen, Raucher, Autofahrer, Fleischesser, Jutta Ditfurth und Muslime, und weitere Entwicklungen der Neuzeit wie Influencer. Über all diese wird nun ein gewisser Hohn und Spott ausgekübelt. So stellte sich mir die Frage, was der Sinn darin sein könnte, was sich Gruber und Hock wohl dabei gedacht haben, außer Unterhaltung zu liefern. Wie bei Satire üblich, bewegt man sich als Satiriker wie auch als Kabarettist auf einer schmalen Linie, wenn nicht gleich auf mehreren. Zwischen Klamauk und Humor, Sinn und Unsinn, zwischen Gesellschaftskritik und Besserwisserei. Was das Buch zu einem wechselhaften Genuss macht. Und doch, manche Fehlentwicklungen sind nicht zu leugnen.
 Was macht es mit einem, wenn man als liberaler Journalist seine gewohnten Medien, wie «Spiegel», «Süddeutsche Zeitung» und «Die Zeit», ignoriert und sich nur noch aus alternativen Medien informiert? Diesem Experiment unterzog sich Hans Demmel, indem er für sechs Monate nur bei KenFM, Compact oder Politically Incorrect las. Dazu sich in YouTube und Twitter in die Richtung der Querdenker und Corona-Leugner bewegte. Seine Frage war, ob diese geballte Portion an Desinformation, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien seine Denkweise tatsächlich beeinflussen würde. Das Schlimmste befürchtend, holte er sich den Kollegen Friedrich Küppersbusch zur Seite, der gelegentlich über Demmel wachte. Ob da nicht etwas aus dem Ruder lief. Das Ergebnis ist eine Art Tagebuch, das Demmel über die Zeit geführt hat, was er wo gelesen hatte, wie ihn diese »Anderswelt«, wie auch das Buch heißt, beeinflusste. Das erwartbare Ende sei vorweg genommen. Es hat ihn nicht umgewandelt, hat ihn nicht von seinen liberalen, demokratischen Einstellungen abgebracht. Doch es hat trotzdem ein wichtiges Resultat gezeigt. Die Methoden, wie die alternativen Medien der Neurechten arbeiten, welche Methoden und Tricks sie anwenden. Und wie diese Leute zu denken und zu interpretieren pflegen.
Was macht es mit einem, wenn man als liberaler Journalist seine gewohnten Medien, wie «Spiegel», «Süddeutsche Zeitung» und «Die Zeit», ignoriert und sich nur noch aus alternativen Medien informiert? Diesem Experiment unterzog sich Hans Demmel, indem er für sechs Monate nur bei KenFM, Compact oder Politically Incorrect las. Dazu sich in YouTube und Twitter in die Richtung der Querdenker und Corona-Leugner bewegte. Seine Frage war, ob diese geballte Portion an Desinformation, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien seine Denkweise tatsächlich beeinflussen würde. Das Schlimmste befürchtend, holte er sich den Kollegen Friedrich Küppersbusch zur Seite, der gelegentlich über Demmel wachte. Ob da nicht etwas aus dem Ruder lief. Das Ergebnis ist eine Art Tagebuch, das Demmel über die Zeit geführt hat, was er wo gelesen hatte, wie ihn diese »Anderswelt«, wie auch das Buch heißt, beeinflusste. Das erwartbare Ende sei vorweg genommen. Es hat ihn nicht umgewandelt, hat ihn nicht von seinen liberalen, demokratischen Einstellungen abgebracht. Doch es hat trotzdem ein wichtiges Resultat gezeigt. Die Methoden, wie die alternativen Medien der Neurechten arbeiten, welche Methoden und Tricks sie anwenden. Und wie diese Leute zu denken und zu interpretieren pflegen.
 Da ich gerade einmal in diesem Thema bin, kann ich mir das nächste Buch gleich noch vornehmen. Nach Andreas Wirschings Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts der Fokus nun auf die Zeit von 1933 bis 1945. Wobei ich mich mittlerweile immer mehr auf Geschichte konzentriere, weil sie erstaunlich viel Verständnis für die Gegenwart schafft. Eine Parallele zu Wirschings Buch bei Herbert ist die, dass auch er im Vorwort ausdrücklich erklärt, dass sein Buch keine detaillierte Darstellung ist. Es sollen die historischen Linien und Abläufe heraus gestellt werden, wie geschichtliche und politische Fäden aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts geradezu zwangsläufig in das Dritte Reich führten. Doch das streift Herbert nur am Anfang, bevor es in die tatsächliche Zeit vor und im Zweiten Weltkrieg geht. So lässt sich das Buch in zwei wesentliche Teile gliedern. Einmal den Weg aus der Weimarer Republik in die Nazidiktatur und ihre Methoden, danach die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wobei die Kriegszeit eindeutig den größeren Umfang beansprucht. Das wieder im Taschenbuchformat, für kleines Geld bei der BPB. Nun halte ich mich selbst für sowohl interessiert in als auch gut informiert über die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Doch ich muss gestehen, dass in diesem – Verzeihung – Büchlein doch eine Menge mehr steckt als zuvor erwartet. Herbert schafft es, wirklich nur die historischen Linien heraus zu arbeiten, für ein überschauendes, doch trotzdem dichtes Bild zu sorgen.
Da ich gerade einmal in diesem Thema bin, kann ich mir das nächste Buch gleich noch vornehmen. Nach Andreas Wirschings Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts der Fokus nun auf die Zeit von 1933 bis 1945. Wobei ich mich mittlerweile immer mehr auf Geschichte konzentriere, weil sie erstaunlich viel Verständnis für die Gegenwart schafft. Eine Parallele zu Wirschings Buch bei Herbert ist die, dass auch er im Vorwort ausdrücklich erklärt, dass sein Buch keine detaillierte Darstellung ist. Es sollen die historischen Linien und Abläufe heraus gestellt werden, wie geschichtliche und politische Fäden aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts geradezu zwangsläufig in das Dritte Reich führten. Doch das streift Herbert nur am Anfang, bevor es in die tatsächliche Zeit vor und im Zweiten Weltkrieg geht. So lässt sich das Buch in zwei wesentliche Teile gliedern. Einmal den Weg aus der Weimarer Republik in die Nazidiktatur und ihre Methoden, danach die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wobei die Kriegszeit eindeutig den größeren Umfang beansprucht. Das wieder im Taschenbuchformat, für kleines Geld bei der BPB. Nun halte ich mich selbst für sowohl interessiert in als auch gut informiert über die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Doch ich muss gestehen, dass in diesem – Verzeihung – Büchlein doch eine Menge mehr steckt als zuvor erwartet. Herbert schafft es, wirklich nur die historischen Linien heraus zu arbeiten, für ein überschauendes, doch trotzdem dichtes Bild zu sorgen.
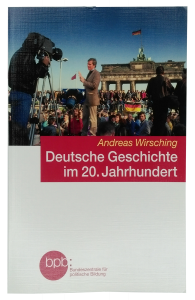 An den Umfang des Wälzers von Golo Mann, "Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts" kommt Andreas Wirschings Buch nicht einmal annähernd heran. Soll es auch nicht. Wirschings Anspruch ist es, die Grundzüge der Entwicklung Deutschlands, politisch und sozial, vom Kaiserreich über Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung Deutschlands aufzuzeigen. Es geht also nicht um alle Details, alle Daten und eine Vielzahl von Beteiligten, sondern um ein Grundverständnis des deutschen Weges in die Moderne. Sozusagen ist es vergleichende Geschichte, die den nicht ganz so langen Weg beschreibt, bis Deutschland dort ankam, wo Nationen wie Frankreich und Großbritannien mit ihrer langen Vergangenheit, ihren Traditionen und Selbstgewissheiten halt zeitlich im Vorteil sind und waren. Nicht umsonst heißt das erste Kapitel des Buches "Ein deutscher Sonderweg in das 20. Jahrhundert?", mit einem Fragezeichen am Ende. Das Buch will ein grundsätzliches Verständnis dafür wecken, wie und warum Deutschland heute so und nicht anders aufgestellt ist. Dass die Gegenwart immer eine logische Konsequenz der Vergangenheit sein muss. Selbstverständlich ist Wirsching profunder Historiker, Interpretationen oder Vermutungen haben bei ihm nichts verloren, wissenschaftliche Fakten zählen. Und sind diese nicht oder noch nicht vorhanden, schreibt es das auch so. Ja, es ist ein wissenschaftliches Buch, trotzdem gut zu lesen, gut zu verstehen. Man fragt sich am Ende nur, was Reichsbürger, Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker da geraucht haben. Denn nicht ohne Grund ist das Buch bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Wie üblich bei solchen Büchern, lesen es aber immer die Falschen.
An den Umfang des Wälzers von Golo Mann, "Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts" kommt Andreas Wirschings Buch nicht einmal annähernd heran. Soll es auch nicht. Wirschings Anspruch ist es, die Grundzüge der Entwicklung Deutschlands, politisch und sozial, vom Kaiserreich über Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung Deutschlands aufzuzeigen. Es geht also nicht um alle Details, alle Daten und eine Vielzahl von Beteiligten, sondern um ein Grundverständnis des deutschen Weges in die Moderne. Sozusagen ist es vergleichende Geschichte, die den nicht ganz so langen Weg beschreibt, bis Deutschland dort ankam, wo Nationen wie Frankreich und Großbritannien mit ihrer langen Vergangenheit, ihren Traditionen und Selbstgewissheiten halt zeitlich im Vorteil sind und waren. Nicht umsonst heißt das erste Kapitel des Buches "Ein deutscher Sonderweg in das 20. Jahrhundert?", mit einem Fragezeichen am Ende. Das Buch will ein grundsätzliches Verständnis dafür wecken, wie und warum Deutschland heute so und nicht anders aufgestellt ist. Dass die Gegenwart immer eine logische Konsequenz der Vergangenheit sein muss. Selbstverständlich ist Wirsching profunder Historiker, Interpretationen oder Vermutungen haben bei ihm nichts verloren, wissenschaftliche Fakten zählen. Und sind diese nicht oder noch nicht vorhanden, schreibt es das auch so. Ja, es ist ein wissenschaftliches Buch, trotzdem gut zu lesen, gut zu verstehen. Man fragt sich am Ende nur, was Reichsbürger, Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker da geraucht haben. Denn nicht ohne Grund ist das Buch bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Wie üblich bei solchen Büchern, lesen es aber immer die Falschen.
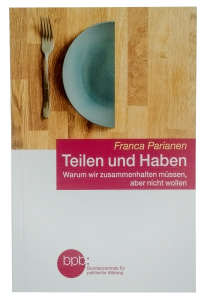 Buch ist für Franca Parianens Beitrag vielleicht nicht das richtige Wort. Büchlein trifft es eher. Dafür ist es mehr ein Essay als eine ausgesprochen breite Betrachtung. Sie widmet sich der Frage, warum das Teilen, und teilhaben lassen, in unserer westlichen Gesellschaft so ausgesprochen schwer geworden ist. Sie sieht diese Unfähigkeit als einen wichtigen Grund in der zunehmenden Ungleichheit und wirtschaftlichen Ungerechtigkeit im Verlauf des 20. Jahrhundert. Dazu geht sie zurück in die Anfänge des Homo Sapiens, der sich aufgrund einer speziellen genetischen Anlage dazu entschloss, gruppenübergreifend zu jagen, zu versorgen und zu pflegen. Und zu kommunizieren. Teilen galt jedoch nicht nur bei der Nahrung und dem Lebensraum als Vorteil, sondern besonders beim Wissen, bei Erfahrungen und handwerklichem Können. Die Fähigkeit, Wissen zu teilen, weiterzugeben und zu erweitern, war eines der Erfolgsgeheimnisse, warum sich Homo Sapiens gegenüber anderen Hominiden durchsetzen konnte. Teilen war überlebenswichtig. Bis zu der Zeit, als neoliberale Wirtschaftswissenschaftler den Homo Oeconomicus erfanden, der sich selbst immer am nächsten stand. Der nur auf seinen eigenen Gewinn und sein eigenes Fortkommen Wert legte. Doch die Wahrheit, so Parianen, ist eine andere. Der Mensch teilt aus vielen Gründen, aus Großzügigkeit, aus Mitleid oder auch aus ganz eigennützigen Gründen. Teilen heißt nicht verlieren, teilen kann den Gewinn sogar vergrößern. Mit diesem Startpunkt beschreibt Parianen eine ganz andere Gesellschaft, in der sich Preise aus dem Wert ableiten, nicht der Seltenheit oder dem Willen zu besitzen. Es ist eine Gesellschaft, in der CEOs von Aktiengesellschaften nicht das Tausendfache eines Arbeiters verdienen, in denen die Leute in den systemkritischen Aufgabenbereichen wie Handel, Sicherheit und Pflege das Geld bekommen, das sie wirklich verdienen. Ganz neu sind ihre Erkenntnisse nicht. Doch das Buch fasst noch einmal die wesentliche Argumente und historischen Hintergründe zusammen. Dazu sehr humorig und ansprechend geschrieben.
Buch ist für Franca Parianens Beitrag vielleicht nicht das richtige Wort. Büchlein trifft es eher. Dafür ist es mehr ein Essay als eine ausgesprochen breite Betrachtung. Sie widmet sich der Frage, warum das Teilen, und teilhaben lassen, in unserer westlichen Gesellschaft so ausgesprochen schwer geworden ist. Sie sieht diese Unfähigkeit als einen wichtigen Grund in der zunehmenden Ungleichheit und wirtschaftlichen Ungerechtigkeit im Verlauf des 20. Jahrhundert. Dazu geht sie zurück in die Anfänge des Homo Sapiens, der sich aufgrund einer speziellen genetischen Anlage dazu entschloss, gruppenübergreifend zu jagen, zu versorgen und zu pflegen. Und zu kommunizieren. Teilen galt jedoch nicht nur bei der Nahrung und dem Lebensraum als Vorteil, sondern besonders beim Wissen, bei Erfahrungen und handwerklichem Können. Die Fähigkeit, Wissen zu teilen, weiterzugeben und zu erweitern, war eines der Erfolgsgeheimnisse, warum sich Homo Sapiens gegenüber anderen Hominiden durchsetzen konnte. Teilen war überlebenswichtig. Bis zu der Zeit, als neoliberale Wirtschaftswissenschaftler den Homo Oeconomicus erfanden, der sich selbst immer am nächsten stand. Der nur auf seinen eigenen Gewinn und sein eigenes Fortkommen Wert legte. Doch die Wahrheit, so Parianen, ist eine andere. Der Mensch teilt aus vielen Gründen, aus Großzügigkeit, aus Mitleid oder auch aus ganz eigennützigen Gründen. Teilen heißt nicht verlieren, teilen kann den Gewinn sogar vergrößern. Mit diesem Startpunkt beschreibt Parianen eine ganz andere Gesellschaft, in der sich Preise aus dem Wert ableiten, nicht der Seltenheit oder dem Willen zu besitzen. Es ist eine Gesellschaft, in der CEOs von Aktiengesellschaften nicht das Tausendfache eines Arbeiters verdienen, in denen die Leute in den systemkritischen Aufgabenbereichen wie Handel, Sicherheit und Pflege das Geld bekommen, das sie wirklich verdienen. Ganz neu sind ihre Erkenntnisse nicht. Doch das Buch fasst noch einmal die wesentliche Argumente und historischen Hintergründe zusammen. Dazu sehr humorig und ansprechend geschrieben.
Informationen über Franca Parianen beim Rowohlt-Verlag.
 Tatsächlich erschien dieses Buch in der Rubrik "Sachbuch". Was es eigentlich nicht ist, jedenfalls nicht im Sinne einer philosophischen, sozialwissenschaftlichen oder politischen Betrachtung. Es ist eher vielleicht ein Essay, aber es ist keine Fiktion. Auf jeden Fall ist es ein sehr persönliches Buch der Journalistin Christiane Hoffmann. Hoffmann ist die Tochter eines Vertriebenen, der kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges seine schlesische Heimat, das Dorf Rosenthal, wegen der vorrückenden Russen verlassen musste. So beginnt der Trek des damals Neunjährigen, mit seiner Mutter und anderen Verwandten, in Richtung Westen. Es ist Februar 1945, nur mit wenigen Habseligkeiten auf einem von Pferden gezogenen Leiterwagen legen sie die weite Strecke zurück, durch Tschechien bis an die Grenze zu Sachsen, damals noch in den Grenzen von 1939. Er landet irgendwann in Wedel bei Hamburg, dort lässt er sich nieder, baut sich sein Leben auf. In seine Heimat sollte er nie zurückkehren können, wegen der Westverschiebung Polens. Doch das ist nur die Einleitung der Geschichte. Die Gedanken zurück, der Verlust der Heimat bleiben in den Erinnerungen des Vaters verhaftet. Prägen nicht nur sein weiteres Leben. Nach dem Krieg und nach dem Zerfall des Ostens kehrt die Familie auf Besuch zurück nach Rosenthal, Christiane, ihre Eltern und ihr Onkel Manfred. Inzwischen ist der Hof des Vaters von Polen bewohnt, auch wenn sich das Dorf selbst kaum verändert hat. Das Dorf, das jetzt Rózyna heißt. Ihr Vater stirbt in 2018 und Christiane Hoffmann fasst einen Entschluss. Sie macht sich auf den Weg, den Fluchtweg ihres Vaters nachzugehen. Und sie schreibt auf, was sie erlebt, wie es sich anfühlt und wie die Reise ihr hilft, zu verstehen.
Tatsächlich erschien dieses Buch in der Rubrik "Sachbuch". Was es eigentlich nicht ist, jedenfalls nicht im Sinne einer philosophischen, sozialwissenschaftlichen oder politischen Betrachtung. Es ist eher vielleicht ein Essay, aber es ist keine Fiktion. Auf jeden Fall ist es ein sehr persönliches Buch der Journalistin Christiane Hoffmann. Hoffmann ist die Tochter eines Vertriebenen, der kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges seine schlesische Heimat, das Dorf Rosenthal, wegen der vorrückenden Russen verlassen musste. So beginnt der Trek des damals Neunjährigen, mit seiner Mutter und anderen Verwandten, in Richtung Westen. Es ist Februar 1945, nur mit wenigen Habseligkeiten auf einem von Pferden gezogenen Leiterwagen legen sie die weite Strecke zurück, durch Tschechien bis an die Grenze zu Sachsen, damals noch in den Grenzen von 1939. Er landet irgendwann in Wedel bei Hamburg, dort lässt er sich nieder, baut sich sein Leben auf. In seine Heimat sollte er nie zurückkehren können, wegen der Westverschiebung Polens. Doch das ist nur die Einleitung der Geschichte. Die Gedanken zurück, der Verlust der Heimat bleiben in den Erinnerungen des Vaters verhaftet. Prägen nicht nur sein weiteres Leben. Nach dem Krieg und nach dem Zerfall des Ostens kehrt die Familie auf Besuch zurück nach Rosenthal, Christiane, ihre Eltern und ihr Onkel Manfred. Inzwischen ist der Hof des Vaters von Polen bewohnt, auch wenn sich das Dorf selbst kaum verändert hat. Das Dorf, das jetzt Rózyna heißt. Ihr Vater stirbt in 2018 und Christiane Hoffmann fasst einen Entschluss. Sie macht sich auf den Weg, den Fluchtweg ihres Vaters nachzugehen. Und sie schreibt auf, was sie erlebt, wie es sich anfühlt und wie die Reise ihr hilft, zu verstehen.
 Das Thema sollte doch inzwischen ausreichend durchgekaut sein. Irgendwann ist doch auch mal gut. Oder kann man dem Thema doch noch irgendwie neue Sichten, andere Aspekte beifügen? Habe ich mich vor der Leseprobe bei den Krautreportern selbst gefragt. Man könnte das Thema in der Tat abhaken, wenn es nur Vergangenheit wäre, aber noch immer sind viele der Schieflagen zwischen Ost und West nicht gerade gerückt. Noch immer sitzen in den Leitungspositionen der Unternehmen, Hochschulen und Medien fast nur westdeutsch sozialisierte Leute. Noch immer wird in Ostdeutschland weniger verdient als im Westen. Und noch immer ist von den Jammer-Ossis die Rede, wenn die Sprache auf die neuen Bundesländer kommt. Doch am schlimmsten ist, dass bei der ehemaligen DDR immer noch zuerst die Sprache auf Stasi, Trabbi, AfD und Bananenfreiheit kommt. Dabei ist Kühlungsborn anders als Wittenberg, und die Dresdener Neustadt erinnert mich eher an Kreuzberg. Stellt sich dazu die Frage, was denn »die DDR« gewesen sein soll. Die Menschen aus dem deutschen Osten gelten unverändert als rückständig, borniert und ein bisschen faul, sie hätten ja nie richtiges Arbeiten begriffen. Dass dieses Büchlein das wohl kaum ändern kann, leuchtet ein, doch Nicole Zepter möchte trotzdem aufzeigen, was da so schräg ist, warum Verständigung zwischen Düsseldorf und Leipzig noch immer ein schwieriges Unterfangen bleibt. Ich kann ihr da nur zustimmen, aus meinen eigenen Erfahrungen hier im Westen als häufiger Gast in Sachsen. Im Westen grassieren diese Meinungen und Stereotypen gerade bei den Leuten, die die Elbe noch nie in Richtung Osten überquert haben. Doch woher stammen diese Zuschreibungen?
Das Thema sollte doch inzwischen ausreichend durchgekaut sein. Irgendwann ist doch auch mal gut. Oder kann man dem Thema doch noch irgendwie neue Sichten, andere Aspekte beifügen? Habe ich mich vor der Leseprobe bei den Krautreportern selbst gefragt. Man könnte das Thema in der Tat abhaken, wenn es nur Vergangenheit wäre, aber noch immer sind viele der Schieflagen zwischen Ost und West nicht gerade gerückt. Noch immer sitzen in den Leitungspositionen der Unternehmen, Hochschulen und Medien fast nur westdeutsch sozialisierte Leute. Noch immer wird in Ostdeutschland weniger verdient als im Westen. Und noch immer ist von den Jammer-Ossis die Rede, wenn die Sprache auf die neuen Bundesländer kommt. Doch am schlimmsten ist, dass bei der ehemaligen DDR immer noch zuerst die Sprache auf Stasi, Trabbi, AfD und Bananenfreiheit kommt. Dabei ist Kühlungsborn anders als Wittenberg, und die Dresdener Neustadt erinnert mich eher an Kreuzberg. Stellt sich dazu die Frage, was denn »die DDR« gewesen sein soll. Die Menschen aus dem deutschen Osten gelten unverändert als rückständig, borniert und ein bisschen faul, sie hätten ja nie richtiges Arbeiten begriffen. Dass dieses Büchlein das wohl kaum ändern kann, leuchtet ein, doch Nicole Zepter möchte trotzdem aufzeigen, was da so schräg ist, warum Verständigung zwischen Düsseldorf und Leipzig noch immer ein schwieriges Unterfangen bleibt. Ich kann ihr da nur zustimmen, aus meinen eigenen Erfahrungen hier im Westen als häufiger Gast in Sachsen. Im Westen grassieren diese Meinungen und Stereotypen gerade bei den Leuten, die die Elbe noch nie in Richtung Osten überquert haben. Doch woher stammen diese Zuschreibungen?
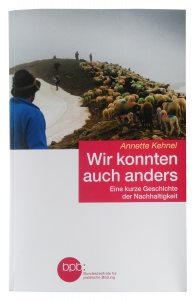 Unsere Vorstellung vom Leben im Hoch- bis Spätmittelalter, die Zeit von ca. 1000 bis 1600 n. Chr., ist eher die eines erbärmlichen, ärmlichen Lebens. Menschen, die in Dreck und Unrat hausen, in einer grausamen und ungerechten Welt, geschlagen mit Krankheiten und frühem Tod, Folter und Hexenverfolgung. Leider von der Realität weit entfernt. Das liegt zum großen Teil daran, dass sich Historiker eher mit Kriegen, dem Adel oder großen politischen Ereignissen beschäftigten als mit dem profanen Alltagsleben in dieser Zeit. Mit dem Studium alter Aufzeichnungen wie Gerichtsakten und Büchern früher Volksbanken, wie die Monti Pieta in Italien, ließen sich keine großen Lorbeeren verdienen. Das hat sich in jüngster Zeit zum Glück geändert. Was erstaunliche Erkenntnisse zu Tage förderte. Es war eben kein finsteres Mittelalter, es gab Menschen, die in Armut lebten, hungerten und im Winter beinahe erfroren. Das war aber eher eine Ausnahme, nicht die Regel, viele Menschen im Mittelalter waren gesund, gut ernährt und lebten relativ komfortabel. Dabei wäre die Art und Weise, wie in der Zeit des Mittelalters gewirtschaftet wurde, wie frühe Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt funktionierten, in unseren krisengeschüttelten Zeiten wieder mehr Aufmerksamkeit würdig. In ihrem Buch "Wir konnten auch anders" nimmt Annette Kehnel den Leser mit zurück ins Mittelalter, in die Vormoderne. Zeigt, dass wir gerade heute wieder von dieser Zeit lernen könnten, neue Wege zu finden, zu wirklicher Nachhaltigkeit zu kommen. Niemandem soll das Smartphone weggenommen werden, oder mit der Pferdekutsche zum Einkaufen fahren. Die Message sind Denk- und Handlungsweisen, die uns mit der ach so tollen Moderne verloren gegangen sind. Die Altvorderen haben anders gedacht. Und gehandelt.
Unsere Vorstellung vom Leben im Hoch- bis Spätmittelalter, die Zeit von ca. 1000 bis 1600 n. Chr., ist eher die eines erbärmlichen, ärmlichen Lebens. Menschen, die in Dreck und Unrat hausen, in einer grausamen und ungerechten Welt, geschlagen mit Krankheiten und frühem Tod, Folter und Hexenverfolgung. Leider von der Realität weit entfernt. Das liegt zum großen Teil daran, dass sich Historiker eher mit Kriegen, dem Adel oder großen politischen Ereignissen beschäftigten als mit dem profanen Alltagsleben in dieser Zeit. Mit dem Studium alter Aufzeichnungen wie Gerichtsakten und Büchern früher Volksbanken, wie die Monti Pieta in Italien, ließen sich keine großen Lorbeeren verdienen. Das hat sich in jüngster Zeit zum Glück geändert. Was erstaunliche Erkenntnisse zu Tage förderte. Es war eben kein finsteres Mittelalter, es gab Menschen, die in Armut lebten, hungerten und im Winter beinahe erfroren. Das war aber eher eine Ausnahme, nicht die Regel, viele Menschen im Mittelalter waren gesund, gut ernährt und lebten relativ komfortabel. Dabei wäre die Art und Weise, wie in der Zeit des Mittelalters gewirtschaftet wurde, wie frühe Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt funktionierten, in unseren krisengeschüttelten Zeiten wieder mehr Aufmerksamkeit würdig. In ihrem Buch "Wir konnten auch anders" nimmt Annette Kehnel den Leser mit zurück ins Mittelalter, in die Vormoderne. Zeigt, dass wir gerade heute wieder von dieser Zeit lernen könnten, neue Wege zu finden, zu wirklicher Nachhaltigkeit zu kommen. Niemandem soll das Smartphone weggenommen werden, oder mit der Pferdekutsche zum Einkaufen fahren. Die Message sind Denk- und Handlungsweisen, die uns mit der ach so tollen Moderne verloren gegangen sind. Die Altvorderen haben anders gedacht. Und gehandelt.
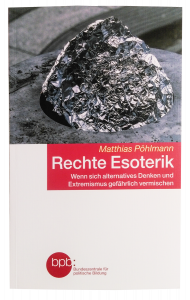 Wenn man über dieses Buch schreiben will, muss man das bereits öfter eingebrachte Bild wiederholen: Corona-Leugner, Verschwörungsgläubige, Rechtsextremisten bis hin zu Reichsbürgern im Gleichschritt in Berlin, Leipzig oder Konstanz. Matthias Pöhlmanns Buch "Rechte Esoterik" ist nicht das erste, das sich ausführlich mit diesem Bild beschäftigt und fragt, wie so unterschiedliche Interessenslagen da zusammen marschieren können. Das hatte schon Sven Reichardt getan, wenn auch mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Doch kommt Pöhlmann nicht zu anderen Schlüssen oder Interpretationen als die Sozialwissenschaftler aus Konstanz. Es scheint Pöhlmann auch nicht um eine letztendliche Erklärung zu gehen, noch zu möglichen Gegenmaßnahmen. Pöhlmann ist zuerst einmal Theologe, ihm liegt mehr an einer Haltung und Positionierung, was im letzten Kapitel des Buches zum Ausdruck kommt. Der Weg dahin ist etwas steinig, kann man aber so machen. Es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er so den historischen Wurzeln sowohl der Esoterik als auch des Rechtsextremismus nach geht.
Wenn man über dieses Buch schreiben will, muss man das bereits öfter eingebrachte Bild wiederholen: Corona-Leugner, Verschwörungsgläubige, Rechtsextremisten bis hin zu Reichsbürgern im Gleichschritt in Berlin, Leipzig oder Konstanz. Matthias Pöhlmanns Buch "Rechte Esoterik" ist nicht das erste, das sich ausführlich mit diesem Bild beschäftigt und fragt, wie so unterschiedliche Interessenslagen da zusammen marschieren können. Das hatte schon Sven Reichardt getan, wenn auch mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Doch kommt Pöhlmann nicht zu anderen Schlüssen oder Interpretationen als die Sozialwissenschaftler aus Konstanz. Es scheint Pöhlmann auch nicht um eine letztendliche Erklärung zu gehen, noch zu möglichen Gegenmaßnahmen. Pöhlmann ist zuerst einmal Theologe, ihm liegt mehr an einer Haltung und Positionierung, was im letzten Kapitel des Buches zum Ausdruck kommt. Der Weg dahin ist etwas steinig, kann man aber so machen. Es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er so den historischen Wurzeln sowohl der Esoterik als auch des Rechtsextremismus nach geht.
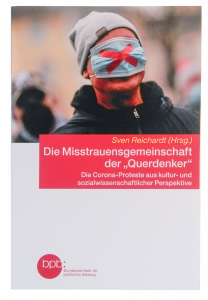 Ich habe eine Zeit lang darüber nachdenken müssen, ob ich zu diesem Buch etwas schreibe. Nicht weil es kein gutes Buch wäre, sondern weil ein Buch mit der Erwartungshaltung übereinstimmen sollte. Schon die Angabe, dass Sven Reichard Herausgeber, nicht Autor des Buches ist, weist darauf hin, dass es eine Sammlung von Artikeln ist. Genauer ist das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen, die sich auf die Querdenker-Demos am 3. und 4. Oktober 2020 am Bodensee und eben in Konstanz beziehen. Beobachtet, anhand von standardisierten Umfragen analysiert und in tiefen Details interpretiert von der Universität Konstanz. So ist das Buch ein Resultat der Zusammenarbeit von Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen der Hochschule. Wenn aber unter solchen Vorbedingungen eine Schrift entsteht, muss man sich darüber klar sein, dass es sehr tief hinein geht, je weiter man im Buch vorstößt. Und so ist es auch, je später die Beiträge, desto feingliedriger werden die Themen. Es beginnt mit den offensichtlichen Wissensparallelwelten der Querdenker, geht weiter über die Konturen einer heterogenen Misstrauensgesellschaft, leistet einen Vergleich der Spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts und der Covid 19-Pandemie in Sachsen bis hin zum Umgang der Protestieren in Habitus und Kommunikation. Wie und mit welchen Methoden digitale Fähigkeiten genutzt werden. Dass die Parolen und Protestformen der Querdenker überwiegend eher Parodien der Realität sind, wird ebenso ausgiebig behandelt. Bliebe am Ende die Frage, ob das Buch überhaupt für Durchschnittsleser interessant ist. Wenn auch mit gewissen Einschränkungen: eindeutig ja.
Ich habe eine Zeit lang darüber nachdenken müssen, ob ich zu diesem Buch etwas schreibe. Nicht weil es kein gutes Buch wäre, sondern weil ein Buch mit der Erwartungshaltung übereinstimmen sollte. Schon die Angabe, dass Sven Reichard Herausgeber, nicht Autor des Buches ist, weist darauf hin, dass es eine Sammlung von Artikeln ist. Genauer ist das Buch eine Zusammenfassung von Beiträgen, die sich auf die Querdenker-Demos am 3. und 4. Oktober 2020 am Bodensee und eben in Konstanz beziehen. Beobachtet, anhand von standardisierten Umfragen analysiert und in tiefen Details interpretiert von der Universität Konstanz. So ist das Buch ein Resultat der Zusammenarbeit von Kultur- und SozialwissenschaftlerInnen der Hochschule. Wenn aber unter solchen Vorbedingungen eine Schrift entsteht, muss man sich darüber klar sein, dass es sehr tief hinein geht, je weiter man im Buch vorstößt. Und so ist es auch, je später die Beiträge, desto feingliedriger werden die Themen. Es beginnt mit den offensichtlichen Wissensparallelwelten der Querdenker, geht weiter über die Konturen einer heterogenen Misstrauensgesellschaft, leistet einen Vergleich der Spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts und der Covid 19-Pandemie in Sachsen bis hin zum Umgang der Protestieren in Habitus und Kommunikation. Wie und mit welchen Methoden digitale Fähigkeiten genutzt werden. Dass die Parolen und Protestformen der Querdenker überwiegend eher Parodien der Realität sind, wird ebenso ausgiebig behandelt. Bliebe am Ende die Frage, ob das Buch überhaupt für Durchschnittsleser interessant ist. Wenn auch mit gewissen Einschränkungen: eindeutig ja.
 Ab Sonntag, dem 13. August 1961, machte die DDR gegenüber dem Westen dicht. Zuerst waren es Rollen aus Stacheldraht und sowjetische Panzer an den wichtigen ehemaligen Schnittstellen zwischen Ost und West. Wie am Brandenburger Tor. Über die Jahre wurden daraus eine Betonmauer mit Todesstreifen und Selbstschussanlagen. Daraufhin kam es zu Demonstrationszügen, Protesten und Kundgebungen. In West-Berlin und in der Bundesrepublik. In der DDR dagegen war es ruhig, kein Aufstand und keine wirkliche Regung, höchstens Ungläubigkeit und Betroffenheit. Die wenigen Versuche von Versammlungen wurden sofort aufgelöst. Also ganz anders als am 17. Juni 1953, oder nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Nachdenklich wurde der Autor, als ein wohl ehemaliger Bürger der früheren DDR bei der Besichtigung der früheren Grenze an der Berliner Bernauer Straße die Frage eines Schülers mit dem Satz "Die Mauer war doch richtig!" beantwortete. Nämlich als der Schüler fragte, warum sich die Menschen in der DDR 1961 nicht gewehrt haben. Zuerst kann man alle denkbaren Gründe dafür finden, dass aus der Bevölkerung der DDR praktisch kein Widerstand kam. Angst vor Konsequenzen durch die DDR-Staatsmacht, Angst von Jobverlust oder sogar Gefängnis, oder Resignation. Oder Zustimmung. Robert Rauh geht in diesem Buch der Geschichte nach, warum die Bevölkerung der DDR damals stumm blieb, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Erscheint dieses Thema zuerst als sehr fokussiert, bietet dann der Verlauf der Betrachtung viele Einblicke in den realsozialistischen Staat der sowjetischen Zone, in das Leben, aber auch in Denkweisen und Überzeugungen seiner Bewohner. Ein weiterer Puzzlestein der rätselhaften Welt, die Wessis noch immer zu ergründen versuchen.
Ab Sonntag, dem 13. August 1961, machte die DDR gegenüber dem Westen dicht. Zuerst waren es Rollen aus Stacheldraht und sowjetische Panzer an den wichtigen ehemaligen Schnittstellen zwischen Ost und West. Wie am Brandenburger Tor. Über die Jahre wurden daraus eine Betonmauer mit Todesstreifen und Selbstschussanlagen. Daraufhin kam es zu Demonstrationszügen, Protesten und Kundgebungen. In West-Berlin und in der Bundesrepublik. In der DDR dagegen war es ruhig, kein Aufstand und keine wirkliche Regung, höchstens Ungläubigkeit und Betroffenheit. Die wenigen Versuche von Versammlungen wurden sofort aufgelöst. Also ganz anders als am 17. Juni 1953, oder nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Nachdenklich wurde der Autor, als ein wohl ehemaliger Bürger der früheren DDR bei der Besichtigung der früheren Grenze an der Berliner Bernauer Straße die Frage eines Schülers mit dem Satz "Die Mauer war doch richtig!" beantwortete. Nämlich als der Schüler fragte, warum sich die Menschen in der DDR 1961 nicht gewehrt haben. Zuerst kann man alle denkbaren Gründe dafür finden, dass aus der Bevölkerung der DDR praktisch kein Widerstand kam. Angst vor Konsequenzen durch die DDR-Staatsmacht, Angst von Jobverlust oder sogar Gefängnis, oder Resignation. Oder Zustimmung. Robert Rauh geht in diesem Buch der Geschichte nach, warum die Bevölkerung der DDR damals stumm blieb, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Erscheint dieses Thema zuerst als sehr fokussiert, bietet dann der Verlauf der Betrachtung viele Einblicke in den realsozialistischen Staat der sowjetischen Zone, in das Leben, aber auch in Denkweisen und Überzeugungen seiner Bewohner. Ein weiterer Puzzlestein der rätselhaften Welt, die Wessis noch immer zu ergründen versuchen.
 Wenn wir uns aus unserer heutigen Vorstellung das Leben der Jäger und Sammler vorstellen, wie der Mensch vor 20.000 oder 25.000 Jahre ausschließlich gelebt hat, kommen uns Bilder eines mühsamen Lebens in den Sinn. Die Wahrheit ist eine andere. Im Vergleich zu uns Boomern des 21. Jahrhunderts brauchte Homo Sapiens vor der Sesshaftwerdung, dem Übergang zur bäuerlichen Lebensweise, nur wenige Stunden am Tag, um satt zu werden. Wobei, hätte man ihn fragen können, er das Jagen und Sammeln kaum als Arbeit im heutigen Sinne bezeichnet hätte. Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Es war einfach Leben. So kommt die Frage auf, wann der Mensch zum Arbeiten kam, also Arbeiten im heutigen Sinne. Das war tatsächlich erst mit dem Übergang zu Landwirtschaft und Viehzucht der Fall. Was aber nicht die einzige Auswirkung war. Das Anbauen von Lebensmitteln und Züchten von Tieren erforderte Vorausschau, Planung, dazu den Aufschub von Gewinnen. Während der Jäger sein Gnu gleich auf den Grill werfen konnte, musste der Bauer lange sähen, rupfen und ernten, bevor die Speisekammer gefüllt war. So begann die Geschichte der Arbeit. Wo stehen wir heute? Obwohl John Maynard Keynes schon um die 1930 herum prophezeite, dass die Menschen im 21. Jahrhundert höchstens noch einige Stunden am Tag arbeiten müssten, weil neue Technologien und Industrien Bäuche und Kühlschränke in einer überbordenden Art und Weise füllten. Er lag weit daneben. Noch immer ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche die Regel. Im Gegenteil, in asiatischen Ländern wie Japan gibt es Begriffe wie den Tod durch Überarbeitung. Aber warum ist das so, dass die Arbeit eher immer mehr wird, es sei denn, Menschen werden durch Roboter und KI ersetzt? Das sind die Fragen, denen James Suzman in diesem Buch nachgeht. Entwicklungsgeschichtlich, ökonomisch, ökologisch und politisch.
Wenn wir uns aus unserer heutigen Vorstellung das Leben der Jäger und Sammler vorstellen, wie der Mensch vor 20.000 oder 25.000 Jahre ausschließlich gelebt hat, kommen uns Bilder eines mühsamen Lebens in den Sinn. Die Wahrheit ist eine andere. Im Vergleich zu uns Boomern des 21. Jahrhunderts brauchte Homo Sapiens vor der Sesshaftwerdung, dem Übergang zur bäuerlichen Lebensweise, nur wenige Stunden am Tag, um satt zu werden. Wobei, hätte man ihn fragen können, er das Jagen und Sammeln kaum als Arbeit im heutigen Sinne bezeichnet hätte. Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Es war einfach Leben. So kommt die Frage auf, wann der Mensch zum Arbeiten kam, also Arbeiten im heutigen Sinne. Das war tatsächlich erst mit dem Übergang zu Landwirtschaft und Viehzucht der Fall. Was aber nicht die einzige Auswirkung war. Das Anbauen von Lebensmitteln und Züchten von Tieren erforderte Vorausschau, Planung, dazu den Aufschub von Gewinnen. Während der Jäger sein Gnu gleich auf den Grill werfen konnte, musste der Bauer lange sähen, rupfen und ernten, bevor die Speisekammer gefüllt war. So begann die Geschichte der Arbeit. Wo stehen wir heute? Obwohl John Maynard Keynes schon um die 1930 herum prophezeite, dass die Menschen im 21. Jahrhundert höchstens noch einige Stunden am Tag arbeiten müssten, weil neue Technologien und Industrien Bäuche und Kühlschränke in einer überbordenden Art und Weise füllten. Er lag weit daneben. Noch immer ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche die Regel. Im Gegenteil, in asiatischen Ländern wie Japan gibt es Begriffe wie den Tod durch Überarbeitung. Aber warum ist das so, dass die Arbeit eher immer mehr wird, es sei denn, Menschen werden durch Roboter und KI ersetzt? Das sind die Fragen, denen James Suzman in diesem Buch nachgeht. Entwicklungsgeschichtlich, ökonomisch, ökologisch und politisch.
 Ein Buch wie ein Film. Was nicht wundert, ist Stephan Lamby doch sowohl Journalist als auch Dokumentarfilmer. Ein wenig erinnerte mich das Buch an Robin Alexanders »Machtverfall«, die Beschreibung des Endes der Ära Merkel. Und doch ist Lambys Buch anders. Auch er widmet sich einer historischen Phase, nämlich der Zeit von ca. 2021 bis zum endgültigen Machtwechsel, der neuen Republik unter Rot-Grün-Gelb. Aber Lamby beschränkt sich nicht auf diesen überschaubaren Zeitabschnitt. Er geht in Rückblenden bis zurück in die Zeit Willy Brandts und Franz-Josef Strauß', vergleicht damalige und heutige Konstellationen, wie man politisch und persönlich als Politiker miteinander umgegangen ist. Der Hauptinhalt des Buches ist also die Serie von Entscheidungen, Aktivitäten und Fehlschlägen der hauptsächlichen Protagonisten. Laschet, Baerbock, Schulz, Scholz, Söder, Merz, Merkel. Und auch Ziemiak, Klingbeil, Kühnert, AKK. Dass mich das Buch so stark an einen Film erinnert hat, liegt an den spontanen Rückblenden in ähnliche oder verwandte Geschehnisse, vorherige Wahlen, frühere Wahlkämpfe. Schon im nächsten Satz steht man wieder in 2021 oder 2022. War gerade noch Olaf Scholz im Fokus, dreht sich der nächste Abschnitt um Robert Habeck. Mit solchen Aktionen kann man den Leser vollends verwirren. Aber da ist Stephan Lamby zu erfahren, zu sehr Profi. Im Gegenteil, er baut aus Versatzstücken und kleinen Details eine spannende Story auf. Sehr zum Vergnügen des Lesers.
Ein Buch wie ein Film. Was nicht wundert, ist Stephan Lamby doch sowohl Journalist als auch Dokumentarfilmer. Ein wenig erinnerte mich das Buch an Robin Alexanders »Machtverfall«, die Beschreibung des Endes der Ära Merkel. Und doch ist Lambys Buch anders. Auch er widmet sich einer historischen Phase, nämlich der Zeit von ca. 2021 bis zum endgültigen Machtwechsel, der neuen Republik unter Rot-Grün-Gelb. Aber Lamby beschränkt sich nicht auf diesen überschaubaren Zeitabschnitt. Er geht in Rückblenden bis zurück in die Zeit Willy Brandts und Franz-Josef Strauß', vergleicht damalige und heutige Konstellationen, wie man politisch und persönlich als Politiker miteinander umgegangen ist. Der Hauptinhalt des Buches ist also die Serie von Entscheidungen, Aktivitäten und Fehlschlägen der hauptsächlichen Protagonisten. Laschet, Baerbock, Schulz, Scholz, Söder, Merz, Merkel. Und auch Ziemiak, Klingbeil, Kühnert, AKK. Dass mich das Buch so stark an einen Film erinnert hat, liegt an den spontanen Rückblenden in ähnliche oder verwandte Geschehnisse, vorherige Wahlen, frühere Wahlkämpfe. Schon im nächsten Satz steht man wieder in 2021 oder 2022. War gerade noch Olaf Scholz im Fokus, dreht sich der nächste Abschnitt um Robert Habeck. Mit solchen Aktionen kann man den Leser vollends verwirren. Aber da ist Stephan Lamby zu erfahren, zu sehr Profi. Im Gegenteil, er baut aus Versatzstücken und kleinen Details eine spannende Story auf. Sehr zum Vergnügen des Lesers.
Der Film zum Buch:
