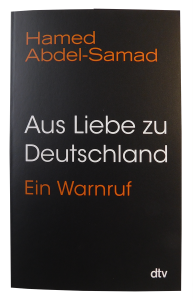 Es hat etwas nachgelassen, doch vom Tisch ist das Thema immer noch nicht wirklich. Was soll das sein, was aus politisch rechten bis rechtsextremen Zirkeln immer wieder als deutsche Identität beschworen wird. Auf welch tönernen Füßen das Gewäsch steht, wird schon beim Einwand klar, ob man über Ostfriesen oder Oberbayern, über Sachsen oder Saarländer redet. Was ist mit dem Schreiber dieser Zeilen, der dort drüben seit seiner Jugend nach wenigen Wochen Aufenthalt seine deutsche gegen eine irgendwie englische Identität tauscht, Englisch spricht, englische Nationalgerichte liebt, nie auf der falschen Straßenseite fährt, im Supermarkt keinem im Wege steht und auf jedem Parkplatz Smalltalk pflegt? Noch ausgeprägter sind diese Fragen für Hamed Abdel-Samad, der sich ursprünglich als Araber, Ägypter oder Palästinenser fühlte, je nach aktuellem Standort. Dann über Zwischenstationen nach Deutschland kam und hier blieb. Doch noch immer beschäftigt ihn die Frage, was seine Identität ist. Weder kann er seine arabische Identität leugnen, noch inzwischen seinen inneren Anteil als Deutscher. Will er auch nicht. Abdel-Samad zeigt an seinem eigenen Beispiel sehr deutlich, dass Identität ein Konstrukt ist. Das ist der eine Teil des Buches. Der andere ist seine Sicht auf dieses Deutschland, was es prägt, geschichtlich, gesellschaftlich wie politisch. Dieses Deutschland, das es erst seit 1871 gibt, das noch immer trotz der Geschehen in 1990 keine gewachsene Nation ist wie Großbritannien oder Frankreich. Trotz des dummen Geredes von Alexander Gauland über tausendjährige Geschichte und Vogelschiss. Es gäbe keinen Anlass für Zweifel, so Abdel-Samad, dass dieses Deutschland der beste Staat sei, der je auf diesem Boden existiert hat. Es ist für ihn unverständlich, warum eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen hier mit diesem Staat hadert, ja einige wenige ihn sogar beseitigen möchten. Vielleicht braucht es gerade den unverblümten Blick eines „Zugewanderten“, um wieder ein klares Bild dieser Nation zu bekommen.
Es hat etwas nachgelassen, doch vom Tisch ist das Thema immer noch nicht wirklich. Was soll das sein, was aus politisch rechten bis rechtsextremen Zirkeln immer wieder als deutsche Identität beschworen wird. Auf welch tönernen Füßen das Gewäsch steht, wird schon beim Einwand klar, ob man über Ostfriesen oder Oberbayern, über Sachsen oder Saarländer redet. Was ist mit dem Schreiber dieser Zeilen, der dort drüben seit seiner Jugend nach wenigen Wochen Aufenthalt seine deutsche gegen eine irgendwie englische Identität tauscht, Englisch spricht, englische Nationalgerichte liebt, nie auf der falschen Straßenseite fährt, im Supermarkt keinem im Wege steht und auf jedem Parkplatz Smalltalk pflegt? Noch ausgeprägter sind diese Fragen für Hamed Abdel-Samad, der sich ursprünglich als Araber, Ägypter oder Palästinenser fühlte, je nach aktuellem Standort. Dann über Zwischenstationen nach Deutschland kam und hier blieb. Doch noch immer beschäftigt ihn die Frage, was seine Identität ist. Weder kann er seine arabische Identität leugnen, noch inzwischen seinen inneren Anteil als Deutscher. Will er auch nicht. Abdel-Samad zeigt an seinem eigenen Beispiel sehr deutlich, dass Identität ein Konstrukt ist. Das ist der eine Teil des Buches. Der andere ist seine Sicht auf dieses Deutschland, was es prägt, geschichtlich, gesellschaftlich wie politisch. Dieses Deutschland, das es erst seit 1871 gibt, das noch immer trotz der Geschehen in 1990 keine gewachsene Nation ist wie Großbritannien oder Frankreich. Trotz des dummen Geredes von Alexander Gauland über tausendjährige Geschichte und Vogelschiss. Es gäbe keinen Anlass für Zweifel, so Abdel-Samad, dass dieses Deutschland der beste Staat sei, der je auf diesem Boden existiert hat. Es ist für ihn unverständlich, warum eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen hier mit diesem Staat hadert, ja einige wenige ihn sogar beseitigen möchten. Vielleicht braucht es gerade den unverblümten Blick eines „Zugewanderten“, um wieder ein klares Bild dieser Nation zu bekommen.
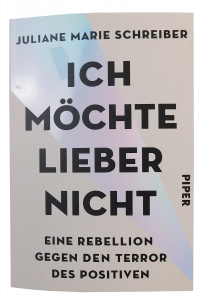 Der Satz, der den Titel des Buches bildet, wird dem Einen oder der Anderen bekannt vorkommen. Er stammt aus der Erzählung von Herman Melville, Bartleby der Schreiber, der seinen Chef mit dieser Antwort – im englischen Original “I would prefer not to” – auf Anweisungen in den Wahnsinn treibt. Doch um Bartleby geht im Grunde nicht, oder wieder doch. Genauer geht es darum, diese Antwort zu geben, wenn wir von der Glücksindustrie mal wieder angehalten werden, alles positiv zu sehen. Das Glück in Badesalz, parfümiertem Kräutertee oder der neusten Spielekonsole zu finden. Oder noch den letzten Reinfall als Chance zu sehen, statt als Versagen oder Pech. Auch passt diese Antwort fast immer auf den glänzenden Hinweis, jeder könne alles erreichen, wenn er es nur ganz fest will. Gerade neoliberale Zeitgenossen, oder auch Genossinnen, lieben diese Plattitüde bis zur Schmerzgrenze. Juliane Marie Schreiber schlägt vor, sich diesem Terror des Positiven möglichst zu entziehen. Als wenn Glück, oder das, was uns als solches verkauft wird, unserem Leben irgendeinen Sinn gibt. Es war der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman, der sich mit dem Konzept der positiven Psychologie die Taschen reichlich füllte, durch die US-Regierung und das Militär, als er behauptete, dass er mit seinen psychologisch positiv orientierten Verfahren sogar Kriegstraumata heilen könne und Soldaten motivieren, begeistert in den Krieg zu ziehen. Aufgegriffen hat das auch schon früh die Industrie, als sie suggerierte, sich mit diesem Waschmittel oder dieser Zigarettenmarke Glück kaufen zu können. Als wäre Glück wirklich eine Bereicherung oder ein Lebensziel. Mein erster Gedanke dazu waren die blöden Sprüche an Depressive, sie sollten doch nicht alles so schwarz sehen und positiv in die Zukunft blicken. Schreiber ruft zum Widerstand auf gegen diese Ideologie unserer Zeit, Scheitern als Chance zu sehen und ständig an unserer Optimierung zu arbeiten. Dagegen hilft nur Rebellion, meint sie. Die Welt sei nicht von den Glücklichen verändert worden, sondern von den Unzufriedenen.
Der Satz, der den Titel des Buches bildet, wird dem Einen oder der Anderen bekannt vorkommen. Er stammt aus der Erzählung von Herman Melville, Bartleby der Schreiber, der seinen Chef mit dieser Antwort – im englischen Original “I would prefer not to” – auf Anweisungen in den Wahnsinn treibt. Doch um Bartleby geht im Grunde nicht, oder wieder doch. Genauer geht es darum, diese Antwort zu geben, wenn wir von der Glücksindustrie mal wieder angehalten werden, alles positiv zu sehen. Das Glück in Badesalz, parfümiertem Kräutertee oder der neusten Spielekonsole zu finden. Oder noch den letzten Reinfall als Chance zu sehen, statt als Versagen oder Pech. Auch passt diese Antwort fast immer auf den glänzenden Hinweis, jeder könne alles erreichen, wenn er es nur ganz fest will. Gerade neoliberale Zeitgenossen, oder auch Genossinnen, lieben diese Plattitüde bis zur Schmerzgrenze. Juliane Marie Schreiber schlägt vor, sich diesem Terror des Positiven möglichst zu entziehen. Als wenn Glück, oder das, was uns als solches verkauft wird, unserem Leben irgendeinen Sinn gibt. Es war der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman, der sich mit dem Konzept der positiven Psychologie die Taschen reichlich füllte, durch die US-Regierung und das Militär, als er behauptete, dass er mit seinen psychologisch positiv orientierten Verfahren sogar Kriegstraumata heilen könne und Soldaten motivieren, begeistert in den Krieg zu ziehen. Aufgegriffen hat das auch schon früh die Industrie, als sie suggerierte, sich mit diesem Waschmittel oder dieser Zigarettenmarke Glück kaufen zu können. Als wäre Glück wirklich eine Bereicherung oder ein Lebensziel. Mein erster Gedanke dazu waren die blöden Sprüche an Depressive, sie sollten doch nicht alles so schwarz sehen und positiv in die Zukunft blicken. Schreiber ruft zum Widerstand auf gegen diese Ideologie unserer Zeit, Scheitern als Chance zu sehen und ständig an unserer Optimierung zu arbeiten. Dagegen hilft nur Rebellion, meint sie. Die Welt sei nicht von den Glücklichen verändert worden, sondern von den Unzufriedenen.
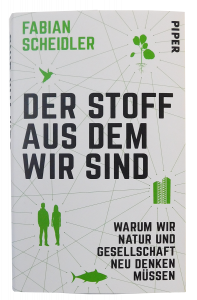 Schon im Altertum fragten sich die Philosophen, woraus die Stoffe und letztlich wir selbst bestehen. Die Antworten waren damals recht unbefriedigend. Konkreter wurde es vor ca. 400 Jahren, als sich die Naturwissenschaften nach unserem heutigen Verständnis entwickelten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Theorien, dass Materie aus ganz kleinen Teilen besteht, den Atomen. Damit begann ein Welterklärungsprogramm, wurde eine mechanistische Sicht der Welt geschaffen, in der alle Vorgänge durch mechanische Wirkungen erklärt wurden. Nicht zufällig war das in der Zeit, als auch das entstand, was wir heute neokapitalistische Wirtschaft nennen. Gerade die Physik sollte sich als die große Erkenntnismaschine entpuppen, aus der Wissenschaften, Forschung und Wirtschaft ihre Vorteile zogen. Zweifel an dieser Sicht der Welt gab es früh, besonders, aber nicht nur aus der Philosophie. Ob das ganze Universum nicht viel komplexer sei als ein paar winzige Kügelchen, die umeinander kreisen, in der alle Zusammenhänge aus Regeln besteht, die dem Wenn-Dann-Immer-Prinzip folgen. Eine erste Macke bekam diese Sicht auf die Welt und die Natur durch die Theorien von Albert Einstein, dass Zeit nichts Unveränderliches ist, wodurch die Schwerkraft entsteht, die Äquivalenz von Energie und Masse. Ganz übel wurde es dann mit der Quantenphysik, die letztlich das Atommodell, das heute noch an allen Schulen gelehrt wird, völlig in Frage stellt. Die Vorstellung, dass Materie aus Feldern, ihrer Wechselwirkung und ihren Beziehungen entsteht, ist fast allen Menschen noch heute fremd. Wenn wir aber längst wissen, dass die mechanistische Erklärung der Welt, und des Lebens, ganz anders ist als gedacht, warum hängen wir dann immer noch an diesem Bild? Die Antwort liegt nicht zuletzt darin, dass es für die Politik und die Wirtschaft von großem Vorteil ist. Deshalb möchte Fabian Scheidler mit diesem Naturbild aufräumen.
Schon im Altertum fragten sich die Philosophen, woraus die Stoffe und letztlich wir selbst bestehen. Die Antworten waren damals recht unbefriedigend. Konkreter wurde es vor ca. 400 Jahren, als sich die Naturwissenschaften nach unserem heutigen Verständnis entwickelten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Theorien, dass Materie aus ganz kleinen Teilen besteht, den Atomen. Damit begann ein Welterklärungsprogramm, wurde eine mechanistische Sicht der Welt geschaffen, in der alle Vorgänge durch mechanische Wirkungen erklärt wurden. Nicht zufällig war das in der Zeit, als auch das entstand, was wir heute neokapitalistische Wirtschaft nennen. Gerade die Physik sollte sich als die große Erkenntnismaschine entpuppen, aus der Wissenschaften, Forschung und Wirtschaft ihre Vorteile zogen. Zweifel an dieser Sicht der Welt gab es früh, besonders, aber nicht nur aus der Philosophie. Ob das ganze Universum nicht viel komplexer sei als ein paar winzige Kügelchen, die umeinander kreisen, in der alle Zusammenhänge aus Regeln besteht, die dem Wenn-Dann-Immer-Prinzip folgen. Eine erste Macke bekam diese Sicht auf die Welt und die Natur durch die Theorien von Albert Einstein, dass Zeit nichts Unveränderliches ist, wodurch die Schwerkraft entsteht, die Äquivalenz von Energie und Masse. Ganz übel wurde es dann mit der Quantenphysik, die letztlich das Atommodell, das heute noch an allen Schulen gelehrt wird, völlig in Frage stellt. Die Vorstellung, dass Materie aus Feldern, ihrer Wechselwirkung und ihren Beziehungen entsteht, ist fast allen Menschen noch heute fremd. Wenn wir aber längst wissen, dass die mechanistische Erklärung der Welt, und des Lebens, ganz anders ist als gedacht, warum hängen wir dann immer noch an diesem Bild? Die Antwort liegt nicht zuletzt darin, dass es für die Politik und die Wirtschaft von großem Vorteil ist. Deshalb möchte Fabian Scheidler mit diesem Naturbild aufräumen.
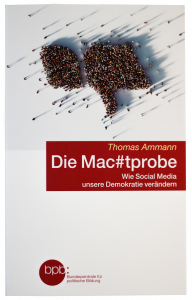 Thomas Ammann hat sein Handwerk noch mit richtigem Film, Tonbandgeräten und Telefonzelle statt Handy erlernt. So gehört er, wie auch ich, beide Jahrgang 1956, zu den Beobachtern der ersten Stunde in der Entwicklung der Digitalisierung der Medien. Was auch heißt, dass Ammann aus dem Blick des sowohl Beteiligten als auch Betroffenen an das Thema heran geht. Zugute halten muss ihm weiterhin, dass drei große Interviews im Buch enthalten sind, die für weitere Aspekte auf das Gebiet hilfreich sind. Grob eingeteilt sind drei Sichten wesentlich. Einmal die aktuelle Situation mit den großen Playern Facebook und Instagram, und ihre Auswirkungen auf die Demokratie und Politik. Was er die dunkle Seite des Netzes nennt, ist eine sehr detaillierte Aufschlüsselung, über die Art und Weise, wie die Digitalisierung nicht nur die Medien, sondern auch Politik und Gesellschaft verändert hat. Wie sich in den letzten Jahren Bewegungen gebildet haben, die ohne die sozialen Medien so nicht möglich gewesen wären, von PEGIDA bis zum arabischen Frühling. Oder über die Auswirkungen der sozialen Medien, der dort verbreiteten Fake News bis zur Beeinflussung von Wahlen überall auf der Welt. Über die Rolle Russlands und China in diesen Geschichten. Die Story um Cambridge Analytica schildert er mal in allen Details, was ein erschreckendes Bild über den Stand in der aktuelle Politik entstehen lässt, nicht nur in den USA. Im dritten Bereich geht er mit seinen eigenen Medien hart ins Gericht. Lange glaubten Journalisten und Verleger, sie seinen die maßgeblichen Verkünder der Wahrheiten, die einzigen Quellen für Informationen, Gralshüter. Dabei haben sie die Veränderungen, die sich früh abzeichneten, sehr lange verschlafen.
Thomas Ammann hat sein Handwerk noch mit richtigem Film, Tonbandgeräten und Telefonzelle statt Handy erlernt. So gehört er, wie auch ich, beide Jahrgang 1956, zu den Beobachtern der ersten Stunde in der Entwicklung der Digitalisierung der Medien. Was auch heißt, dass Ammann aus dem Blick des sowohl Beteiligten als auch Betroffenen an das Thema heran geht. Zugute halten muss ihm weiterhin, dass drei große Interviews im Buch enthalten sind, die für weitere Aspekte auf das Gebiet hilfreich sind. Grob eingeteilt sind drei Sichten wesentlich. Einmal die aktuelle Situation mit den großen Playern Facebook und Instagram, und ihre Auswirkungen auf die Demokratie und Politik. Was er die dunkle Seite des Netzes nennt, ist eine sehr detaillierte Aufschlüsselung, über die Art und Weise, wie die Digitalisierung nicht nur die Medien, sondern auch Politik und Gesellschaft verändert hat. Wie sich in den letzten Jahren Bewegungen gebildet haben, die ohne die sozialen Medien so nicht möglich gewesen wären, von PEGIDA bis zum arabischen Frühling. Oder über die Auswirkungen der sozialen Medien, der dort verbreiteten Fake News bis zur Beeinflussung von Wahlen überall auf der Welt. Über die Rolle Russlands und China in diesen Geschichten. Die Story um Cambridge Analytica schildert er mal in allen Details, was ein erschreckendes Bild über den Stand in der aktuelle Politik entstehen lässt, nicht nur in den USA. Im dritten Bereich geht er mit seinen eigenen Medien hart ins Gericht. Lange glaubten Journalisten und Verleger, sie seinen die maßgeblichen Verkünder der Wahrheiten, die einzigen Quellen für Informationen, Gralshüter. Dabei haben sie die Veränderungen, die sich früh abzeichneten, sehr lange verschlafen.
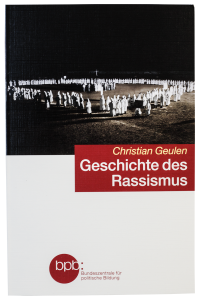 Ein erstes Problem bei dem Begriff Rassismus ist schon seine Definition. Ist Rassismus nur das Einteilen von Menschen in niederwertige und höherwertige Gruppen? Woher stammt überhaupt der Begriff der Rassen auf den Menschen bezogen? Bei Hunden oder Pferden bleibt der Begriff gängig, ein Zwergschnauzer und eine Dogge unterscheiden sich offenbar erheblich. Aber ein Schnauzer ist auch nicht besser oder schlechter als eine Dogge. Wohingegen die genetischen Unterschiede zwischen einem Dänen und einem Italiener größer sein können als zwischen einem Polen und einem Afroamerikaner. Stichwort epigenetische Einflüsse. Doch es geht eben nicht um solche Fragen, deren Antworten heute weitgehend beantwortet sind. Es geht stattdessen um eine historische Sicht, wann Rassismus überhaupt entstanden ist, woran er sich festmachen lässt und wie seine gesellschaftliche und politische Deutung verläuft. So wird klar, dass Christian Geulen eine historische Sicht auf dieses Phänomen als Thema dieses Buches hat. Mit Geulens beruflichem Hintergrund kommt dabei nicht eine populärwissenschaftliche Schrift heraus, die man mal so eben durchliest, sondern ein schon komplexes und vielschichtiges Werk. Geschichte des Rassismus ist, nicht vom Seitenumfang her, jedoch in Inhalt und Darstellung, ein anspruchsvolles Buch. Mit Ecken und Kanten, steuert in dieser Thematik zugleich viele Details und Hintergrundinformationen bei. Zusammengefasst: Nicht ganz einfach zu lesen, aber die Mühe schon wert.
Ein erstes Problem bei dem Begriff Rassismus ist schon seine Definition. Ist Rassismus nur das Einteilen von Menschen in niederwertige und höherwertige Gruppen? Woher stammt überhaupt der Begriff der Rassen auf den Menschen bezogen? Bei Hunden oder Pferden bleibt der Begriff gängig, ein Zwergschnauzer und eine Dogge unterscheiden sich offenbar erheblich. Aber ein Schnauzer ist auch nicht besser oder schlechter als eine Dogge. Wohingegen die genetischen Unterschiede zwischen einem Dänen und einem Italiener größer sein können als zwischen einem Polen und einem Afroamerikaner. Stichwort epigenetische Einflüsse. Doch es geht eben nicht um solche Fragen, deren Antworten heute weitgehend beantwortet sind. Es geht stattdessen um eine historische Sicht, wann Rassismus überhaupt entstanden ist, woran er sich festmachen lässt und wie seine gesellschaftliche und politische Deutung verläuft. So wird klar, dass Christian Geulen eine historische Sicht auf dieses Phänomen als Thema dieses Buches hat. Mit Geulens beruflichem Hintergrund kommt dabei nicht eine populärwissenschaftliche Schrift heraus, die man mal so eben durchliest, sondern ein schon komplexes und vielschichtiges Werk. Geschichte des Rassismus ist, nicht vom Seitenumfang her, jedoch in Inhalt und Darstellung, ein anspruchsvolles Buch. Mit Ecken und Kanten, steuert in dieser Thematik zugleich viele Details und Hintergrundinformationen bei. Zusammengefasst: Nicht ganz einfach zu lesen, aber die Mühe schon wert.
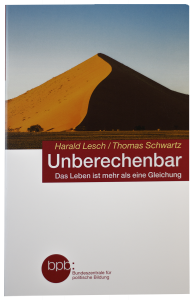 Die Bücher in meinen Regalen sind nach Themen geordnet. Reisen und Sprachen, Philosophie, Psychologie, Journalismus, Politik und Gesellschaft, Fachbücher und so weiter. In welcher Etage ich nun dieses Buch ablegen soll, ist mir ein wenig schleierhaft. Vielleicht eher Philosophie. Oder doch Gesellschaft? Auch wenn man Harald Lesch eher der Naturwissenschaft zuordnen würde, ist ja Thomas Schwartz Coautor, damit kommt die Theologie zum Zug. Sagen wir, das Buch ist ein Essay, in dem beide Welten zum Tragen kommen. Einmal die nüchterne Betrachtung des Wissenschaftlers, zusätzlich eine moralisch-ethische Sicht der Dinge. Es geht, wie könnte es anders sein, mal wieder um den Blick auf die Menschheit, wie sie sich auf diesem Planeten aufführt, was sie Unfassliches mit ihm anstellt und was dabei alles aus dem Blick gerät. Es ist zugleich ein Weckruf. Wie ich schon inzwischen so oft geschrieben habe, an die, die dieses Buch eh nicht lesen und denen die behandelten Themen total schnurzegal sind. Im Grunde ist das Buch also überflüssig. Warum sollte man dieses Buch dann trotzdem lesen? Weil es in drei Betrachtungsrichtungen umreißt, was und warum so viele Dinge im Moment schief laufen, so als Erweiterung des Arsenals an Argumenten im Diskurs. Auch wenn man sich, wie ich, mit den betreffenden Themen schon lange auseinander setzt, muss ich dem Buch zugestehen, dass es dort immer noch neue Elemente liefert. Keine weiteren Zahlen, Daten und Fakten, sondern Interpretationen unseres menschlichen Daseins, die wir gerne ausblenden, nicht wahr haben wollen. Dann vielleicht doch nicht schon ein Dutzend Mal so gelesen.
Die Bücher in meinen Regalen sind nach Themen geordnet. Reisen und Sprachen, Philosophie, Psychologie, Journalismus, Politik und Gesellschaft, Fachbücher und so weiter. In welcher Etage ich nun dieses Buch ablegen soll, ist mir ein wenig schleierhaft. Vielleicht eher Philosophie. Oder doch Gesellschaft? Auch wenn man Harald Lesch eher der Naturwissenschaft zuordnen würde, ist ja Thomas Schwartz Coautor, damit kommt die Theologie zum Zug. Sagen wir, das Buch ist ein Essay, in dem beide Welten zum Tragen kommen. Einmal die nüchterne Betrachtung des Wissenschaftlers, zusätzlich eine moralisch-ethische Sicht der Dinge. Es geht, wie könnte es anders sein, mal wieder um den Blick auf die Menschheit, wie sie sich auf diesem Planeten aufführt, was sie Unfassliches mit ihm anstellt und was dabei alles aus dem Blick gerät. Es ist zugleich ein Weckruf. Wie ich schon inzwischen so oft geschrieben habe, an die, die dieses Buch eh nicht lesen und denen die behandelten Themen total schnurzegal sind. Im Grunde ist das Buch also überflüssig. Warum sollte man dieses Buch dann trotzdem lesen? Weil es in drei Betrachtungsrichtungen umreißt, was und warum so viele Dinge im Moment schief laufen, so als Erweiterung des Arsenals an Argumenten im Diskurs. Auch wenn man sich, wie ich, mit den betreffenden Themen schon lange auseinander setzt, muss ich dem Buch zugestehen, dass es dort immer noch neue Elemente liefert. Keine weiteren Zahlen, Daten und Fakten, sondern Interpretationen unseres menschlichen Daseins, die wir gerne ausblenden, nicht wahr haben wollen. Dann vielleicht doch nicht schon ein Dutzend Mal so gelesen.
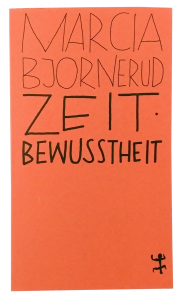 Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Der heutige Mensch tauchte erst von ca. 300.000 Jahren auf. Einem beliebtem Bild nach, wenn man die Zeit der Existenz der Erde als einen Tag betrachtet, erschien Homo in der letzten Sekunde vor Mitternacht. Aber was kommt in diesem Bild eigentlich nach Mitternacht? So widmet sich Marcia Bjornerud, Geologin, gleich mehreren Fragen, von der, wie die Erde kurz nach ihrem Entstehen aussah, wie sie sich in den Milliarden Jahren verändert hat, welche Rolle der Mensch dabei spielt und wie die Geschichte wohl weitergeht. Das Ende ist klar, in ca. drei Milliarden Jahren wird die Sonne immer heißer, dehnt sich aus und verschluckt die meisten Planeten, die sie heute umkreisen. Dazu nimmt Bjornerud den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit aus geologischer Sicht. So weit unserer heutiger Wissensstand dazu ausreicht, denn viele Fragen sind noch lange nicht beantwortet. Warum gab es mindestens fünf große Phasen des Massensterbens auf der Erde, wobei das Sterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit noch das harmloseste war? Auch noch nicht ganz geklärt ist, wieso die Erde mehrmals ihre Atmosphäre gewechselt hat. Die erste enthielt noch gar keinen Sauerstoff, erst Cyanobakterien sorgten für wenige Promille. Trotz vieler unbeantworteter Fragen haben wir heute ein klareres Bild der Erde, wie wir sie jetzt kennen, doch auch das erst mit dem 20 Jahrhundert. Wie entstanden Gebirge? Die Theorie der Plattentektonik entstand erst 1960. Aber Bjornerud geht weiter. Sie blickt genau so aus ökologischen und ökomischen Sichtweisen darauf, dass der Mensch in wenigen Jahrhunderten die Erde stärker verändert hat als die Natur über Jahrmillionen. Also ein geologischer und ein ökologischer Ritt durch die Zeit. Die wir Menschen völlig falsch einschätzen.
Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde ca. 4,5 Milliarden Jahre alt. Der heutige Mensch tauchte erst von ca. 300.000 Jahren auf. Einem beliebtem Bild nach, wenn man die Zeit der Existenz der Erde als einen Tag betrachtet, erschien Homo in der letzten Sekunde vor Mitternacht. Aber was kommt in diesem Bild eigentlich nach Mitternacht? So widmet sich Marcia Bjornerud, Geologin, gleich mehreren Fragen, von der, wie die Erde kurz nach ihrem Entstehen aussah, wie sie sich in den Milliarden Jahren verändert hat, welche Rolle der Mensch dabei spielt und wie die Geschichte wohl weitergeht. Das Ende ist klar, in ca. drei Milliarden Jahren wird die Sonne immer heißer, dehnt sich aus und verschluckt die meisten Planeten, die sie heute umkreisen. Dazu nimmt Bjornerud den Leser mit auf eine Reise durch die Zeit aus geologischer Sicht. So weit unserer heutiger Wissensstand dazu ausreicht, denn viele Fragen sind noch lange nicht beantwortet. Warum gab es mindestens fünf große Phasen des Massensterbens auf der Erde, wobei das Sterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit noch das harmloseste war? Auch noch nicht ganz geklärt ist, wieso die Erde mehrmals ihre Atmosphäre gewechselt hat. Die erste enthielt noch gar keinen Sauerstoff, erst Cyanobakterien sorgten für wenige Promille. Trotz vieler unbeantworteter Fragen haben wir heute ein klareres Bild der Erde, wie wir sie jetzt kennen, doch auch das erst mit dem 20 Jahrhundert. Wie entstanden Gebirge? Die Theorie der Plattentektonik entstand erst 1960. Aber Bjornerud geht weiter. Sie blickt genau so aus ökologischen und ökomischen Sichtweisen darauf, dass der Mensch in wenigen Jahrhunderten die Erde stärker verändert hat als die Natur über Jahrmillionen. Also ein geologischer und ein ökologischer Ritt durch die Zeit. Die wir Menschen völlig falsch einschätzen.
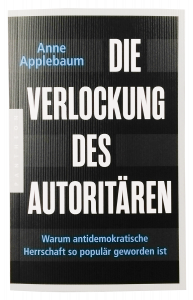 Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.
Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.
 Als das Internet sich Anfang der 1980er verbreitete, war es ein Medium der Wissenschaftler und Ingenieure. Der Zugang war beinahe elitär und mühsam. Mitte der 1990er, mit dem World Wide Web, nutzten es zunehmend auch Privatleute, besonders Musiker, Journalisten, Verlage und erste Online-Händler. Kommerziell wurde das WWW erst mit dem Jahrtausendwechsel. Bestand das WWW dort noch aus Abertausenden kleiner und gleichberechtigter Server, wird das Internet im 21. Jahrhundert vor allen Dingen von den großen Plattformen beherrscht, Facebook und Google, Amazon und Instagram, Microsoft und Apple. Der Begriff der Plattform in diesem Sinne ist relativ jung, doch Plattformen im technischen Sinne gibt es schon lange. Technologisch war es zum Beispiel das System /360 von IBM. Zum ersten Mal versprach der Hersteller, dass alle ab jetzt investierte Software und Hardware praktisch unbegrenzt über die weitere Entwicklung hinaus genutzt werden konnte. Andere Plattformen kamen auf, obwohl sie noch nicht so genannt wurden. Der Apple II, der IBM-PC, später Smartphones mit Android und iOS. Was diese Plattformen sind, wie sie ihre Macht in Netz, Gesellschaft, Kultur und Politik gewannen, wie sie funktionieren und warum, stellt Michael Seemann in diesem nicht gerade schmalen Buch vor. Er beginnt mit der aus seiner Sicht ersten disruptiven Netzanwendung: Napster. Napster stellte nicht nur technisch eine Neuerung dar, sondern forderte zum ersten Mal Wirtschaft und Politik heraus. Der MP3-Tauschdienst ging unter, doch er hatte eine riesige Welle ausgelöst, die nicht nur das Netz, sondern auch unser Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert hat. Ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben.
Als das Internet sich Anfang der 1980er verbreitete, war es ein Medium der Wissenschaftler und Ingenieure. Der Zugang war beinahe elitär und mühsam. Mitte der 1990er, mit dem World Wide Web, nutzten es zunehmend auch Privatleute, besonders Musiker, Journalisten, Verlage und erste Online-Händler. Kommerziell wurde das WWW erst mit dem Jahrtausendwechsel. Bestand das WWW dort noch aus Abertausenden kleiner und gleichberechtigter Server, wird das Internet im 21. Jahrhundert vor allen Dingen von den großen Plattformen beherrscht, Facebook und Google, Amazon und Instagram, Microsoft und Apple. Der Begriff der Plattform in diesem Sinne ist relativ jung, doch Plattformen im technischen Sinne gibt es schon lange. Technologisch war es zum Beispiel das System /360 von IBM. Zum ersten Mal versprach der Hersteller, dass alle ab jetzt investierte Software und Hardware praktisch unbegrenzt über die weitere Entwicklung hinaus genutzt werden konnte. Andere Plattformen kamen auf, obwohl sie noch nicht so genannt wurden. Der Apple II, der IBM-PC, später Smartphones mit Android und iOS. Was diese Plattformen sind, wie sie ihre Macht in Netz, Gesellschaft, Kultur und Politik gewannen, wie sie funktionieren und warum, stellt Michael Seemann in diesem nicht gerade schmalen Buch vor. Er beginnt mit der aus seiner Sicht ersten disruptiven Netzanwendung: Napster. Napster stellte nicht nur technisch eine Neuerung dar, sondern forderte zum ersten Mal Wirtschaft und Politik heraus. Der MP3-Tauschdienst ging unter, doch er hatte eine riesige Welle ausgelöst, die nicht nur das Netz, sondern auch unser Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert hat. Ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben.
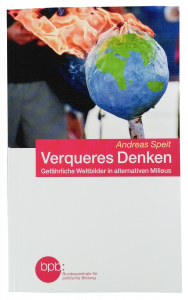 Gegner der Corona-Maßnahmen und Corona-Leugner aus der sogenannten bürgerlichen Mitte, Reichsbürger und Rechtsradikale sowie AfD-Leute und andere Rechtspopulisten marschieren einträchtig durch deutsche Städte, um ihren Protest zu artikulieren. Wenn nicht gar das Ende dieses Staates auszurufen. Dazwischen sieht man blaue Flaggen mit der Friedenstaube und sogar Regenbogen-Flaggen. Sowie Springerstiefel und die vertrauten Latzhosen aus der Öko-Bewegung. Was zuerst ungläubiges Erstaunen hervor ruft, drängt auf den zweiten Blick nach Erklärungen. Sind es nur gemeinsame Feindbilder und Anliegen? Ist es Ignoranz oder Unwissen, politisch wie sozial? Der Sozialökonom und freie Journalist Andreas Speit hat andere Erkenntnisse. Zwar tendiert man zuerst zu dem Glauben, Verschwörungstheorien und esoterische Weltsichten wären nur auf die jeweiligen dort verorteten Gruppen beschränkt. Doch schaut man mit Speits Blick ein wenig hinter die Kulissen und nimmt sich die Geschichte und Herkunft dieser Gruppen vor, sogar aus dem linken politischen Spektrum, wird Seltsames offenbar. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus und Esoterik ziehen sich wie ein roter Faden durch Bevölkerungsteile, wo man es nicht vermuten würde. Was sie eint, ist nicht die Ratio, sondern die Emotion.
Gegner der Corona-Maßnahmen und Corona-Leugner aus der sogenannten bürgerlichen Mitte, Reichsbürger und Rechtsradikale sowie AfD-Leute und andere Rechtspopulisten marschieren einträchtig durch deutsche Städte, um ihren Protest zu artikulieren. Wenn nicht gar das Ende dieses Staates auszurufen. Dazwischen sieht man blaue Flaggen mit der Friedenstaube und sogar Regenbogen-Flaggen. Sowie Springerstiefel und die vertrauten Latzhosen aus der Öko-Bewegung. Was zuerst ungläubiges Erstaunen hervor ruft, drängt auf den zweiten Blick nach Erklärungen. Sind es nur gemeinsame Feindbilder und Anliegen? Ist es Ignoranz oder Unwissen, politisch wie sozial? Der Sozialökonom und freie Journalist Andreas Speit hat andere Erkenntnisse. Zwar tendiert man zuerst zu dem Glauben, Verschwörungstheorien und esoterische Weltsichten wären nur auf die jeweiligen dort verorteten Gruppen beschränkt. Doch schaut man mit Speits Blick ein wenig hinter die Kulissen und nimmt sich die Geschichte und Herkunft dieser Gruppen vor, sogar aus dem linken politischen Spektrum, wird Seltsames offenbar. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus und Esoterik ziehen sich wie ein roter Faden durch Bevölkerungsteile, wo man es nicht vermuten würde. Was sie eint, ist nicht die Ratio, sondern die Emotion.
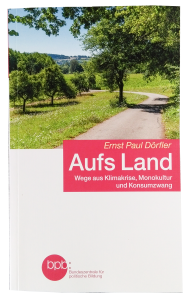 Lange Zeit haben wir an den Fortschritt geglaubt. Dieser Fortschritt liegt in den Städten, im Urbanen, wohin es weltweit immer mehr Menschen zieht. Stadt steht für Kultur und Konsum, für Abwechslung und Anregung. Das Dorf dagegen gilt als langweilig, beschränkt und rückständig. Diese Stereotypen stimmen schon lange nicht mehr, hier auf den Feldern fahren moderne Trecker selbstständig, GPS-gesteuert, der Bauer sitzt zuhause am Rechner und pflegt seine Statistiken über Futterzuteilung und macht Videokonferenz, vor meiner Haustür in dieser 2.300 Seelen-Gemeinde im Paderborner Land liegt Glasfaser. Aber das ist es nicht genau, worauf Ernst Paul Dörfler hinaus will. Die Stadt steht auch für Enge und Verdichtung, erzwungene Nähe, Dreck, Lärm und Luftverschmutzung. Acht von zehn Kindern in der Stadt halten das Bild einer Gans für das einer Ente. Dörfler, nomen est omen, ist auf einem kleinen Dorf in der früheren DDR aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen kleinen Hof, er wuchs noch in den Wäldern und Feldern zwischen den Höfen auf, war den weiten Blick in die Landschaft gewohnt. Aber auch den Schulweg zehn Kilometer zum nächsten Gymnasium, im Sommer wie im tiefsten Winter. Zum Studium trieb es ihn in die Großstadt, wo er es nicht lange aushielt und auf das ach so öde Land zurück kehrte. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Leben auf dem Land, in Kontakt mit der Natur und abseits des Zwangs zum Konsum.
Lange Zeit haben wir an den Fortschritt geglaubt. Dieser Fortschritt liegt in den Städten, im Urbanen, wohin es weltweit immer mehr Menschen zieht. Stadt steht für Kultur und Konsum, für Abwechslung und Anregung. Das Dorf dagegen gilt als langweilig, beschränkt und rückständig. Diese Stereotypen stimmen schon lange nicht mehr, hier auf den Feldern fahren moderne Trecker selbstständig, GPS-gesteuert, der Bauer sitzt zuhause am Rechner und pflegt seine Statistiken über Futterzuteilung und macht Videokonferenz, vor meiner Haustür in dieser 2.300 Seelen-Gemeinde im Paderborner Land liegt Glasfaser. Aber das ist es nicht genau, worauf Ernst Paul Dörfler hinaus will. Die Stadt steht auch für Enge und Verdichtung, erzwungene Nähe, Dreck, Lärm und Luftverschmutzung. Acht von zehn Kindern in der Stadt halten das Bild einer Gans für das einer Ente. Dörfler, nomen est omen, ist auf einem kleinen Dorf in der früheren DDR aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen kleinen Hof, er wuchs noch in den Wäldern und Feldern zwischen den Höfen auf, war den weiten Blick in die Landschaft gewohnt. Aber auch den Schulweg zehn Kilometer zum nächsten Gymnasium, im Sommer wie im tiefsten Winter. Zum Studium trieb es ihn in die Großstadt, wo er es nicht lange aushielt und auf das ach so öde Land zurück kehrte. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Leben auf dem Land, in Kontakt mit der Natur und abseits des Zwangs zum Konsum.
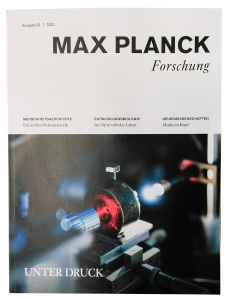 Die Max Planck-Gesellschaft gibt alle drei Monate ein Magazin über aktuelle Forschungen an ihren Instituten und über allgemeine Themen der Forschung und Technik heraus. In der aktuellen Ausgabe 01/2022 geht es um die Zukunft von Öl und Gas, über die Wirkung von Stress auf den menschlichen Körper, wie unsere Knochen aufgebaut sind und was sie so belastbar macht, und viele weitere Themen. Die Beiträge sind zwar wissenschaftlich fundiert, trotzdem leicht verständlich und unterhaltsam. Für alle an Wissenschaft und Forschung Interessierten eine empfehlenswerte Lektüre, zudem kostenlos als Printausgabe oder PDF. Erhältlich unter
Die Max Planck-Gesellschaft gibt alle drei Monate ein Magazin über aktuelle Forschungen an ihren Instituten und über allgemeine Themen der Forschung und Technik heraus. In der aktuellen Ausgabe 01/2022 geht es um die Zukunft von Öl und Gas, über die Wirkung von Stress auf den menschlichen Körper, wie unsere Knochen aufgebaut sind und was sie so belastbar macht, und viele weitere Themen. Die Beiträge sind zwar wissenschaftlich fundiert, trotzdem leicht verständlich und unterhaltsam. Für alle an Wissenschaft und Forschung Interessierten eine empfehlenswerte Lektüre, zudem kostenlos als Printausgabe oder PDF. Erhältlich unter
https://www.mpg.de/maxplanckforschung
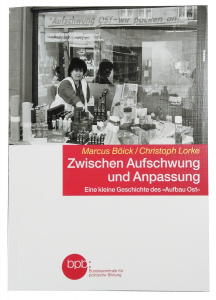 Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats daran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen. Über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Böick und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss. Woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut, Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt? Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und, leider eben auch, durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues, doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun.
Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats daran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen. Über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Böick und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss. Woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut, Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt? Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und, leider eben auch, durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues, doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun.
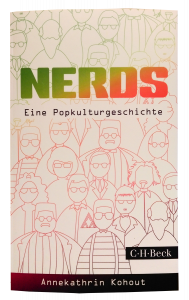 Wenn man von einem Nerd spricht, ist damit meistens der Computer-Nerd gemeint. Man stellt sich einen jungen Mann mit dicken Brillengläsern vor, unattraktiv, sozial unverträglich, etwas seltsam gekleidet, der sich überwiegend von Tiefkühlpizza und Coca Cola ernährt. Am Arbeitstisch, weil er den geliebten Mittelpunkt seines Lebens, seinen Computer, nicht einmal zur Nahrungsaufnahme verlassen will. Gleichzeitig ist er ein Wissender, ein Spezialist, der so viel weiß über Computer wie nur wenige. Sei es als "Coder" oder als "Gamer". Diese Sozialfigur, die bei uns in den Achtzigern und Neunzigern bekannt wurde, existiert tatsächlich nicht mehr. Computer sind keine Angelegenheit für wenige Experten mehr, die Beschäftigung mit ihnen findet nicht mehr in muffigen Kellern oder ausgedienten Dachzimmern statt. Trotzdem hält sich dieses Bild. Was aber dieses Bild repräsentiert, wie es entstanden ist und wie es sich verändert hat, untersucht Annekathrin Kohout in diesem Buch sehr eingehend. Wie so viele Sozialfiguren entstand der Nerd, lange bevor der Begriff in Europa gängig wurde, in den USA. Doch die Vorläufer des Nerds waren Stereotypen, die sich weit vor dem Auftauchen des Personal Computers ausbildeten. Was später der Nerd wurde, war zuvor in den USA der Square, ein Spießer, Unflexibler, Vorgestriger. So wäre das Buch ziemlich uninteressant, wenn es nur um diesen Computer-Freak ginge. Stattdessen untersucht Kohout weitere Aspekte soziokultureller Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Wie sich Rollenbilder überhaupt entwickelten, wie sich Zuschreibungen veränderten, wie sich Technologie vom Expertenwissen zum Alltagswissen veränderte. Erst mit dieser erweiterten Interpretation bekommt das Buch einen Reiz. Wenn man sich für Kulturwissenschaften interessiert.
Wenn man von einem Nerd spricht, ist damit meistens der Computer-Nerd gemeint. Man stellt sich einen jungen Mann mit dicken Brillengläsern vor, unattraktiv, sozial unverträglich, etwas seltsam gekleidet, der sich überwiegend von Tiefkühlpizza und Coca Cola ernährt. Am Arbeitstisch, weil er den geliebten Mittelpunkt seines Lebens, seinen Computer, nicht einmal zur Nahrungsaufnahme verlassen will. Gleichzeitig ist er ein Wissender, ein Spezialist, der so viel weiß über Computer wie nur wenige. Sei es als "Coder" oder als "Gamer". Diese Sozialfigur, die bei uns in den Achtzigern und Neunzigern bekannt wurde, existiert tatsächlich nicht mehr. Computer sind keine Angelegenheit für wenige Experten mehr, die Beschäftigung mit ihnen findet nicht mehr in muffigen Kellern oder ausgedienten Dachzimmern statt. Trotzdem hält sich dieses Bild. Was aber dieses Bild repräsentiert, wie es entstanden ist und wie es sich verändert hat, untersucht Annekathrin Kohout in diesem Buch sehr eingehend. Wie so viele Sozialfiguren entstand der Nerd, lange bevor der Begriff in Europa gängig wurde, in den USA. Doch die Vorläufer des Nerds waren Stereotypen, die sich weit vor dem Auftauchen des Personal Computers ausbildeten. Was später der Nerd wurde, war zuvor in den USA der Square, ein Spießer, Unflexibler, Vorgestriger. So wäre das Buch ziemlich uninteressant, wenn es nur um diesen Computer-Freak ginge. Stattdessen untersucht Kohout weitere Aspekte soziokultureller Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Wie sich Rollenbilder überhaupt entwickelten, wie sich Zuschreibungen veränderten, wie sich Technologie vom Expertenwissen zum Alltagswissen veränderte. Erst mit dieser erweiterten Interpretation bekommt das Buch einen Reiz. Wenn man sich für Kulturwissenschaften interessiert.
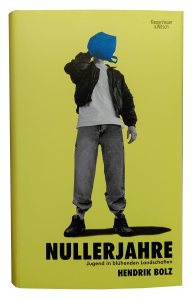 Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch: "Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht bewusst dafür entschieden hat." Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen, waren Bolz' Welt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben, kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rowdytum faselte als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt. Wenn man eben nicht gewaltaffin ist.
Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch: "Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht bewusst dafür entschieden hat." Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen, waren Bolz' Welt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben, kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rowdytum faselte als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt. Wenn man eben nicht gewaltaffin ist.
 Den britischen Autor George Orwell kennen die meisten Leute wohl von seinen beiden dystopischen Romanen Animal Farm und 1984. Zwischen März und November 1945 jedoch folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Von dort schrieb er Berichte für Zeitungen wie The Observer, Manchester Evening News oder Tribune. Diese Artikel sind nun erstmals vollständig übersetzt in Deutsch erschienen, mit einem Nachwort des Historikers Volker Ullrich. Nun könnte man meinen, dass diese Zeit doch schon genug dokumentiert, betrachtet und analysiert sei. Orwell fügt jedoch noch einmal eine neue Perspektive hinzu, seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, eher mit einer erstaunlichen Nüchternheit, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat.
Den britischen Autor George Orwell kennen die meisten Leute wohl von seinen beiden dystopischen Romanen Animal Farm und 1984. Zwischen März und November 1945 jedoch folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Von dort schrieb er Berichte für Zeitungen wie The Observer, Manchester Evening News oder Tribune. Diese Artikel sind nun erstmals vollständig übersetzt in Deutsch erschienen, mit einem Nachwort des Historikers Volker Ullrich. Nun könnte man meinen, dass diese Zeit doch schon genug dokumentiert, betrachtet und analysiert sei. Orwell fügt jedoch noch einmal eine neue Perspektive hinzu, seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, eher mit einer erstaunlichen Nüchternheit, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat.
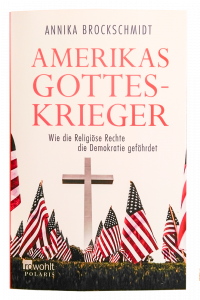 Waren die US-Amerikaner lange ein Vorbild gerade für Deutschland, sind sie uns seit 2016 zu einem Rätsel geworden. Wie konnte eine Nation, die sich als demokratisches und liberales Vorbild in der Welt versteht, einen Menschen wie Donald Trump zum Präsidenten wählen? Was sind das für Leute, die man Evangelikale nennt, die die Bibel wörtlich interpretieren und für die Darwins Erkenntnisse barer Unsinn sind? Für die der Staat ein Feind ist, der "Deep State", der zu entmachten ist und dem jede Kompetenz zur Führung abgesprochen wird. Annika Brockschmidt schildert in ihrem Buch eine ganze Reihe von religiösen Gruppen in den USA, angefangen von den christlichen Nationalisten, über evangelikale Fundamentalisten, religiöse Rechte bis hin zu den zahllosen Splittergruppen. Scheinbar gründet in USA ständig irgendjemand ein Komitee, eine Vereinigung oder eine sonstige Gruppe, die jedoch Wesentliches gemeinsam haben: Die Überzeugung, die USA sei das von Gott erwählte Land, dass Religion und Politik nicht zu trennen sind und dass die USA eine christliche Führung haben sollen, keine weltliche. Alle säkularen, liberalen oder eben nicht gläubigen Menschen sind Feinde, von schwarzen Menschen, Einwanderern und Muslimen ganz zu schweigen. Diese Überzeugungen, auf die Brockschmidt im Detail eingeht und was ihre Ziele sind, lassen einen Europäer manchmal sprach- und verständnislos zurück. Nun könnte man diese Leute als Spinner und Verwirrte abtun und ignorieren. Jedoch haben sie inzwischen die amerikanische Gesellschaft, speziell die Politik, erschreckend durchdrungen, was von dieser Seite des Atlantiks nicht wirklich sichtbar ist. Und werden, nach Jahrzehnte langer Vorarbeit, zu einer Gefahr für die Demokratie in den USA.
Waren die US-Amerikaner lange ein Vorbild gerade für Deutschland, sind sie uns seit 2016 zu einem Rätsel geworden. Wie konnte eine Nation, die sich als demokratisches und liberales Vorbild in der Welt versteht, einen Menschen wie Donald Trump zum Präsidenten wählen? Was sind das für Leute, die man Evangelikale nennt, die die Bibel wörtlich interpretieren und für die Darwins Erkenntnisse barer Unsinn sind? Für die der Staat ein Feind ist, der "Deep State", der zu entmachten ist und dem jede Kompetenz zur Führung abgesprochen wird. Annika Brockschmidt schildert in ihrem Buch eine ganze Reihe von religiösen Gruppen in den USA, angefangen von den christlichen Nationalisten, über evangelikale Fundamentalisten, religiöse Rechte bis hin zu den zahllosen Splittergruppen. Scheinbar gründet in USA ständig irgendjemand ein Komitee, eine Vereinigung oder eine sonstige Gruppe, die jedoch Wesentliches gemeinsam haben: Die Überzeugung, die USA sei das von Gott erwählte Land, dass Religion und Politik nicht zu trennen sind und dass die USA eine christliche Führung haben sollen, keine weltliche. Alle säkularen, liberalen oder eben nicht gläubigen Menschen sind Feinde, von schwarzen Menschen, Einwanderern und Muslimen ganz zu schweigen. Diese Überzeugungen, auf die Brockschmidt im Detail eingeht und was ihre Ziele sind, lassen einen Europäer manchmal sprach- und verständnislos zurück. Nun könnte man diese Leute als Spinner und Verwirrte abtun und ignorieren. Jedoch haben sie inzwischen die amerikanische Gesellschaft, speziell die Politik, erschreckend durchdrungen, was von dieser Seite des Atlantiks nicht wirklich sichtbar ist. Und werden, nach Jahrzehnte langer Vorarbeit, zu einer Gefahr für die Demokratie in den USA.
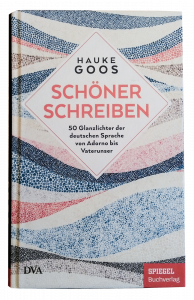 Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres. Aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim SPIEGEL eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze. In denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er. Die Hintergründe, die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist als Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte, von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern und sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Goos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung eine langsam aussterbende Gattung. Leider.
Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres. Aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim SPIEGEL eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze. In denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er. Die Hintergründe, die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist als Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte, von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern und sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Goos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung eine langsam aussterbende Gattung. Leider.
Nach einem Geschichtsstudium besuchte Hauke Goos die Henri-Nannen-Schule. Anschließend war er Reporter für das Magazin Akte bei Sat.1. Ab 1999 war er beim Monatsmagazin SPIEGELreporter, das nach der Einstellung 2001 als Gesellschaftsressort in das Magazin DER SPIEGEL integriert wurde. Seitdem schreibt er für den SPIEGEL und veröffentlicht eigene Bücher. Nach langer Tätigkeit im Gesellschaftsressort wechselte Hauke Goos 2017 für kurze Zeit ins Wirtschaftsressort, bevor er 2018 zum Gesellschaftsressort zurückkehrte. Im Zusammenhang mit der Relotius-Affäre wurde das Gesellschaftsressort umstrukturiert und Goos stellvertretender Leiter des in „Reporter“ umbenannten Ressorts. Hauke Goos erhielt den Henri Nannen Preis in den Jahren 2009, 2011 und 2012 sowie den Deutschen Reporterpreis 2009.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Hauke Goos aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Hauke Goos aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
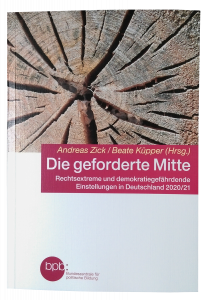 Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die "Mitte" ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.
Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die "Mitte" ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.
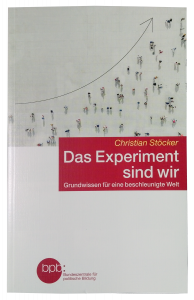 Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:
Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:
Nur 18% der Studenten lieferten spontan die richtige Antwort, von den anderen 82% meinte die große Mehrheit, das sei nach 24 Tagen der Fall gewesen. Was zeigt, dass Menschen, auch die mit einer höheren Bildung, mit exponentiellen Funktionen nicht umgehen können. So waren auch Politiker und sogar Wissenschaftler von der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus überrascht. Ich war ob des Themas von einer gewissen Skepsis beim Beginn des Buches befangen, musste aber schnell feststellen, dass Stöcker mit seiner These völlig recht hat. Dieser eingebaute Mangel an Verständnis für Mathematik hat Konsequenzen. Unsere Entscheidungsblindheit und unsere Neigung zu unlogischen Annahmen hat schon Daniel Kahneman bewiesen, der in diesem Buch oft zitiert wird. Die eigentliche Frage ist daher, was diese Einschränkung bewirkt, in einer Welt, die von exponentiellen Entwicklungen geprägt ist. Sei es in der Technik und der Wissenschaft, in gesellschaftlichen und politischen Tendenzen, in der weltweiten Bevölkerungszahl oder beim Klimawandel. Doch ist das das nicht das einzige Thema, nicht einmal das zentrale, sondern Stöcker ist in der Forschung der künstlichen Intelligenz beteiligt. Auch die entwickelt sich exponentiell, nicht nur wegen immer leistungsfähigerer Hardware, sondern auch wegen ganz neuer Wege und Methoden in der Software. KI greift schon dort immer mehr in unser Leben ein als gedacht, wo wir sie direkt gar nicht sehen: in den sozialen Medien. Mit weitreichenden Folgen, die immer gefährlicher werden. Also ist es nicht ein Buch über menschliche Fehlannahmen, sondern mehr über künstliche Intelligenz.
