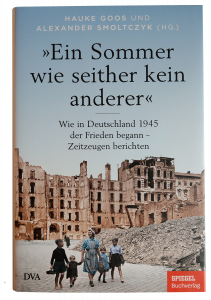 Wer heute durch Dresden oder Köln, Hamburg oder Berlin geht, kann sich keine Vorstellung machen, wie es dort im Sommer 1945 aussah. Vom Krieg fast vollständig zerstört, es herrschten Hunger und Obdachlosigkeit. Selbst kleine Städte wie Halberstadt oder Paderborn waren in den Innenstädten nur noch Ruinenfelder. Aus dieser Phase gibt es jetzt noch Zeitzeugen, auch wenn sie zum 8. Mai 1945 noch Kinder waren. In 24 Beiträgen und Interviews berichten sie, wie sie das Ende des Krieges erlebt haben, wie es war, als noch kein Frieden herrschte, aber wenigstens kein Krieg mehr war. Von Hunger und Vertreibung, von verlorenen Vätern und Familien. Als sich noch keine Fragen nach Schuld und Verantwortung stellten, sondern es nur ums Überleben ging. Nicht irgendwelche Leuten kommen zu Wort, sondern Namen, die mir noch sehr geläufig sind: Hans-Jochen Vogel, Burkhard Hirsch, Klaus von Dohnanyi, Martin Walser, sogar der von mir geschätzte Journalismus-Dozent und Stilexperte Wolf Schneider. Gerhard Baum, Armin Mueller-Stahl, Hans Modrow, Edzard Reuter.
Wer heute durch Dresden oder Köln, Hamburg oder Berlin geht, kann sich keine Vorstellung machen, wie es dort im Sommer 1945 aussah. Vom Krieg fast vollständig zerstört, es herrschten Hunger und Obdachlosigkeit. Selbst kleine Städte wie Halberstadt oder Paderborn waren in den Innenstädten nur noch Ruinenfelder. Aus dieser Phase gibt es jetzt noch Zeitzeugen, auch wenn sie zum 8. Mai 1945 noch Kinder waren. In 24 Beiträgen und Interviews berichten sie, wie sie das Ende des Krieges erlebt haben, wie es war, als noch kein Frieden herrschte, aber wenigstens kein Krieg mehr war. Von Hunger und Vertreibung, von verlorenen Vätern und Familien. Als sich noch keine Fragen nach Schuld und Verantwortung stellten, sondern es nur ums Überleben ging. Nicht irgendwelche Leuten kommen zu Wort, sondern Namen, die mir noch sehr geläufig sind: Hans-Jochen Vogel, Burkhard Hirsch, Klaus von Dohnanyi, Martin Walser, sogar der von mir geschätzte Journalismus-Dozent und Stilexperte Wolf Schneider. Gerhard Baum, Armin Mueller-Stahl, Hans Modrow, Edzard Reuter.
Beiträge
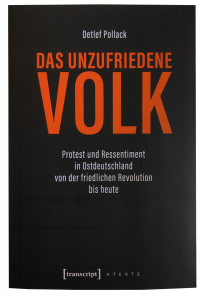 Mal wieder ein Buch über Ossi-Bashing? In gewisser Weise ja, aber anders als zuerst gedacht. Immer wieder schön, wenn ein Buch sich in eine ganz andere Richtung aufmacht als erwartet. Detlef Pollack ist selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, hatte jedoch das Privileg, ins kapitalistische Ausland reisen zu dürfen, schon vor 1989. Zwar war er gerade am 9. November 1989 nicht zuhause, sondern auf einem theologischen Seminar in Zürich, doch hat er lange Zeit die Vorgänge in der damaligen DDR verfolgt und begleitet. Wenn er nicht sogar ein Teil der Veränderungen war, als Student der evangelischen Theologie. Er ist demnach ein profunder Berichterstatter, was sowohl vor der Wiedervereinigung als auch danach geschah. Seine zweite Qualifikation ist sein soziologischer Hintergrund, der insbesondere im letzten großen Kapitel zum Tragen kommt. Hat er eine andere Sicht auf die als Jammer-Ossis und notorische AfD-Wähler im Westen gesehenen Bewohner der neuen Bundesländer? Ja und Nein, überraschender Weise. Sein Fazit ist eher, dass an den Vorwürfen etwas dran ist, aber eben anders als gedacht. Weil die Wessis die Ossis mal wieder nicht verstehen. Weil es eine Menge Fehlinterpretationen gibt. Und weil die Wessis, so wie ich, die ganze Geschichte nicht kennen.
Mal wieder ein Buch über Ossi-Bashing? In gewisser Weise ja, aber anders als zuerst gedacht. Immer wieder schön, wenn ein Buch sich in eine ganz andere Richtung aufmacht als erwartet. Detlef Pollack ist selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, hatte jedoch das Privileg, ins kapitalistische Ausland reisen zu dürfen, schon vor 1989. Zwar war er gerade am 9. November 1989 nicht zuhause, sondern auf einem theologischen Seminar in Zürich, doch hat er lange Zeit die Vorgänge in der damaligen DDR verfolgt und begleitet. Wenn er nicht sogar ein Teil der Veränderungen war, als Student der evangelischen Theologie. Er ist demnach ein profunder Berichterstatter, was sowohl vor der Wiedervereinigung als auch danach geschah. Seine zweite Qualifikation ist sein soziologischer Hintergrund, der insbesondere im letzten großen Kapitel zum Tragen kommt. Hat er eine andere Sicht auf die als Jammer-Ossis und notorische AfD-Wähler im Westen gesehenen Bewohner der neuen Bundesländer? Ja und Nein, überraschender Weise. Sein Fazit ist eher, dass an den Vorwürfen etwas dran ist, aber eben anders als gedacht. Weil die Wessis die Ossis mal wieder nicht verstehen. Weil es eine Menge Fehlinterpretationen gibt. Und weil die Wessis, so wie ich, die ganze Geschichte nicht kennen.
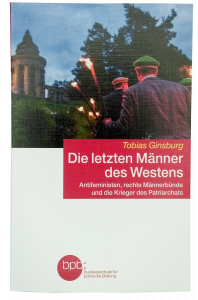 Wieder so ein Buch, das schwerlich in eine Kategorie zu bekommen ist. Tobias Ginsburg nimmt den Leser mit auf die Reise durch sein Spezialgebiet. Schlagende Verbindungen, Männerbünde, die den echten deutschen Mann retten wollen, Rapper aus dem rechten Spektrum, kleine Jungs, die auch gerne dazu gehören möchten. Überhaupt sind die studentischen Verbindungen mit ihren Ritualen aus Saufen und Pöbeln ein Hauptgebiet von Ginsburg, sowohl im Westen wie im Osten. Dann noch das Boss-Kapitel, über Kollegah, Kai und den Mainstream. Zum Schluss eine Reise in Polen, zum berüchtigten Thinktank Ordo Iuris, doch auch zu den Protestierenden in Warschau und an anderen Orten. Ginsburg tarnt sich bei seinen vielen Besuchen, passt sich an die Kulturen der rechten und rechtsextremen Kreise an. Spielt die üblen Spiele mit. Die Schilderungen der Menschen, denen er begegnet, lassen mich oft ratlos zurück. Denn was sie alle eint, von den Burschenschaftlern bis zu den aalglatten Direktoren der polnischen Netzwerke, ist Hass. Hass auf den Feminismus, auf Liberalität, auf Frauen, auf die Demokratie. Wenn man so will, ist das Buch eine Art Reisebericht. Der besonderen Art.
Wieder so ein Buch, das schwerlich in eine Kategorie zu bekommen ist. Tobias Ginsburg nimmt den Leser mit auf die Reise durch sein Spezialgebiet. Schlagende Verbindungen, Männerbünde, die den echten deutschen Mann retten wollen, Rapper aus dem rechten Spektrum, kleine Jungs, die auch gerne dazu gehören möchten. Überhaupt sind die studentischen Verbindungen mit ihren Ritualen aus Saufen und Pöbeln ein Hauptgebiet von Ginsburg, sowohl im Westen wie im Osten. Dann noch das Boss-Kapitel, über Kollegah, Kai und den Mainstream. Zum Schluss eine Reise in Polen, zum berüchtigten Thinktank Ordo Iuris, doch auch zu den Protestierenden in Warschau und an anderen Orten. Ginsburg tarnt sich bei seinen vielen Besuchen, passt sich an die Kulturen der rechten und rechtsextremen Kreise an. Spielt die üblen Spiele mit. Die Schilderungen der Menschen, denen er begegnet, lassen mich oft ratlos zurück. Denn was sie alle eint, von den Burschenschaftlern bis zu den aalglatten Direktoren der polnischen Netzwerke, ist Hass. Hass auf den Feminismus, auf Liberalität, auf Frauen, auf die Demokratie. Wenn man so will, ist das Buch eine Art Reisebericht. Der besonderen Art.
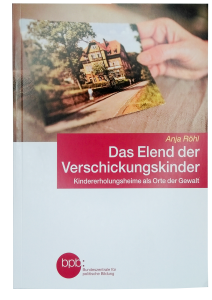 Von November bis Dezember 1972 kam ich für sechs Wochen zur Kinderkur nach Borkum. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind eher angenehm, freundliche und zugewandte Menschen, Bastelnachmittage, Ausflüge an den Strand und Aufhacken des steinhart gefrorenen Sandes in den Dünen. Nur wenig Heimweh, keine Sterneküche, aber auch kein schlechtes Essen. Nachmittags gab es Kakao und Kuchen. Ich hatte Glück gehabt. Viele andere Kinder nicht. Anja Röhl hatte selbst schlechte Erfahrungen als Verschickungskind gemacht. Sie entdeckte 2019 das Trauma der Verschickungskinder und machte es in der Öffentlichkeit sichtbar. So gründete sie als Betroffene im September 2019 einen Verein: «Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.», dazu gibt es auch eine Website zur Vernetzung. In ihrem Buch geht es um die Geschehnisse in den Heimen von der Nordsee bis Berchtesgarden. Von denen sie erfuhr, als sie eine Website öffnete, wo sich Betroffene melden und ihre Geschichten erzählen konnten, die ihnen auf diesen Verschickungen passierten. Es geht um Misshandlungen, Prügel, Demütigungen, sexuellen Missbrauch bis hin zum Tod von Kindern. Wenn man diese Geschichten liest, denkt man, dass so etwas eigentlich undenkbar ist, doch es sind persönliche und authentische Schilderungen. Doch es ist nicht nur das Ziel öffentlich zu machen, was da im Namen von Gesundheit und Erholung den Kindern zustieß. Anja Röhl zeigt auch, dass die Folgen der NS-Ideologie und -Pädagogik noch lange über das Ende des zweiten Weltkrieges hinaus wirksam waren.
Von November bis Dezember 1972 kam ich für sechs Wochen zur Kinderkur nach Borkum. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind eher angenehm, freundliche und zugewandte Menschen, Bastelnachmittage, Ausflüge an den Strand und Aufhacken des steinhart gefrorenen Sandes in den Dünen. Nur wenig Heimweh, keine Sterneküche, aber auch kein schlechtes Essen. Nachmittags gab es Kakao und Kuchen. Ich hatte Glück gehabt. Viele andere Kinder nicht. Anja Röhl hatte selbst schlechte Erfahrungen als Verschickungskind gemacht. Sie entdeckte 2019 das Trauma der Verschickungskinder und machte es in der Öffentlichkeit sichtbar. So gründete sie als Betroffene im September 2019 einen Verein: «Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.», dazu gibt es auch eine Website zur Vernetzung. In ihrem Buch geht es um die Geschehnisse in den Heimen von der Nordsee bis Berchtesgarden. Von denen sie erfuhr, als sie eine Website öffnete, wo sich Betroffene melden und ihre Geschichten erzählen konnten, die ihnen auf diesen Verschickungen passierten. Es geht um Misshandlungen, Prügel, Demütigungen, sexuellen Missbrauch bis hin zum Tod von Kindern. Wenn man diese Geschichten liest, denkt man, dass so etwas eigentlich undenkbar ist, doch es sind persönliche und authentische Schilderungen. Doch es ist nicht nur das Ziel öffentlich zu machen, was da im Namen von Gesundheit und Erholung den Kindern zustieß. Anja Röhl zeigt auch, dass die Folgen der NS-Ideologie und -Pädagogik noch lange über das Ende des zweiten Weltkrieges hinaus wirksam waren.
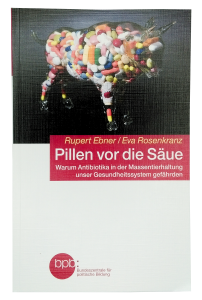 Als das Corona-Virus Anfang 2020 von China aus sich auf die Reise in alle Welt machte, war recht schnell klar, woher es kam: Aus den früher unberührten Urwäldern, die immer mehr von Menschen durchdrungen werden. Doch mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen, die exotische Tierarten als Delikatessen verspeisen, sollten gerade wir Europäer uns sparen. Wir sind seit den Achtzigern fleißig dabei, noch viel gefährlichere Mikroben zu züchten. Nämlich Bakterien, die zunehmend gegen die Wunderwaffe der Medizin, die Antibiotika, resistent werden und über Penizillin nur lachen können. Sogar Infektionen, die wir schon lange als Vergangenheit sahen, wie Tuberkulose oder Salmonellen, tauchen vermehrt in einer Version auf, gegen die Antibiotika nicht mehr nützen. Von den mehrfach resistenten Keimen in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Das haben die Bakterien nicht selbst so ausbaldowert, sondern wir produzieren sie durch den unnötigen und massenhaften Einsatz von Antibiotika in den Megaställen. Wie in Niedersachsen, mit bis zu 50.000 Schweinen oder Hühnern, zusammen gepfercht auf kleinstem Raum, auf Legeleistung oder Fleischansatz gezüchtet, mit kaputten Immunsystemen und unerträglichen Haltungsbedingungen. Da werden allein prophylaktisch Tonnen Medikamente unters Futter gemischt, die nicht nur in Hühnerkot oder Gülle in die Umwelt gelangen. Selbst im Schnitzel oder in der Putenbrust beim Discounter sind die Antibiotika noch nachweisbar. Der Grund: So viel Fleisch und Umsatz wie möglich, so billig wie möglich. Wie beim Klimawandel heißt die Devise dann: Augen zu und durch. Hauptsache die Grillwurst schmeckt und kost' nix.
Als das Corona-Virus Anfang 2020 von China aus sich auf die Reise in alle Welt machte, war recht schnell klar, woher es kam: Aus den früher unberührten Urwäldern, die immer mehr von Menschen durchdrungen werden. Doch mit dem Finger auf die Asiaten zu zeigen, die exotische Tierarten als Delikatessen verspeisen, sollten gerade wir Europäer uns sparen. Wir sind seit den Achtzigern fleißig dabei, noch viel gefährlichere Mikroben zu züchten. Nämlich Bakterien, die zunehmend gegen die Wunderwaffe der Medizin, die Antibiotika, resistent werden und über Penizillin nur lachen können. Sogar Infektionen, die wir schon lange als Vergangenheit sahen, wie Tuberkulose oder Salmonellen, tauchen vermehrt in einer Version auf, gegen die Antibiotika nicht mehr nützen. Von den mehrfach resistenten Keimen in den Krankenhäusern ganz zu schweigen. Das haben die Bakterien nicht selbst so ausbaldowert, sondern wir produzieren sie durch den unnötigen und massenhaften Einsatz von Antibiotika in den Megaställen. Wie in Niedersachsen, mit bis zu 50.000 Schweinen oder Hühnern, zusammen gepfercht auf kleinstem Raum, auf Legeleistung oder Fleischansatz gezüchtet, mit kaputten Immunsystemen und unerträglichen Haltungsbedingungen. Da werden allein prophylaktisch Tonnen Medikamente unters Futter gemischt, die nicht nur in Hühnerkot oder Gülle in die Umwelt gelangen. Selbst im Schnitzel oder in der Putenbrust beim Discounter sind die Antibiotika noch nachweisbar. Der Grund: So viel Fleisch und Umsatz wie möglich, so billig wie möglich. Wie beim Klimawandel heißt die Devise dann: Augen zu und durch. Hauptsache die Grillwurst schmeckt und kost' nix.
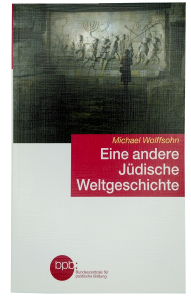 Gibt es "das" Judentum? So wenig, wie es "den" Islam oder "das" Christentum gibt. Man denke nur an die lange Liste unterschiedlicher christlicher Richtungen von altkatholisch, römisch-katholisch und griechisch-orthodox bis zu evangelisch und reformiert-lutherisch. So gab es auch im Judentum unterschiedliche Strömungen und Richtungen, die nicht immer friedlich ausdiskutiert wurden. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen Muslimen, Christen und Juden. Also zwischen den drei monotheistischen Weltreligionen. Nur die Juden wurden beinahe in ihrer ganzen Geschichte nicht nur als eine Religion betrachtet, sondern als eine Kultur, im großen Verlauf der Geschichte sogar als eine Rasse. Obwohl aktuell noch der letzte Dummbatz wissen sollte, dass es keine menschlichen Rassen gibt. So schließt sich dieses Buch beinahe an das zuletzt gelesene an. Ein Zufall, keine Absicht. Geschrieben hat es der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, erschienen ist es schon 2022. Doch nicht immer ist ein Buch über Geschichte eine dröge Aufzählung von Daten und Fakten. Dieses Buch ist anders. Zwar ist der Kern eine historische Darstellung, doch sein Autor erlaubt es sich, auch seine persönlichen Kommentare und Interpretationen einzubringen. Natürlich optisch und layouttechnisch abgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es deutlich lebendiger wird und auch Blicke hinter die historischen Kulissen möglich sind. Dann hätte das Buch noch beinahe in meine Kategorie "angefangen und abgebrochen" Einzug gehalten. Doch wie schon bei anderen Büchern zuvor habe ich den Anfang mit langen Zähnen durchgehalten. Zum Glück.
Gibt es "das" Judentum? So wenig, wie es "den" Islam oder "das" Christentum gibt. Man denke nur an die lange Liste unterschiedlicher christlicher Richtungen von altkatholisch, römisch-katholisch und griechisch-orthodox bis zu evangelisch und reformiert-lutherisch. So gab es auch im Judentum unterschiedliche Strömungen und Richtungen, die nicht immer friedlich ausdiskutiert wurden. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen Muslimen, Christen und Juden. Also zwischen den drei monotheistischen Weltreligionen. Nur die Juden wurden beinahe in ihrer ganzen Geschichte nicht nur als eine Religion betrachtet, sondern als eine Kultur, im großen Verlauf der Geschichte sogar als eine Rasse. Obwohl aktuell noch der letzte Dummbatz wissen sollte, dass es keine menschlichen Rassen gibt. So schließt sich dieses Buch beinahe an das zuletzt gelesene an. Ein Zufall, keine Absicht. Geschrieben hat es der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, erschienen ist es schon 2022. Doch nicht immer ist ein Buch über Geschichte eine dröge Aufzählung von Daten und Fakten. Dieses Buch ist anders. Zwar ist der Kern eine historische Darstellung, doch sein Autor erlaubt es sich, auch seine persönlichen Kommentare und Interpretationen einzubringen. Natürlich optisch und layouttechnisch abgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es deutlich lebendiger wird und auch Blicke hinter die historischen Kulissen möglich sind. Dann hätte das Buch noch beinahe in meine Kategorie "angefangen und abgebrochen" Einzug gehalten. Doch wie schon bei anderen Büchern zuvor habe ich den Anfang mit langen Zähnen durchgehalten. Zum Glück.
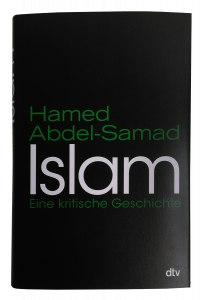 Hamed Abdel-Samad ist ein streitbarer Mensch. Er hat sich sogar einmal getraut, auf einer AfD-Veranstaltung einen Vortrag zu halten. Gilt als großer Islam-Kritiker, hat eine Fatwa am Hals und steht unter ständigem Polizeischutz. Ich habe schon so einige Bücher von ihm durch, zum Beispiel «Aus Liebe zu Deutschland», «Der Untergang der islamischen Welt» oder «Mohamed». Doch ist Abdel-Samad Islam-Kritiker, kein Islam-Basher. Seine Kritik ist immer wohlbegründet, sachlich und vernünftig im Sinne der Aufklärung. «Islam – Eine kritische Geschichte» ist Anfang 2023 heraus gekommen. Es ist aber nicht eine Art Abrechnung mit dem Islam, es ist, wie das Schlüsselwort "Geschichte" anzeigt, eine mehr historische Betrachtung und Interpretation des Islams. Beginnt mit den historischen Grundlagen, der Entstehung des Korans, besser: des ersten Korans, geht vergleichsweise kurz an die Geschichte Mohameds, arbeitet sich danach weiter vor bis zum aktuellen Stand. Einen Schwerpunkt bilden speziell die nächsten Jahrhunderte nach Mohameds Tod, die Entstehung der verschiedenen Richtungen wie Sunniten und Schiiten, Ausbreitung der damals neuen Religion, die erst nur ein Glaube war. Wenn man eine Grundaussage heraus meißeln möchte, ist es die, dass der Islam den Übergang in die Moderne selbst verbaselt hat. Dass der Islam keine eigene Aufklärung zulassen konnte, trotz seiner Blütezeiten, in denen er eine tolerante und offene Religion war. Abdel-Samad erzählt, wie der Islam zu seiner Zeit von der Religion zum Machtinstrument wurde, mit dem die Eroberungen vom Indus bis nach Andalusien voran getrieben wurden, Identitätsstifter für die arabischen Staaten wurde. «Islam» ist also kein historisches Buch im eigentlichen Sinne, sondern eine Geschichte, die helfen soll zu verstehen, warum der Islam dort gelandet ist, wo er heute steht. Also eher im Abseits.
Hamed Abdel-Samad ist ein streitbarer Mensch. Er hat sich sogar einmal getraut, auf einer AfD-Veranstaltung einen Vortrag zu halten. Gilt als großer Islam-Kritiker, hat eine Fatwa am Hals und steht unter ständigem Polizeischutz. Ich habe schon so einige Bücher von ihm durch, zum Beispiel «Aus Liebe zu Deutschland», «Der Untergang der islamischen Welt» oder «Mohamed». Doch ist Abdel-Samad Islam-Kritiker, kein Islam-Basher. Seine Kritik ist immer wohlbegründet, sachlich und vernünftig im Sinne der Aufklärung. «Islam – Eine kritische Geschichte» ist Anfang 2023 heraus gekommen. Es ist aber nicht eine Art Abrechnung mit dem Islam, es ist, wie das Schlüsselwort "Geschichte" anzeigt, eine mehr historische Betrachtung und Interpretation des Islams. Beginnt mit den historischen Grundlagen, der Entstehung des Korans, besser: des ersten Korans, geht vergleichsweise kurz an die Geschichte Mohameds, arbeitet sich danach weiter vor bis zum aktuellen Stand. Einen Schwerpunkt bilden speziell die nächsten Jahrhunderte nach Mohameds Tod, die Entstehung der verschiedenen Richtungen wie Sunniten und Schiiten, Ausbreitung der damals neuen Religion, die erst nur ein Glaube war. Wenn man eine Grundaussage heraus meißeln möchte, ist es die, dass der Islam den Übergang in die Moderne selbst verbaselt hat. Dass der Islam keine eigene Aufklärung zulassen konnte, trotz seiner Blütezeiten, in denen er eine tolerante und offene Religion war. Abdel-Samad erzählt, wie der Islam zu seiner Zeit von der Religion zum Machtinstrument wurde, mit dem die Eroberungen vom Indus bis nach Andalusien voran getrieben wurden, Identitätsstifter für die arabischen Staaten wurde. «Islam» ist also kein historisches Buch im eigentlichen Sinne, sondern eine Geschichte, die helfen soll zu verstehen, warum der Islam dort gelandet ist, wo er heute steht. Also eher im Abseits.
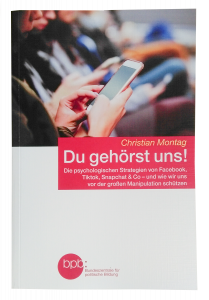 Inzwischen ein vertrautes Bild: Leute sitzen zusammen im Restaurant und wenigstens einige von ihnen wischen auf ihrem Smartphone herum. Anstatt miteinander zu reden. Doch auf "die jungen Leute" zu schimpfen, verengt das Bild. Auch RentnerInnen sitzen nicht mehr auf der Parkbank und füttern Tauben, sondern tippen auf die winzigen Bildschirme. Das Wort von der Smartphone-Sucht ist immer häufiger in den Medien zu hören, Wissenschaftler sprechen lieber von problematischer Internetnutzung. Doch die Wörter verschleiern die wirkliche Situation, niemand ist von dem technischen Gerät abhängig, auch nicht von dem Netzwerk auf Basis des Protokols TCP/IP. Es sind die sogenannten sozialen Medien, von Facebook und Twitter über Instagram bis hin zu Snapchat und Whatsapp, die die Aufmerksamkeit binden. Es gibt sogar schon Länder, in denen die Nutzung des Smartphones beim Überqueren von Straßen mit Strafe belegt ist. Darüber ist schon viel geschrieben worden, meistens ging es dann um Datenschutz oder den digitalen Kapitalismus. Christian Montag geht auf das Thema aus psychologischer Sicht ein. Was bewirkt, dass Menschen so geradezu süchtig nach Facebook und Whatsapp sind? Was sind die psychologischen Hintergründe und wie machen die Plattformkonzerne es, dass sie Menschen so binden? Und gibt es eine psychologische Veranlagung dazu, derart in den Fängen der digitalen Welt zu landen? Ja, ein Buch mit wissenschaftlichem Hintergrund. Doch der Autor ist sich seiner eigenen Schwächen sehr wohl bewusst. Was das Buch menschlicher macht.
Inzwischen ein vertrautes Bild: Leute sitzen zusammen im Restaurant und wenigstens einige von ihnen wischen auf ihrem Smartphone herum. Anstatt miteinander zu reden. Doch auf "die jungen Leute" zu schimpfen, verengt das Bild. Auch RentnerInnen sitzen nicht mehr auf der Parkbank und füttern Tauben, sondern tippen auf die winzigen Bildschirme. Das Wort von der Smartphone-Sucht ist immer häufiger in den Medien zu hören, Wissenschaftler sprechen lieber von problematischer Internetnutzung. Doch die Wörter verschleiern die wirkliche Situation, niemand ist von dem technischen Gerät abhängig, auch nicht von dem Netzwerk auf Basis des Protokols TCP/IP. Es sind die sogenannten sozialen Medien, von Facebook und Twitter über Instagram bis hin zu Snapchat und Whatsapp, die die Aufmerksamkeit binden. Es gibt sogar schon Länder, in denen die Nutzung des Smartphones beim Überqueren von Straßen mit Strafe belegt ist. Darüber ist schon viel geschrieben worden, meistens ging es dann um Datenschutz oder den digitalen Kapitalismus. Christian Montag geht auf das Thema aus psychologischer Sicht ein. Was bewirkt, dass Menschen so geradezu süchtig nach Facebook und Whatsapp sind? Was sind die psychologischen Hintergründe und wie machen die Plattformkonzerne es, dass sie Menschen so binden? Und gibt es eine psychologische Veranlagung dazu, derart in den Fängen der digitalen Welt zu landen? Ja, ein Buch mit wissenschaftlichem Hintergrund. Doch der Autor ist sich seiner eigenen Schwächen sehr wohl bewusst. Was das Buch menschlicher macht.
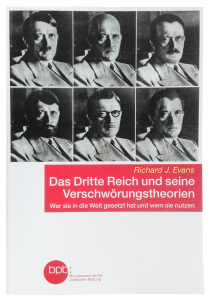 Man könnte annehmen, Verschwörungstheorien hätten erst mit der Verbreitung des Internets wirkliche Bedeutung erlangt. Tatsächlich gehen diese bis ins Mittelalter zurück, siehe Hexenverfolgung und die Inquisition der Kirche. Nun ist Evans nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Suche zu "Verschwörungstheorie" in Büchern bei Amazon liefert über 2.000 Einträge. Das Thema sollte genug behandelt sein. Doch Evans geht die Geschichte etwas anders an. Mit fünf Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich stehen. Es geht ihm jedoch nicht darum, Verschwörungstheorien grundsätzlich zu betrachten und zu erklären, sondern ihre Funktion im historischen Kontext auszuforschen. Denn Evans ist in erster Linie Historiker. Und es geht in diesem Kontext natürlich um Antisemitismus, aber nur in drei der fünf Beispiele, in zwei davon eher konstruiert als begründet. Es versteht sich, dass die Funktionen, Merkmale und Stereotypen von Verschwörungstheorien mit einbezogen werden. Man könnte das Buch als eine Vertiefung zum Thema betrachten, als Aufzeigen von konkreten Konstruktionen, wem sie dienen und warum sie so wirkmächtig sind. Jedoch am Ende noch einmal mit der Warnung, dass Verschwörungstheorien nichts sind, das man nur belächeln und sich darüber lustig machen kann, sondern dass sie Bedrohungen der Wahrheit sind. In einigen Fällen sogar zu bedrohlichen Maßnahmen ihrer Anhänger führten.
Man könnte annehmen, Verschwörungstheorien hätten erst mit der Verbreitung des Internets wirkliche Bedeutung erlangt. Tatsächlich gehen diese bis ins Mittelalter zurück, siehe Hexenverfolgung und die Inquisition der Kirche. Nun ist Evans nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Suche zu "Verschwörungstheorie" in Büchern bei Amazon liefert über 2.000 Einträge. Das Thema sollte genug behandelt sein. Doch Evans geht die Geschichte etwas anders an. Mit fünf Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich stehen. Es geht ihm jedoch nicht darum, Verschwörungstheorien grundsätzlich zu betrachten und zu erklären, sondern ihre Funktion im historischen Kontext auszuforschen. Denn Evans ist in erster Linie Historiker. Und es geht in diesem Kontext natürlich um Antisemitismus, aber nur in drei der fünf Beispiele, in zwei davon eher konstruiert als begründet. Es versteht sich, dass die Funktionen, Merkmale und Stereotypen von Verschwörungstheorien mit einbezogen werden. Man könnte das Buch als eine Vertiefung zum Thema betrachten, als Aufzeigen von konkreten Konstruktionen, wem sie dienen und warum sie so wirkmächtig sind. Jedoch am Ende noch einmal mit der Warnung, dass Verschwörungstheorien nichts sind, das man nur belächeln und sich darüber lustig machen kann, sondern dass sie Bedrohungen der Wahrheit sind. In einigen Fällen sogar zu bedrohlichen Maßnahmen ihrer Anhänger führten.
 Es gibt Fragen, auf die ich selbst nie kommen würde. Zum Beispiel die, ob die Menschen in den Städten und auf dem Land ihre Kreuzchen auf den Wahlzetteln an verschiedenen Stellen machen und warum. Spoiler alert: Es ist tatsächlich so. Nun wohne ich selbst auf dem Dorf, wenn auch in der Nähe zu einer Mittelstadt mit 130.000 Einwohnern. Aber wie viel Dorf ist mein Dorf eigentlich? Verglichen mit einem Dorf im Wendland, in der Lausitz oder im Bayrischen Wald ist unser Dorf recht bunt und gut ausgestattet. Ostwestfalen gehört sicher nicht zu den abgehängten Regionen, hier regiert vor allen Dingen die mittelständische Industrie. Vor meiner Haustür liegt Glasfaser, die drei Buslinien nach Paderborn, Büren und Salzkotten fahren im Stundentakt. Doch die landläufige Vorstellung von Land und Dorf ist anders. Und Dorf und Stadt sind unterschiedlich, in ihrem ökonomischen, kulturellen und politischen Selbstverständnis. Das war in den ersten drei Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg anders. Die Wahlergebnisse von CDU/CSU und SPD waren in Städten und Dörfern ähnlich hoch, beide Parteien waren noch Volksparteien. Inzwischen kränkelt selbst die CSU in den ländlichen Gebieten. In Sachsen eine ähnliche Entwicklung. Es gab aber vor den Achtzigern auch keine Grünen und keine AfD. Aber nicht nur das hat sich verändert. Auf dem Land gibt es kaum noch akzeptable Jobs, kaum noch Einkaufsmöglichkeiten. Die Städte, die urbanen Zentren, gelten deshalb als hip und anziehend. Die Gründe liegen nicht nur, aber zum Hauptteil in der Veränderung unserer Ökonomie und gesellschaftlichen Struktur. Wissensarbeiter und Kreative sind die neuen Helden, sie zieht es in die Städte, nicht aufs Land. Produziert wird nun in Asien oder Billiglohnländern. So verändert sich die Balance zwischen den beiden Polen, mit weitreichenden sozialen und politischen Auswirkungen.
Es gibt Fragen, auf die ich selbst nie kommen würde. Zum Beispiel die, ob die Menschen in den Städten und auf dem Land ihre Kreuzchen auf den Wahlzetteln an verschiedenen Stellen machen und warum. Spoiler alert: Es ist tatsächlich so. Nun wohne ich selbst auf dem Dorf, wenn auch in der Nähe zu einer Mittelstadt mit 130.000 Einwohnern. Aber wie viel Dorf ist mein Dorf eigentlich? Verglichen mit einem Dorf im Wendland, in der Lausitz oder im Bayrischen Wald ist unser Dorf recht bunt und gut ausgestattet. Ostwestfalen gehört sicher nicht zu den abgehängten Regionen, hier regiert vor allen Dingen die mittelständische Industrie. Vor meiner Haustür liegt Glasfaser, die drei Buslinien nach Paderborn, Büren und Salzkotten fahren im Stundentakt. Doch die landläufige Vorstellung von Land und Dorf ist anders. Und Dorf und Stadt sind unterschiedlich, in ihrem ökonomischen, kulturellen und politischen Selbstverständnis. Das war in den ersten drei Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg anders. Die Wahlergebnisse von CDU/CSU und SPD waren in Städten und Dörfern ähnlich hoch, beide Parteien waren noch Volksparteien. Inzwischen kränkelt selbst die CSU in den ländlichen Gebieten. In Sachsen eine ähnliche Entwicklung. Es gab aber vor den Achtzigern auch keine Grünen und keine AfD. Aber nicht nur das hat sich verändert. Auf dem Land gibt es kaum noch akzeptable Jobs, kaum noch Einkaufsmöglichkeiten. Die Städte, die urbanen Zentren, gelten deshalb als hip und anziehend. Die Gründe liegen nicht nur, aber zum Hauptteil in der Veränderung unserer Ökonomie und gesellschaftlichen Struktur. Wissensarbeiter und Kreative sind die neuen Helden, sie zieht es in die Städte, nicht aufs Land. Produziert wird nun in Asien oder Billiglohnländern. So verändert sich die Balance zwischen den beiden Polen, mit weitreichenden sozialen und politischen Auswirkungen.
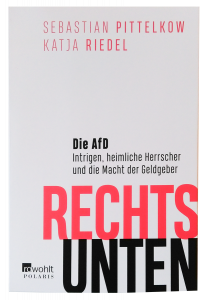 Wofür die «Alternative für Deutschland», die AfD, im deutschen Parteienspektrum steht, ist einfach und zugleich schwer zu beantworten. Entstanden ist sie 2013 in Oberursel als Euro-kritische, liberalkonservative Partei, bis sie wenig später von Rechtspopulisten übernommen wurde. Die bisherigen Größen der Partei, wie Bernd Lucke, wurden entmachtet und aus der Partei gedrängt. Der verbliebene Vorstand mit Frauke Petri und Alexander Gauland steuerte die Partei bis ganz weit nach rechts. Ihren großen Auftritt hatte die AfD dann mit dem Einsetzen der Flüchtlingswelle in 2015, als sie sich an die Spitze der Flüchtlingsgegner, Islam-Hasser und angeblichen Retter Deutschlands setzte. Seit dem Abebben der Migration nach Europa kämpft sie darum, sich einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel durch Anbiederung an Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Das, was anstatt politischem Wirken bis heute übrig blieb, sind interne Grabenkämpfe, noch immer nicht ganz aufgeklärte Spendenskandale, dazu rechtsextreme, fremdenfeindliche oder schlicht peinliche Auftritte im Bundestag und in den Ländern. Sieben Jahre lang haben Sebastian Pittelkow und Katja Riedel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das Treiben der AfD verfolgt. Und dabei erstaunliche wie verstörende Aktivitäten der Rechtextremen ans Licht gebracht. Wie die «Quasselgruppe», merkwürdige Spenden von deutschen und schweizerischen Milliardären sowie befremdliche Kontakte nach Russland. Wenn man über den Alltag hinausgehende Informationen über diese Partei, die eigentlich keine ist, erfahren möchte, liegt man mit diesem Buch goldrichtig.
Wofür die «Alternative für Deutschland», die AfD, im deutschen Parteienspektrum steht, ist einfach und zugleich schwer zu beantworten. Entstanden ist sie 2013 in Oberursel als Euro-kritische, liberalkonservative Partei, bis sie wenig später von Rechtspopulisten übernommen wurde. Die bisherigen Größen der Partei, wie Bernd Lucke, wurden entmachtet und aus der Partei gedrängt. Der verbliebene Vorstand mit Frauke Petri und Alexander Gauland steuerte die Partei bis ganz weit nach rechts. Ihren großen Auftritt hatte die AfD dann mit dem Einsetzen der Flüchtlingswelle in 2015, als sie sich an die Spitze der Flüchtlingsgegner, Islam-Hasser und angeblichen Retter Deutschlands setzte. Seit dem Abebben der Migration nach Europa kämpft sie darum, sich einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel durch Anbiederung an Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Das, was anstatt politischem Wirken bis heute übrig blieb, sind interne Grabenkämpfe, noch immer nicht ganz aufgeklärte Spendenskandale, dazu rechtsextreme, fremdenfeindliche oder schlicht peinliche Auftritte im Bundestag und in den Ländern. Sieben Jahre lang haben Sebastian Pittelkow und Katja Riedel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das Treiben der AfD verfolgt. Und dabei erstaunliche wie verstörende Aktivitäten der Rechtextremen ans Licht gebracht. Wie die «Quasselgruppe», merkwürdige Spenden von deutschen und schweizerischen Milliardären sowie befremdliche Kontakte nach Russland. Wenn man über den Alltag hinausgehende Informationen über diese Partei, die eigentlich keine ist, erfahren möchte, liegt man mit diesem Buch goldrichtig.
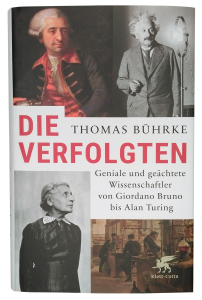 Dass Politiker und Autoren zu vielen Zeiten verfolgt und sogar umgebracht wurden, weil sie Machthabern nicht in den Kram passten, ist nichts Neues. Aber auch Wissenschaftler waren immer wieder Verfolgung ausgesetzt. Entweder weil ihre Forschungen oder ihre Person Bildern und Erwartungen nicht gerecht wurden. Diesen Wissenschaftlern folgt Thomas Bührke durch ihr Leben und ihre Arbeitsgebiete. Die Liste ist erstaunlich. Wie Lise Meitner und Albert Einstein, die beide wegen ihrer jüdischen Abstammungen ihre Heimat verlassen mussten. Einstein traf es danach noch einmal, als er in den USA in der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt wurde. Alan Turing war ein genialer wie seltsamer Spezialist für Informations-Wissenschaft und besonders für Kryptografie. Ihm wurde seine Homosexualität zum Verhängnis, der Versuch einer Konversion trieb ihn am Ende in den Suizid. Giordano Bruno war Astronom und Philosoph. Seine Erkenntnisse in der Astronomie konnte die Kirche nicht hinnehmen. Denn schon er ahnte, das Universum sei unendlich und die Zahl der bewohnbaren Erden unüberschaubar. Das passte nicht zum Gottesbegriff der Kirche.
Dass Politiker und Autoren zu vielen Zeiten verfolgt und sogar umgebracht wurden, weil sie Machthabern nicht in den Kram passten, ist nichts Neues. Aber auch Wissenschaftler waren immer wieder Verfolgung ausgesetzt. Entweder weil ihre Forschungen oder ihre Person Bildern und Erwartungen nicht gerecht wurden. Diesen Wissenschaftlern folgt Thomas Bührke durch ihr Leben und ihre Arbeitsgebiete. Die Liste ist erstaunlich. Wie Lise Meitner und Albert Einstein, die beide wegen ihrer jüdischen Abstammungen ihre Heimat verlassen mussten. Einstein traf es danach noch einmal, als er in den USA in der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt wurde. Alan Turing war ein genialer wie seltsamer Spezialist für Informations-Wissenschaft und besonders für Kryptografie. Ihm wurde seine Homosexualität zum Verhängnis, der Versuch einer Konversion trieb ihn am Ende in den Suizid. Giordano Bruno war Astronom und Philosoph. Seine Erkenntnisse in der Astronomie konnte die Kirche nicht hinnehmen. Denn schon er ahnte, das Universum sei unendlich und die Zahl der bewohnbaren Erden unüberschaubar. Das passte nicht zum Gottesbegriff der Kirche.
So bietet Bührke acht Biografien berühmter Wissenschaftler und warum sie scheiterten. Obwohl diese Biografien eher grob gehalten sind, erfährt man doch eine Menge über diese Menschen, ihren Lebenslauf und einige Details zu ihren Forschungen. Die Gründe, warum sie verfolgt wurden, sind vielfältig, wie auch die Charaktere der Protagonisten. Gemeinsam haben die Verfolgungen, dass Widersprüche gegen Rassismus, politische Ansprüche und Intoleranz nicht ohne Folgen blieben. Eine interessante Übersicht zu einem selten beachteten Thema.
Thomas Bührke (* 7. Dezember 1956 in Celle) ist ein deutscher Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Buchautor in den Bereichen Raumfahrt, Physik und Astrophysik. Nach der Schulzeit in Celle begann Bührke 1976 ein Physikstudium in Göttingen. 1980 wechselte er an die Universität Heidelberg, wo er 1983 am Max-Planck-Institut für Kernphysik abschloss. 1986 promovierte er am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Ab 1988 schrieb er als Redakteur bei den Physikalischen Blättern. Seit 1990 arbeitet er als Redakteur von Physik in unserer Zeit sowie als freier Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Darstellung astronomischer Themen. Regelmäßig veröffentlicht er in Tageszeitungen und Zeitschriften wie «Süddeutsche Zeitung», «Die Welt», «Berliner Zeitung», «Spektrum der Wissenschaft», «Bild der Wissenschaft» und «Sterne und Weltraum». Bührke wohnt in Schwetzingen.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Thomas Bührke aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Thomas Bührke aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
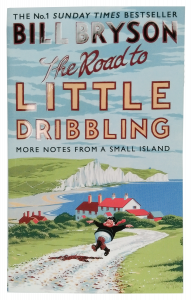 Manchmal überfallen mich wunderliche Gelüste. Zum Beispiel mal wieder ein englisches Buch zu lesen. Um mit der Heimat meines Herzens in enger Verbindung zu bleiben. Zum Glück hatte ich noch einige auf der Einkaufsliste, eines davon von einem meiner liebsten Autoren, Bill Bryson. Der US-Amerikaner aus Iowa, der 1973 in Großbritannien als Journalist seine Frau kennenlernte und blieb. Aus Liebe zu seiner Frau, und später aus Liebe zu dieser Insel. Arbeitete zuerst für die englischen Zeitungen «The Times» und «The Independent», besserte mit Reiseberichten sein Einkommen auf. Mit einem Buch über seine erste Reise, «Notes From a Small Island», sein Kennenlernen der neuen Heimat, gelang Bryson 2003 der Durchbruch als Autor. Seitdem ist er bekannt, in Großbritannien eher berühmt. Das war auch das erste Buch mit dem deutschen Titel «Reif für die Insel», das ich von ihm gelesen habe. Diese zweite Reisebeschreibung, erschienen 2015, ist bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das hat seinen Grund, denn interessant ist es erst dann, wenn man wenigstens einige Gegenden und Orte, die Bryson beschreibt, selbst kennt. Bei mir waren es die meisten Gegenden, Dörfer und Städte, was die Spannung noch steigerte. Also heute ein englisches Buch. Zugleich ein Lob an die ÜbersetzerInnen der deutschen Ausgaben seiner Bücher, denn sie haben in diesen das erhalten, was auch die englischen Bücher von Bryson ausmacht: pures Lesevergnügen.
Manchmal überfallen mich wunderliche Gelüste. Zum Beispiel mal wieder ein englisches Buch zu lesen. Um mit der Heimat meines Herzens in enger Verbindung zu bleiben. Zum Glück hatte ich noch einige auf der Einkaufsliste, eines davon von einem meiner liebsten Autoren, Bill Bryson. Der US-Amerikaner aus Iowa, der 1973 in Großbritannien als Journalist seine Frau kennenlernte und blieb. Aus Liebe zu seiner Frau, und später aus Liebe zu dieser Insel. Arbeitete zuerst für die englischen Zeitungen «The Times» und «The Independent», besserte mit Reiseberichten sein Einkommen auf. Mit einem Buch über seine erste Reise, «Notes From a Small Island», sein Kennenlernen der neuen Heimat, gelang Bryson 2003 der Durchbruch als Autor. Seitdem ist er bekannt, in Großbritannien eher berühmt. Das war auch das erste Buch mit dem deutschen Titel «Reif für die Insel», das ich von ihm gelesen habe. Diese zweite Reisebeschreibung, erschienen 2015, ist bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das hat seinen Grund, denn interessant ist es erst dann, wenn man wenigstens einige Gegenden und Orte, die Bryson beschreibt, selbst kennt. Bei mir waren es die meisten Gegenden, Dörfer und Städte, was die Spannung noch steigerte. Also heute ein englisches Buch. Zugleich ein Lob an die ÜbersetzerInnen der deutschen Ausgaben seiner Bücher, denn sie haben in diesen das erhalten, was auch die englischen Bücher von Bryson ausmacht: pures Lesevergnügen.
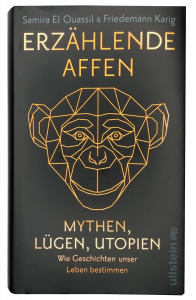 Homo Sapiens ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das der Sprache mächtig ist. Sein großer evolutionärer Vorteil, weil so Erfahrungen, Wissen und Informationen weitergegeben werden, an andere Menschen und gerade an seine Nachfahren. Doch es ist nicht die Sprache allein, was den Menschen ausmacht. Mittels Sprache kann der Mensch Geschichten erzählen, seien es wahre Begebenheiten, Mythen, Märchen, Phantasien und Lügen. Denn nach Geschichten, so El Ouassil und Karig, sind die Menschen geradezu süchtig. Aus gutem Grund, denn nur Geschichten helfen zu verstehen, Zusammenhänge zu erfassen und Begründungen zu finden, für möglichst alles, was Menschen umgibt. Noch mehr, brauchen die Menschen sogar kausale Zusammenhänge, suchen sie verzweifelt, wenn sie nicht offensichtlich sind. Götter, die Wetter, Naturkatastrophen und Schicksale bestimmen, Freunde und Feinde, die über Wohl und Wehe entscheiden. Doch gerade da liegt auch die Gefahr von Geschichten. Von der Begründung der Religionen über angebliche Erbfeindschaften bis hin zu Lügengebäuden wie die der Nationalsozialisten oder eines Donald Trump. Schon wieder so ein Brecher von Buch. Und wieder eines, das bis zum Ende spannend bleibt. Sogar erstaunliche Einsichten liefert. Auch zu sehen auf der Buchmesse Frankfurt.
Homo Sapiens ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das der Sprache mächtig ist. Sein großer evolutionärer Vorteil, weil so Erfahrungen, Wissen und Informationen weitergegeben werden, an andere Menschen und gerade an seine Nachfahren. Doch es ist nicht die Sprache allein, was den Menschen ausmacht. Mittels Sprache kann der Mensch Geschichten erzählen, seien es wahre Begebenheiten, Mythen, Märchen, Phantasien und Lügen. Denn nach Geschichten, so El Ouassil und Karig, sind die Menschen geradezu süchtig. Aus gutem Grund, denn nur Geschichten helfen zu verstehen, Zusammenhänge zu erfassen und Begründungen zu finden, für möglichst alles, was Menschen umgibt. Noch mehr, brauchen die Menschen sogar kausale Zusammenhänge, suchen sie verzweifelt, wenn sie nicht offensichtlich sind. Götter, die Wetter, Naturkatastrophen und Schicksale bestimmen, Freunde und Feinde, die über Wohl und Wehe entscheiden. Doch gerade da liegt auch die Gefahr von Geschichten. Von der Begründung der Religionen über angebliche Erbfeindschaften bis hin zu Lügengebäuden wie die der Nationalsozialisten oder eines Donald Trump. Schon wieder so ein Brecher von Buch. Und wieder eines, das bis zum Ende spannend bleibt. Sogar erstaunliche Einsichten liefert. Auch zu sehen auf der Buchmesse Frankfurt.
 «Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier ...». So steht es in der Bibel in Genesis 1, 28. Leichter gesagt als getan. Aber das mit den Fischen ist ein guter Einstieg. Da bauten nämlich Ende des 19. Jahrhundert die Leute in Chicago den Sanitary and Ship Canal, um die Abwasser aus Chicago statt in den Lake Michigan in den Chicago River und Mississippi zu leiten. Dazu musste die Fließrichtung des Chicago River ab einer bestimmten Stelle umgeleitet werden. Womit sich in einem großen Teil der USA die Wasserversorgung drastisch veränderte. Doch es kam noch schlimmer. Unterhalb des Chicago River hausten vier asiatische Barscharten, die man ausgesetzt hatte, um Algen in den Griff zu bekommen. Leider gerieten die Barsche außer Kontrolle und vermehrten sich explosionsartig. Diese vier Barscharten in Kombination fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Durch den neuen Kanal konnten die Barsche in die großen Seen im Norden einwandern, welche sie ratzekahl leer gefressen hätten. So bekam das United States Army Corps of Engineers den Auftrag, einen Elektrozaun im Chicago River zu bauen, um die Barsche fernzuhalten. Doch damit war die Kette an Problemen, die man sich eingebrockt hatte, noch lange nicht zu Ende. Also kein Buch über Theorien, sondern ganz praktische Beispiele, wie die Krone der Schöpfung die Kontrolle verlor.
«Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier ...». So steht es in der Bibel in Genesis 1, 28. Leichter gesagt als getan. Aber das mit den Fischen ist ein guter Einstieg. Da bauten nämlich Ende des 19. Jahrhundert die Leute in Chicago den Sanitary and Ship Canal, um die Abwasser aus Chicago statt in den Lake Michigan in den Chicago River und Mississippi zu leiten. Dazu musste die Fließrichtung des Chicago River ab einer bestimmten Stelle umgeleitet werden. Womit sich in einem großen Teil der USA die Wasserversorgung drastisch veränderte. Doch es kam noch schlimmer. Unterhalb des Chicago River hausten vier asiatische Barscharten, die man ausgesetzt hatte, um Algen in den Griff zu bekommen. Leider gerieten die Barsche außer Kontrolle und vermehrten sich explosionsartig. Diese vier Barscharten in Kombination fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Durch den neuen Kanal konnten die Barsche in die großen Seen im Norden einwandern, welche sie ratzekahl leer gefressen hätten. So bekam das United States Army Corps of Engineers den Auftrag, einen Elektrozaun im Chicago River zu bauen, um die Barsche fernzuhalten. Doch damit war die Kette an Problemen, die man sich eingebrockt hatte, noch lange nicht zu Ende. Also kein Buch über Theorien, sondern ganz praktische Beispiele, wie die Krone der Schöpfung die Kontrolle verlor.
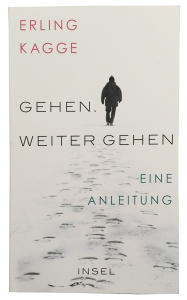 Nach einer im «The Guardian» veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, den Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum das Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken, die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet. Wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die Bipedie, ist jedoch nicht seine Erfindung, schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo Sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kagge viel mehr als Bequemlichkeit, es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurück kommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen, das ist es, was Kagge antreibt. Und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut. Wenn ich an meine Wanderungen in Snowdonia und im Lake District zurück denke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern.
Nach einer im «The Guardian» veröffentlichten Untersuchung sind drei Viertel der Kinder und Jugendlichen in Großbritannien weniger draußen als Gefängnisinsassen. Für Deutschland würden die Zahlen nicht viel anders aussehen. Vor der Bankfiliale in unserem Dorf parken nicht selten Leute direkt vor der Tür auf dem Gehweg, weil sie die zehn Meter vom Parkplatz nicht bis zum Eingang schaffen oder gehen wollen. Das andere Extrem ist der Norweger Erling Kagge, der sich zu Fuß auf den Weg zu Nord- und Südpol machte, den Mount Everest bestieg, New York durchquerte, zum Teil durch die Kanalisation. In seinem Buch beschreibt er, warum für ihn das Gehen so wichtig ist, warum das Gehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist. Doch es ist nicht nur das Gehen als solches, sondern das Unterwegssein, das Erkunden und Entdecken, die kleine Flucht aus dem Alltag mit Fernsehen, Kontoauszügen und Arbeiten in seinem Verlag. So ist sein Essay weniger eine Schilderung seiner Wanderungen und Unternehmungen, sondern eine philosophisch angehauchte Betrachtung, was Gehen für den Menschen bedeutet. Wenn nicht das Gehen erst den Menschen zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das Gehen auf zwei Beinen, die Bipedie, ist jedoch nicht seine Erfindung, schon der Australopithecus war zwei Millionen Jahre vor ihm so auf dem Weg. Erst Homo Sapiens machte sich dann auf den langen Weg in alle Welt. Doch das sind nur die Seitenblicke auf das Wesentliche, der Verlust des Kontaktes des modernen Menschen zur Natur, zum bewussten Sehen und eben sich fortbewegen. Das Aufgeben des Gehens bedeutet nach Kagge viel mehr als Bequemlichkeit, es ist der Verzicht auf das wirkliche Wahrnehmen der Welt um uns herum. Es ist kein Märchen, dass das Wandern im Wald so erholsam und erleichternd sein kann. Beim Wandern zu sich zurück kommen, wieder einen Blick für das Wesentliche zu bekommen, das ist es, was Kagge antreibt. Und ich verstehe ihn und sein Buch sehr gut. Wenn ich an meine Wanderungen in Snowdonia und im Lake District zurück denke und mich erinnere, wie ich mit jedem Schritt der wahren Welt näher kam. Ein kluges Buch mit vielen Querbezügen, eine Aufforderung zum Entdecken und Erwandern.
 Dieser Text basiert auf dem Artikel Erling Kagge aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Erling Kagge aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
[/av_promobox]
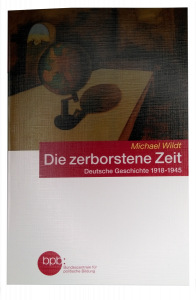 Dass man Geschichte durchaus interessant, sogar spannend und unterhaltend darstellen kann, hatten schon Bücher wie «Acht Tage im Mai» oder «Februar 33» bewiesen. Nicht ohne Grund bezieht sich Michael Wildt in seinem Vorwort auf «Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts» vom Historiker und Erzähler Golo Mann, immer noch ein Highlight der historischen Literatur. Nicht als Vergleich, sondern um eine neue, oder weitere Art der Darstellung der unruhigen und unrühmlichen Zeit in diesem unserem Lande zu eröffnen. Vergleichen kann sich Wildt mit Mann allerdings in einem Fall, nämlich was den Umfang des Buches angeht. Ein ziemlich heftiges Bündel Papier, was der Preis bei der BPB gar nicht vermuten lässt. Mit solchen Schinken tue ich mich immer zuerst etwas schwer. Weil sie doch eine lange Konzentration abverlangen und den Weg zu weiteren Büchern eine Zeit lang blockieren. So musste ich einen ordentlichen Anlauf nehmen, bevor ich die ersten Seiten aufschlug. Schon im Vorwort kündigt Wildt jedoch an, ein anderes Herangehen an die Erzählung der Geschichte wählen zu wollen als andere Autoren. Vereinfacht gesagt, einmal eher gröber, andererseits detaillierter. Und in der Tat entpuppt sich Wildts Art der Annäherung an diese vielschichtige und spannende Zeit als hervorragendes Rezept. So dass das Buch gerne immer wieder nach leider notwendigen Pausen in die Hand genommen wird. Um beim Begriff Rezept zu bleiben: es mundet ausgesprochen gut.
Dass man Geschichte durchaus interessant, sogar spannend und unterhaltend darstellen kann, hatten schon Bücher wie «Acht Tage im Mai» oder «Februar 33» bewiesen. Nicht ohne Grund bezieht sich Michael Wildt in seinem Vorwort auf «Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts» vom Historiker und Erzähler Golo Mann, immer noch ein Highlight der historischen Literatur. Nicht als Vergleich, sondern um eine neue, oder weitere Art der Darstellung der unruhigen und unrühmlichen Zeit in diesem unserem Lande zu eröffnen. Vergleichen kann sich Wildt mit Mann allerdings in einem Fall, nämlich was den Umfang des Buches angeht. Ein ziemlich heftiges Bündel Papier, was der Preis bei der BPB gar nicht vermuten lässt. Mit solchen Schinken tue ich mich immer zuerst etwas schwer. Weil sie doch eine lange Konzentration abverlangen und den Weg zu weiteren Büchern eine Zeit lang blockieren. So musste ich einen ordentlichen Anlauf nehmen, bevor ich die ersten Seiten aufschlug. Schon im Vorwort kündigt Wildt jedoch an, ein anderes Herangehen an die Erzählung der Geschichte wählen zu wollen als andere Autoren. Vereinfacht gesagt, einmal eher gröber, andererseits detaillierter. Und in der Tat entpuppt sich Wildts Art der Annäherung an diese vielschichtige und spannende Zeit als hervorragendes Rezept. So dass das Buch gerne immer wieder nach leider notwendigen Pausen in die Hand genommen wird. Um beim Begriff Rezept zu bleiben: es mundet ausgesprochen gut.
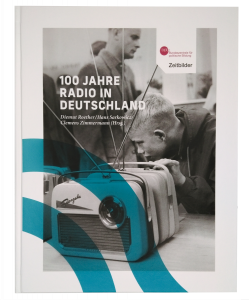 »Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 Meter.« So begann am 29. Oktober 1923 die Zeit eines damals ganz neuen Mediums. Inzwischen hat das Radio, genauer der Hörfunk, viele Etappen hinter sich bringen müssen. Argwöhnisch beäugt in der Weimarer Republik und wie selbstverständlich staatsdienend, als Propagandainstrument in den Händen der Nazis, auferstanden aus Ruinen nach 1945, im Westen runderneuert am Beispiel der BBC, bevor die Alliierten ihn in die Hände des neuen deutschen Staates gaben. Auf der anderen Seite des Zaunes blieb das Radio Instrument des Staates, mit ihm sollte im real existierenden Sozialismus der neue Mensch gebildet, erzogen und informiert werden. Auch diese Phase fand 1989 ihr Ende. Seitdem gibt es wieder den MDR und der NDR hat neue Sendegebiete hinzu bekommen. Deutschland, einig Radioland. Zum runden Geburtstag hat nun die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Deutschen Rundfunkarchiv diesen Sonderband heraus gegeben. Für mich als Radiofreak seit meiner Kindheit, Fan von WDR 5 und Deutschlandfunk, ein Muss. Dabei als Hardcover im Großformat für nur sieben Euro ein tolles Geschenk für alle, die immer noch Radio hören, lieben und nicht darauf verzichten möchten.
»Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 Meter.« So begann am 29. Oktober 1923 die Zeit eines damals ganz neuen Mediums. Inzwischen hat das Radio, genauer der Hörfunk, viele Etappen hinter sich bringen müssen. Argwöhnisch beäugt in der Weimarer Republik und wie selbstverständlich staatsdienend, als Propagandainstrument in den Händen der Nazis, auferstanden aus Ruinen nach 1945, im Westen runderneuert am Beispiel der BBC, bevor die Alliierten ihn in die Hände des neuen deutschen Staates gaben. Auf der anderen Seite des Zaunes blieb das Radio Instrument des Staates, mit ihm sollte im real existierenden Sozialismus der neue Mensch gebildet, erzogen und informiert werden. Auch diese Phase fand 1989 ihr Ende. Seitdem gibt es wieder den MDR und der NDR hat neue Sendegebiete hinzu bekommen. Deutschland, einig Radioland. Zum runden Geburtstag hat nun die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Deutschen Rundfunkarchiv diesen Sonderband heraus gegeben. Für mich als Radiofreak seit meiner Kindheit, Fan von WDR 5 und Deutschlandfunk, ein Muss. Dabei als Hardcover im Großformat für nur sieben Euro ein tolles Geschenk für alle, die immer noch Radio hören, lieben und nicht darauf verzichten möchten.
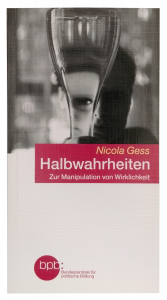 Donald Trump erzählte einmal, der deutsche Golfer Bernhard Langer hätte ihm berichtet, wie er vor einem Wahllokal in den USA 2016 merkwürdige Vorgänge beobachtet habe. Dazu befragt, sagte Langer, dass er Trump niemals persönlich getroffen hätte. Zwar konnte Langer sich daran erinnern, mit Leuten über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Wahlsystems gesprochen zu haben, aber niemals mit Donald Trump. Ein typisches Beispiel für Halbwahrheiten, denen sich Nicola Gess in ihrem Essay widmet. Wie der Name schon sagt, sind Halbwahrheiten keine Lügen. Stattdessen werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, verfälscht oder in einen anderen Kontext gesetzt, so dann uminterpretiert. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch die Wirkung von Halbwahrheiten ist verheerend. Wie im Buch zu lesen, sind Halbwahrheiten gefährlicher als Lügen, weil nicht mehr klar erkennbar ist, was noch Fakt und was Fiktion. Das Thema hat jedoch in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugelegt, weil Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen diese Kommunikationsform ausgiebig nutzen. Weil die Wirkung von Halbwahrheiten umso größer ist, je stärker sie die schon vorhandenen Überzeugungen belegen. Wie auch immer bezeichnet, als Halbwahrheiten, alternative Fakten, oder als Bullshit.
Donald Trump erzählte einmal, der deutsche Golfer Bernhard Langer hätte ihm berichtet, wie er vor einem Wahllokal in den USA 2016 merkwürdige Vorgänge beobachtet habe. Dazu befragt, sagte Langer, dass er Trump niemals persönlich getroffen hätte. Zwar konnte Langer sich daran erinnern, mit Leuten über die Ungerechtigkeit des amerikanischen Wahlsystems gesprochen zu haben, aber niemals mit Donald Trump. Ein typisches Beispiel für Halbwahrheiten, denen sich Nicola Gess in ihrem Essay widmet. Wie der Name schon sagt, sind Halbwahrheiten keine Lügen. Stattdessen werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen, verfälscht oder in einen anderen Kontext gesetzt, so dann uminterpretiert. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch die Wirkung von Halbwahrheiten ist verheerend. Wie im Buch zu lesen, sind Halbwahrheiten gefährlicher als Lügen, weil nicht mehr klar erkennbar ist, was noch Fakt und was Fiktion. Das Thema hat jedoch in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugelegt, weil Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu Rechtsextremen diese Kommunikationsform ausgiebig nutzen. Weil die Wirkung von Halbwahrheiten umso größer ist, je stärker sie die schon vorhandenen Überzeugungen belegen. Wie auch immer bezeichnet, als Halbwahrheiten, alternative Fakten, oder als Bullshit.
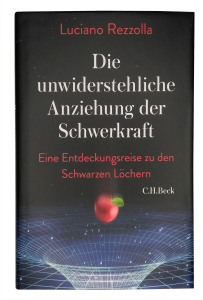 Ich habe einen Moment nachdenken müssen, warum mir der Titel des Buches so bekannt vorkam. Es ist der verballhornte Name des Monty Python-Films »Die wunderbare Welt der Schwerkraft«. Mit Sketchen oder Satire hat das Buch jedoch nichts zu tun. Es erhebt nämlich den Anspruch, auch physikalisch und mathematisch wenig vorbelasteten Lesern den Wirkungskreis der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie vorzustellen. Es geht um Neutronensterne, Schwarze Löcher und weitere Phänomene wie Gravitationswellen. Kompetenz kann man Luciano Rezzolla bestimmt nicht absprechen. Der in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker gehörte zu den Ersten, denen es gelang, fotografische Bilder eines supermassiven Schwarzen Lochs zu erstellen. Wie das ging, ist im Buch ausführlich beschrieben. Nun hat Charlie Chaplin bei einem Pressetermin zu Albert Einstein gesagt, die Menschen liebten ihn, weil alle verstehen, was er macht. Während sie Einstein liebten, weil sie nichts von dem verstehen, was er macht. An diesem Punkt war ich auch, wollte aber immer gerne wissen, was Ereignishorizont, Raumzeit und Gravitation eigentlich sind. So war ich gespannt, ob das Buch hält, was der Autor verspricht.
Ich habe einen Moment nachdenken müssen, warum mir der Titel des Buches so bekannt vorkam. Es ist der verballhornte Name des Monty Python-Films »Die wunderbare Welt der Schwerkraft«. Mit Sketchen oder Satire hat das Buch jedoch nichts zu tun. Es erhebt nämlich den Anspruch, auch physikalisch und mathematisch wenig vorbelasteten Lesern den Wirkungskreis der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie vorzustellen. Es geht um Neutronensterne, Schwarze Löcher und weitere Phänomene wie Gravitationswellen. Kompetenz kann man Luciano Rezzolla bestimmt nicht absprechen. Der in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker gehörte zu den Ersten, denen es gelang, fotografische Bilder eines supermassiven Schwarzen Lochs zu erstellen. Wie das ging, ist im Buch ausführlich beschrieben. Nun hat Charlie Chaplin bei einem Pressetermin zu Albert Einstein gesagt, die Menschen liebten ihn, weil alle verstehen, was er macht. Während sie Einstein liebten, weil sie nichts von dem verstehen, was er macht. An diesem Punkt war ich auch, wollte aber immer gerne wissen, was Ereignishorizont, Raumzeit und Gravitation eigentlich sind. So war ich gespannt, ob das Buch hält, was der Autor verspricht.
